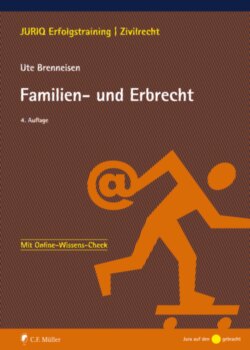Читать книгу Familien- und Erbrecht - Ute Brenneisen - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Teil Familienrecht › B. Verlöbnis
B. Verlöbnis
1. Teil Familienrecht › B. Verlöbnis › I. Begriff und Rechtsnatur des Verlöbnisses
I. Begriff und Rechtsnatur des Verlöbnisses
6
Ein Verlöbnis ist das gegenseitig gegebene Versprechen, die Ehe einzugehen.
Unter dem Begriff des Verlöbnisses wird auch das dadurch begründete Schuldverhältnis verstanden. Das Eheversprechen kann formfrei und damit auch konkludent erklärt werden.
7
Die Rechtsnatur des Verlöbnisses ist umstritten. Der Theorienstreit wirkt sich nur bei Verlöbnissen beschränkt geschäftsfähiger Personen aus.
8
Nach der Vertragstheorie[1] handelt es sich um einen formlosen Vertrag, auf den die allgemeinen Vorschriften des BGB und damit auch die §§ 104 ff. Anwendung finden. Für das wirksame Zustandekommen des Vertrags ist daher die Geschäftsfähigkeit der Vertragsschließenden bzw. die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des beschränkt Geschäftsfähigen erforderlich. Allerdings benötigt der beschränkt Geschäftsfähige keine Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, wenn er von dem Verlöbnis zurücktreten will. Das ergibt sich daraus, dass niemand zur Eingehung einer Ehe nach § 1297 Abs. 1 gezwungen werden kann.[2] Ausnahmen von der Geltung des Vertragsrechts bestehen nur darin, dass die Vorschriften über die Stellvertretung nicht anwendbar sind, da das Verlöbnis ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft ist.
9
Nach der Theorie vom familienrechtlichen Vertrag[3] ist das Verlöbnis ein Vertrag sui generis, für den eine Geschäftsfähigkeit der Vertragsschließenden nicht erforderlich ist. Vielmehr kommt es auf die Verlöbnisfähigkeit in Form einer individuellen geistigen Reife an.
10
Nach der Lehre der Vertrauenshaftung[4] ist das Verlöbnis kein Vertrag, sondern ein gesetzliches Vertrauensverhältnis der Verlobten zueinander. Für die Begründung des Verlöbnisses ist keine Geschäftsfähigkeit erforderlich, sondern nur eine Einsichtsfähigkeit.
11
Stellungnahme: Die Theorie vom gesetzlichen Rechtsverhältnis (Vertrauenstheorie) berücksichtigt nicht, dass dem gegenseitigen Versprechen auf Eingehung der Ehe eine Einigung zugrunde liegen muss und dass das Verlöbnis rechtgeschäftlichen Charakter hat. Die Theorie vom familienrechtlichen Vertrag führt zu Rechtsunsicherheiten, weil das Verlöbnis bis zur Feststellung der individuellen Reife eines Minderjährigen unsicher ist. Für die Vertragstheorie spricht, dass sie Rechtsunsicherheiten vermeidet und den beschränkt Geschäftsfähigen davor schützt, bei einem Rücktritt von dem Verlöbnis Aufwendungs- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sein.
1. Teil Familienrecht › B. Verlöbnis › II. Rechtswirkungen
II. Rechtswirkungen
12
Das Verlöbnis begründet zwar eine Rechtspflicht zur Eingehung der Ehe. Aus einem Verlöbnis kann indes gemäß § 1297 Abs. 1 nicht auf die Eingehung der Ehe geklagt werden. Das Versprechen zur Eingehung der Ehe ist gemäß § 120 Abs. 3 FamFG auch nicht vollstreckbar und kann nach § 1297 Abs. 2 nicht durch eine Vertragsstrafe abgesichert werden.
Hinweis
Verlobte können nach § 1408 einen Ehevertrag schließen, wobei sich dessen Wirkungen erst mit der Eingehung der Ehe entfalten. Zu der Errichtung eines gemeinsamen Testaments nach § 2265 sind sie nicht berechtigt. Verlobte können sich im Zivil- und im Strafprozess auf Zeugnisverweigerungsrechte (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, §§ 52 Abs. 1 Nr. 1, 55 StPO) und im Strafprozessrecht auf Auskunftsverweigerungsrechte (§ 55 StPO) berufen. Ein Verlöbnis begründet auch eine Garantenstellung i.S.v. § 13 StGB.
1. Teil Familienrecht › B. Verlöbnis › III. Beendigung des Verlöbnisses
III. Beendigung des Verlöbnisses
13
Das Verlöbnis wird durch die Eheschließung, durch den Tod, durch eine Entlobung (Aufhebungsvertrag) oder durch Rücktritt nach §§ 1298 ff. beendet. Auf die Rücktrittsregeln wollen wir im Folgenden näher eingehen.
1. Rücktritt und Schadensersatz
14
Der Rücktritt von einem Verlöbnis wirkt nur ex nunc und hat zur Folge, dass das Verlöbnis aufgehoben wird und auch der andere Partner nicht mehr an das Heiratsversprechen gebunden ist. Ein Minderjähriger bedarf für die Erklärung des Rücktrittes nicht der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Dies folgt aus dem Rechtsgedanken des § 1297 BGB, wonach niemand gegen seinen Willen an ein Verlöbnis gebunden sein soll. Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis zurück, hängen die Rechtsfolgen des Rücktritts davon ab, ob für den Rücktritt ein wichtiger Grund i.S.v. § 1298 Abs. 3 vorlag. Als wichtige Gründe i.S.v. § 1298 Abs. 3 kommen solche Gründe in Betracht, die zur Anfechtung wegen Irrtums oder wegen arglistiger Täuschung berechtigen würden und daher die Aufrechterhaltung des Verlöbnisses unter Würdigung aller Umstände unzumutbar ist.[5] Dies ist in einem Fall angenommen worden, in dem ein Verlobter verschwiegen hat, dass er noch verheiratet ist. Der Verlobten ist ein Anspruch auf Ersatz der Schäden zuerkannt worden, die ihr durch Aufwendungen in Erwartung einer Eheschließung entstanden sind.[6] Ist der Verlobte aus wichtigem Grund von dem Verlöbnis zurückgetreten, ist er nicht schadensersatzpflichtig.
15
Dagegen hat derjenige, der ohne wichtigen Grund von dem Verlöbnis zurückgetreten ist, nach § 1298 Abs. 1 dem anderen Verlobten, dessen Eltern und Dritten, die an Stelle der Eltern gehandelt haben, Schadensersatz zu leisten. Der Schaden erfasst die Aufwendungen und Verbindlichkeiten, sowie sonstige sein Vermögen oder seine Erwerbsstellung berührenden Maßnahmen, die im Hinblick auf die Erwartung der Ehe gemacht worden sind. Der Schadensersatzanspruch erfasst nur das negative Interesse.
Beispiel
Kosten der Verlobungsanzeige, Buchung der Hochzeitsreise, Kauf des Brautkleids.
16
Die Höhe des Schadens ist zudem nach § 1298 Abs. 2 auf die Maßnahmen begrenzt, die nach den Umständen angemessen waren.
Beispiel
Unangemessen kann die Kündigung des Arbeitsplatzes ohne Absprache mit dem Verlobten sein.
17
Hat der andere Verlobte schuldhaft einen wichtigen Rücktrittsgrund gesetzt, so stehen die gleichen Ansprüche gemäß § 1299 dem zurücktretenden Verlobten und dessen Verwandten zu.
Hinweis
Bei einem Rücktritt vom Verlöbnis sind neben den Ansprüchen aus §§ 1298 ff. auch Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung nach §§ 823 ff. möglich. Für die Geltendmachung solcher Schadensansprüche ist ein schuldhaftes Verhalten erforderlich, das über den Bruch der Verlöbnistreue hinausgeht. Die Verjährungsfrist der Schadensersatzansprüche nach §§ 1298 ff. beginnt nach § 1302 mit der Auflösung des Verlöbnisses und unterliegt seit dem 1.1.2010 den allgemeinen Verjährungsvorschriften der § 195 ff.
2. Rückgabe von Geschenken
18
Nach § 1301 S. 1 können bei der Beendigung des Verlöbnisses die beiderseits gewährten Geschenke und Verlöbniszeichen (Ringe) nach Bereicherungsrecht zurückgefordert werden. Nach h.M.[7] handelt es sich bei der Verweisung auf das Bereicherungsrecht um eine Rechtsfolgenverweisung, da die Vorschrift eine Erweiterung der Zweckverfehlungstheorie nach § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 sei. Die Herausgabepflicht ist ausgeschlossen, wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach, § 814 Alt. 2 Gleiches gilt, wenn der Leistende den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat. Dieses Tatbestandmerkmal erfordert erschwerende Umstände, die ein besonders treuwidriges Verhalten darstellen.
Beispiel
Verschweigen eines Doppelverlöbnisses.
19
Bei § 1301 handelt es sich um eine Vorschrift, die § 530 als lex specialis verdrängt.