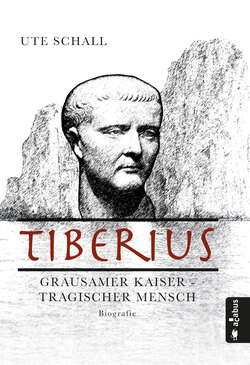Читать книгу Tiberius. Grausamer Kaiser - tragischer Mensch - Ute Schall - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mord und Totschlag –
die letzten Tage der Republik
ОглавлениеZur Zeit von Tiberius’ Geburt waren die politischen Verhältnisse in Rom äußerst verworren. Stadt und Reich hatten fast ein Jahrhundert blutigster Bürgerkriege hinter sich, und es hatte nicht den Anschein, als wäre deren Ende erreicht. Nie zuvor hatten Angehörige der führenden Schicht erbitterter um die Macht gekämpft und waren in der Wahl der Mittel, diese an sich zu reißen, rücksichtsloser vorgegangen. Mord und Totschlag standen auf der Tagesordnung, und kaum jemand musste befürchten, für begangene Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Mit den revolutionären Ideen der Gebrüder Gracchi hatte es im letzten Drittel des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts begonnen, einer umfassenden, die unteren Stände Roms begünstigenden, letztlich aber fehlgeschlagenen Bodenreform. Sulla hatte als Diktator fast alle verfolgt und umgebracht, die ihm im Wege standen und auf die Proskriptionslisten gesetzt worden waren, und das sinnlose Töten war weitergegangen bis zu Caesars gewaltsamem Tod, ja in den sich daran anschließenden Bürgerkriegen weit darüber hinaus. Schon war die herrschende Klasse Roms nahezu ausgeblutet. Neue Geschlechter hatten mehr oder weniger erfolgreich begonnen, das politische Tagesgeschehen zu beeinflussen. Aber auch sie sahen sich bald an den Grenzen ihrer Möglichkeiten.
In atemberaubender Geschwindigkeit hatte sich Rom in nur wenigen Jahrzehnten nahezu den gesamten Erdkreis unterworfen oder jedenfalls das, was man dort, im Zentrum der Macht, darunter verstand. Vielleicht lag es ja daran, dass man sich nun im Inneren zu zerfleischen begann. Viele mochten ahnen, dass die nun schon fast hundert Jahre dauernde schreckliche Zeit, die vor allem die Metropole am Tiber geschwächt hatte, noch lange nicht zu Ende war. Und doch weigerte sich die Mehrheit zu glauben, dass die so oft beschworene res publica verloren war.
Lange vor der Mitte des letzten vorchristlichen Jahrhunderts nutzten in Rom drei Männer die politischen Verwirrungen aus und beschlossen, die Herrschaft an sich zu reißen und einen Bund, das bereits erwähnte Triumvirat, einen Dreimännerrat, ins Leben zu rufen. Darunter war ein bis vor einigen Jahren noch weitgehend Unbekannter aus der Sippe der Julier, der immer mehr von sich reden machte und dem der Ruf eines großen Schuldners anhaftete. Unter dem Cognomen Caesar sollte er einst als einer der größten Römer in die Geschichte eingehen, ein Namenszusatz, der sich wohl vom punischen aesar, ableitete, was so viel wie „Elefant“ bedeutete. Angeblich hatte einer von Caesars Vorfahren mit der Tötung eines solchen Tieres einen gewissen Ruhm erlangt.
Bei dem zweiten Triumvirn handelte es sich um den allseits bekannten Pompeius, einen wohlhabenden und sehr angesehenen Römer, dem schon zu Lebzeiten der seltene Titel Magnus, „der Große“, verliehen worden war, da er Roms Einfluss in der Welt durch zahlreiche Eroberungen erheblich erweitert hatte.
Und schließlich Crassus, der zu den reichsten Männern nicht nur der Stadt, sondern des gesamten Imperiums gehörte. Sein märchenhaftes Vermögen verdankte er vor allem dem Handel mit menschlicher Ware. Anders als seine beiden Kollegen im Dreimännerbund hatte er sich aber noch keinen militärischen Ruhm verdient, was nicht nur ihm selbst als Mangel erschien. Galt doch in Rom nur derjenige als wahrer Römer und wirklich bedeutend, der andere Völker unter das römische Joch gezwungen und das Imperium territorial erweitert hatte. Hier musste Abhilfe geschaffen werden.
Seit jeher galten die Parther, ein in Vorderasien siedelndes altes Kulturvolk, neben den stets aufmüpfigen Germanen als die Feinde Roms schlechthin. Generationen von Feldherrn und Soldaten hatten sich in den endlosen Schlachten, die die beiden Völker gegeneinander austrugen, aufgerieben, aber allenfalls zeitlich begrenzte Erfolge erzielen können. Nie war einem von ihnen ein diese Bezeichnung verdienender Sieg vergönnt. Die Parther waren – und blieben – eine ständige Bedrohung, die den römischen Frieden, die pax Romana, was immer man im Zentrum der Macht darunter verstand, nachhaltig störte.
Gemeinsam mit seinem Sohn machte sich Crassus auf den Weg, diese Gefahr ein für alle Mal zu bannen. Wahrscheinlich lag es an seiner mangelnden militärischen Erfahrung, dass er in eine Falle stolperte wie der Ochs ins Schlachthaus. Nie zuvor wurde einem römischen Feldherrn übler mitgespielt und die erhabene Roma tiefer gedemütigt. Unter dem Vorwand von Friedensverhandlungen lockte der parthische Anführer den arglosen Römer 53 v. Chr. bei Carrhae in einen Hinterhalt. Sein Sohn fiel bereits im Kampf. Crassus selbst wurde gefangen genommen und vor den parthischen König geschleppt. Dort wurde er auf grausamste Weise gefoltert. Man goss ihm, der dem Reichtum so sehr verfallen war, flüssiges Gold in die Kehle. Dann schlug man ihm den Kopf ab. Während eines großen Festgelages, das der König gerade gab, wanderte die blutige Trophäe als Spielball von Hand zu Hand, ehe sie im Kuriositätenkabinett des Herrschers verschwand.
Empörter noch als über die Behandlung eines ihrer einflussreichsten Männer war die römische Führung über den Verlust der Feldzeichen, die die Parther erbeutet hatten und sich verständlicherweise zurückzugeben weigerten. Es war für die Weltstadt am Tiber geradezu eine Schmach, die neue Feldzüge und weiteres Blutvergießen forderte. Erst Jahrzehnte später sollte es Tiberius unter Kaiser Augustus gelingen, diese für Rom so wichtigen Symbole auf diplomatischem Weg zurückzugewinnen.
Crassus starb, wie gesagt, im Jahr 53 v. Chr. Das Triumvirat war damit beendet. Aber Caesar und Pompeius Magnus hatten ihre Macht bereits derart gefestigt, dass nun ein gnadenloser Kampf der beiden Männer um die Vorherrschaft begann, den zuletzt beide nicht überleben sollten. Er wolle, so ließ Caesar verkünden, lieber in jedem beliebigen Dorf der Erste als in Rom nur der Zweite sein. Daraus lässt sich schießen, dass er wohl auf die Macht ganz verzichtet hätte, wäre er Pompeius unterlegen. Wie feindlich sie sich gegenüber standen, sollte die nahe Zukunft zeigen.
Zu Beginn der gemeinsamen Herrschaft, 60 v. Chr., hatte Caesar seine Tochter Julia, das einzige legitime Kind, das er hatte, Pompeius zur Frau gegeben, freilich keineswegs, weil sich zwischen der jungen Frau und dem alternden Mann eine Liebesbeziehung angebahnt hätte. Es war ein politisches Zweckbündnis zur Absicherung des Triumvirats-Vertrages, wie es in Rom üblich war. War man doch davon überzeugt, dass nichts Partner stärker aneinander zu binden vermochte als familiäre Beziehungen. Als pflichtbewusste Römerin ließ Julia alles klaglos über sich ergehen, ja, es scheint, dass es ihr durch ihr freundliches Wesen sogar gelang, Unstimmigkeiten zwischen den beiden Männern, Vater und Gatten, auszugleichen. Vielleicht hätte sich deren Verhältnis und womöglich sogar die Weltgeschichte anders entwickelt, wäre Julia länger am Leben geblieben. Aber sie starb früh und ließ die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, ratlos zurück.
Was einigermaßen freundschaftlich begonnen hatte, entwickelte sich bald zu erbitterter Rivalität. Diese gipfelte darin, dass es Caesar, bislang mit der Eroberung Galliens beschäftigt, wagte, seine Truppen gegen Rom zu führen, ein unerhörter Vorgang, der in der Geschichte kaum seinesgleichen hatte. Die Aufregung in Rom war groß, als bekannt wurde, dass sich der Julier mit seinen Legionen der Stadt näherte, und niemand wusste, wem er sich in dem sich abzeichnenden Konflikt anschließen sollte. Den meisten Römern schien der gemäßigtere Pompeius das geringere Übel zu sein, versprach er doch, die res publica wenigstens in ihren Grundzügen aufrecht zu erhalten. Zudem verfügte er über eine größere Anzahl von Streitkräften und war überhaupt der Mächtigere von beiden. Allerdings befanden sich seine Truppen in Spanien, und es würde einige Zeit dauern, sie nach Italien zu führen und Caesar und dessen Männern entgegen zu werfen. Und die Gefahr war zu drohend, um im Mutterland selbst neue Soldaten zu rekrutieren.
Also forderte Pompeius Magnus den Senat auf, Italien sofort zu räumen, da er sich zu dessen Verteidigung nicht in der Lage sähe. Er selbst werde sich, so ließ er die eingeschriebenen Väter wissen, nach Griechenland begeben, um sich in Sicherheit zu bringen. Von dort aus werde er im Schutz der Flotte das verlorene Terrain zurückgewinnen. Vieler Worte bedurfte es nicht. Die meisten von Roms Noblen waren nur allzu bereit, ihm zu folgen. Feige ließen sie Frauen und Kinder und das einfache Volk schutzlos zurück.
In nicht einmal zwei Monaten hatte Caesar ganz Italien unter seine Kontrolle gebracht. Er zeigte sich gegenüber jedermann freundlich und leutselig, und machte von seiner inzwischen sprichwörtlichen Milde regen Gebrauch. So fiel es den Soldaten seines Gegners nicht schwer, in Scharen zu ihm überzulaufen, und auch das auf der Iberischen Halbinsel stationierte Heer, durch Pompeius’ Flucht jetzt führerlos, begab sich unter seinen Oberbefehl.
In Rom fürchtete indes jeder, der geblieben war, die fürchterlichen Proskriptionen eines Sulla, die viele noch miterlebt hatten, würden sich nun wiederholen. Aber zum allgemeinen Erstaunen befand Caesar, es sei genug Blut geflossen. Er begnadigte seine Gegner und rief diejenigen, die vor ihm geflohen waren, unter Zusicherung von Straffreiheit nach Rom zurück. Pompeius Magnus sah sich in die Defensive gedrängt. Aber er gab den Kampf noch nicht verloren.
Gegen Ende des Sommers 48 v. Chr. trafen schließlich die beiden feindlichen Heere in Griechenland in der Ebene von Pharsalos aufeinander. Pompeius’ Truppenkontingent und auch seine Reiterei waren Caesars Streitkräften zahlenmäßig weit überlegen. Aber Caesar hatte die geschicktere Taktik. Die kampferprobten Veteranen seiner berühmten X. Legion entschieden letztlich den Ausgang der Kampfhandlungen.
Ursprünglich hatte Pompeius geplant, auszuharren und die Entscheidungsschlacht hinauszuzögern. Aber seine Berater drängten ihn zu handeln. Es sollte sich bald herausstellen, dass gerade das ein verhängnisvoller Fehler war. Aber Pompeius wäre nicht Pompeius gewesen, hätte er sich nicht durch Vorzeichen abgesichert. Es war ein Traum, der für seine Entscheidung, sich dem Gegner jetzt zu stellen, den Ausschlag gab. Er sah sich ruhmbedeckt das in Rom von ihm erbaute Theater betreten, wo ihn eine riesige Menschenmenge mit tosendem Beifall empfing. Auch der Tempel der Venus Victrix, der siegreichen Göttin, tauchte vor ihm auf, mit zahllosen Beutestücken geschmückt. Was konnte dieses günstige Omen anderes bedeuten, als dass die Götter mit ihm waren?
Als er begriff, dass die Schlacht für ihn verloren war, zog er sich am Boden zerstört in sein Lager zurück. Doch Caesars Männer folgten ihm auf den Fersen. Schon kamen sie seiner Unterkunft bedrohlich nahe, da suchte er sein Heil in der Flucht. Um das Schicksal seiner Leute kümmerte er sich nicht. An der Küste fand er ein Handelsschiff, dessen Kapitän bereit war, ihn für ein hohes Bestechungsgeld aufzunehmen. Mit den wenigen Getreuen, die ihm geblieben waren, kam er an Deck. Einem Odysseus gleich durchkreuzte er nun ziellos das Meer.
Auf der Insel Lesbos wurden die Flüchtlinge abgesetzt. Dort raffte er einige Schiffe zusammen und nahm seine Frau Cornelia, die er nach Julias Tod geheiratet und mit der er einen Sohn hatte, an Bord. Weiter ging es nach Pamphylien. Kilikische Flotteneinheiten schlossen sich ihm an. Ebenso 60 Senatoren. Da fasste er neuen Mut. Doch als die Reisegesellschaft im griechischen Dyrrhachium ankam, der Hafenstadt, von der aus die Schiffe nach Brundisium fuhren, sprach sich herum, dass Pompeius feige geflohen war und seine Leute im Stich gelassen hatte. Als er mit den wenigen Anhängern, die jetzt noch an ihn glaubten, vor Rhodos ankern wollte, verweigerten ihm die Inselbewohner die Unterstützung. Nicht einmal seine Gesandten durften den Hafen anlaufen. Da beging Pompeius den wohl entscheidendsten Fehler seines Lebens: Er wandte sich hilfesuchend an den Partherkönig. Der römische Erzfeind aber weigerte sich ebenfalls, einem Römer zu helfen. Warum auch? Seit Menschengedenken bekriegten sich die beiden Völker, waren auch auf Seiten der Parther Ströme von Blut in den jahrhundertelangen Auseinandersetzungen vergossen worden. Dass sich der große Pompeius ausgerechnet an die Rom so verhassten Parther wandte, mag nicht nur diese verwundert haben. Es brachte auch viele seiner Landsleute gegen ihn auf. Spätestens jetzt liefen die meisten, die ihm bis hierher noch die Treue gehalten hatten, zum Feind über.
Aber der große Römer dachte noch immer nicht daran, den Kampf aufzugeben und sich Caesar zu unterwerfen, solange noch ein winziger Funken Hoffnung bestand. War er es nicht seiner Ehre schuldig, sich bis zum letzten Blutstropfen für die Sache Roms einzusetzen? Ägypten kam ihm in den Sinn, eine letzte Zuflucht, von der aus sich die Rückkehr nach Rom und an die Macht noch am ehesten organisieren ließe. Hatte er nicht ohnehin bei den ägyptischen Herrschern etwas gut? Verdankten die Ptolemäer nicht ihm, dass sie wieder auf dem Thron saßen, von dem Ptolemaios XII. vor einigen Jahren verjagt worden war? Er gedachte, in Pelusion an Land zu gehen, im östlichen Teil des alten Reiches am Nil.
Inzwischen hatten sich auch die Berater des ägyptischen Königs Gedanken gemacht. Womöglich, so überlegten sie, beabsichtigte der unberechenbare Römer, das Heer aufzuwiegeln und zu versuchen, Ägypten unter seine Kontrolle zu bringen. Damit aber war Pompeius’ Todesurteil besiegelt.
Draußen auf der ruhigen See ankerte seine kleine Flotte. Seit geraumer Zeit kreuzten bemannte ägyptische Schiffe vor dem Hafen, und am Ufer sammelte sich bewaffnetes Fußvolk. Dies war keineswegs die Art, einen hohen Gast zu empfangen. Er ahnte, was diese verschlagenen Ägypter vorhatten. Und als ihn die Besatzung eines kleinen Bootes nötigte, sein Schiff zu verlassen und in ihr schwankendes Gefährt umzusteigen, schloss er mit dem Leben ab. Stöhnend fügte er sich in sein Schicksal, als ihn das Schwert eines Besatzungsmitglieds traf, und zog sterbend die Toga über sein Haupt. Der Leiche schlugen die Mörder den Kopf ab und warfen sie ins Meer. Ein Freigelassener namens Philippus erbarmte sich seines Herrn. Er zog den kopflosen Toten ans Ufer, wusch den Leichnam und errichtete aus dem Holz gestrandeter Schiffe einen Scheiterhaufen.
Mit Entsetzen hatten Pompeius’ Gattin Cornelia und sein Sohn Sextus das Geschehen verfolgt und erkannt, dass Pompeius Magnus nicht mehr zu helfen und jeder Widerstand wegen der Überzahl der Mörder zwecklos war. Sofort ließen sie die Anker lichten und suchten ihr Heil auf dem offenen Meer. Doch einige von Pompeius’ Schiffen, die sich den Fliehenden angeschlossen hatten, wurden von den ägyptischen Galeeren eingeholt. Besatzung und Passagiere fanden einen unrühmlichen Tod.
Stolz sahen die Ägypter nun der nahen Zukunft entgegen. Caesar, der bereits unterwegs war, wie man hörte, würde sie sicherlich reich belohnen. Doch als man ihm in einem Korb das abgeschlagene Haupt seines großen Widersachers brachte, wandte er sich mit tränenden Augen ab. Man hatte ihm mit der voreiligen Tötung dieses Mannes keinen Gefallen getan. Im Gegenteil. War ihm doch damit die Möglichkeit genommen worden, von seiner längst sprichwörtlichen Milde Gebrauch zu machen. Zudem waren Pompeius und er einst Freunde, Pompeius sogar eine Zeitlang sein Schwiegersohn gewesen. Ein solches Ende hatte niemand, auch er, nicht verdient.
War Caesar bewusst, dass auch seine Tage gezählt waren? Angst lähmte die siebenhügelige Stadt. Menschenleer dehnte sich das Forum selbst in den mittäglichen Stunden. Schon lange verunsicherten vermummte Gestalten und zweifelhaftes Gelichter die Straßen. Ein Ausgeraubter hier, ein Erschlagener dort. Hilferufe, die ungehört in der Dunkelheit verhallten. Grässlich entstellte Leichen, nachts im Tiber treibend, gesichts- oder kopflos, das Gedärm nach außen gekehrt. Köpfe, die tränenlos und unbewimpert von den Gemonien rollten. Schnödes Verbrechen blieb ungesühnt.
Unheimliches Flüstern auch in Caesars Palast. Freilich nur hinter vorgehaltener Hand. „Weißt du es schon? Hast du es auch gehört?“ Unglaubliche Geschichten waren zu vernehmen, die auf die Bürger Roms ein bezeichnendes Licht warfen. Da wurde, so erzählte man, in Etrurien ein Kalb mit drei Köpfen geboren. Hafer wuchs dort aus den Kronen der Bäume. Man sprach von einer Schlange, die sich von Schwanz her selbst verzehrte. Das schlimmste Vorzeichen aber meldete Capua, das südlich von Rom lag. Dort waren Siedler beim Bau ihrer Hütten auf uralte Gräber gestoßen. In einem fand sich eine eherne Tafel. In den gestelzten Lettern einer uralten Schrift stand darauf geschrieben:
„Unbekannter, der du die Gebeine des Capys entdeckest,
melde in Rom, ein Enkel des sagenumwobenen Gründers
werde dort durch verwandte Hand heimtückisch fallen.
Dies aber werde Italien mit großer Heimsuchung büßen.“
Rom wäre nicht Rom gewesen, hätte es auf solche Vorzeichen nichts gegeben. Nur Caesar achtete auf diese Warnungen nicht. „Hüte dich vor den Iden des März!“, hatte ihm erst kürzlich Spurinna, der alte Seher, der blind war und doch mehr als andere sah, im Senat zugerufen. Aber der heimliche König Roms, der zum Diktator auf Lebenszeit ernannt worden war, hatte darüber nur gelacht. Er meinte, es liege im Interesse des Staates, dass er am Leben bleibe. Denn wenn ihm etwas zustieße, würde das Rom in noch heftigere Bürgerkriege stürzen. Schon die nahe Zukunft lehrte, dass er Recht behalten sollte.
Dann kamen jene Iden, vor denen Spurinna gewarnt hatte. Nach anfänglichem Zögern – Caesars Frau Calpurnia hatten in der Nacht schlechte Träume geplagt, und sie hatte den Gatten tränenreich beschworen, heute nicht in den Senat zu gehen – ließ sich dieser von Decimus, einem der Verschwörer, überreden, doch vor die versammelten Väter zu treten, die ihn an diesem Tag ungewöhnlich freundlich empfingen. Sie geleiteten den Ahnungslosen sogar an seinen Platz. Dann aber stürzten sie sich auf den völlig überraschten Mann, und 23 Dolchstöße streckten ihn nieder. Doch nur ein einziger, so sollten die Ärzte später verkünden, sei tödlich gewesen …
Hatten die Verschwörer nicht richtig gehandelt? Hatte sich Caesar nicht erst neulich mit der Hand an die Stirn gegriffen, als trüge er bereits das Königsdiadem? Jedermann wusste, dass dieser Caesar nach der Alleinherrschaft strebte, und erst kürzlich waren Gerüchte gestreut worden, die Parther, Roms hartnäckigste Feinde, könnten nach alter Vorhersage nur von einem König dauerhaft besiegt werden. Doch niemals, so hatte man sich vor fast fünf Jahrhunderten geschworen, dürfe die Verantwortung für Rom und sein Imperium wieder an einen Einzelnen übergehen. Nur die Ältesten und Besten sollten die Macht ausüben. Der Bürgerkrieg, der nun zwischen Befürwortern des Attentats und denen, die die Tat verabscheuten und den Ermordeten zu rächen versprachen, ausbrach, schwächte ganz Rom und fand im griechischen Philippi ein vorläufiges Ende, als die Caesar-Mörder geschlagen und tot waren. „Vor Philippi sehen wir uns wieder“, hatte Caesar kurz vor seinem Fall orakelt und auch die Bürgerkriege hatte er zutreffend vorausgesagt. Doch war das unsinnige Blutvergießen damit noch lange nicht zu Ende. Denn jetzt begann der kaum weniger grausame Kampf zwischen Octavian und Marcus Antonius um die Vorherrschaft im Römischen Reich.
Niemand konnte verstehen, weshalb Gaius Iulius Caesar seinen Großneffen Octavian, einen blassen Jüngling von 18 Jahren, an Sohnes statt angenommen und zum Alleinerben seines Vermögens und Vollender seiner Politik bestimmt hatte. Jedermann hatte erwartet, Marcus Antonius wäre berufen, das schwierige Erbe anzutreten. Er galt als Caesars bester Freund und hatte mit ihm zahlreiche Schlachten geschlagen. Am meisten war wohl Marcus Antonius selbst über die Entscheidung erstaunt. Aber er ließ sich nichts anmerken und versuchte, sich mit dem Erben zu arrangieren. Und doch erkannten beide, dass selbst ein Imperium Romanum für zwei, die die Macht beanspruchten, nicht groß genug war.
Die Geschichte von Caesar und Pompeius schien sich zu wiederholen. Nur unterschwellig war zunächst die Gegnerschaft. Bündnisse wurden geschlossen, Freundschaftsbekundungen ausgetauscht. Hatte Caesar einst seine Tochter Gnaeus Pompeius zur Frau gegeben, so verpflichtete jetzt Octavian seine Schwester Octavia, Marcus Antonius zu heiraten. Sie war erst vor kurzem Witwe geworden und an einer raschen Wiederverheiratung eigentlich nicht interessiert. Aber der Bruder erinnerte sie an ihre Pflicht als Römerin, und ihr wurde gestattet, die neue Verbindung sogar vor Ablauf des in Rom üblichen Trauerjahres einzugehen. Octavia verkörperte in den Augen der Römer die Tugenden der römischen Matrone schlechthin. Untadelig war ihr Auftreten. Sie galt als sanft, zurückhaltend, gehorsam und von ausgleichendem Wesen. Jedermann bewunderte die zarte, für eine Römerin äußerst gebildete Frau, die alles, was man ihr aufbürdete, schweigend ertrug. Marcus Antonius war neugierig geworden.
Niemand nahm darauf Rücksicht, dass Antonius, dem, wie bereits erwähnt, durch den Triumvirats-Vertrag der Osten des Reiches zugefallen war, schicksalhaft an Kleopatra gebunden war, die Königin Ägyptens. Auch der erwählte Bräutigam sah nicht voraus, dass die Euphorie einer neuen Ehe – seine Gattin Fulvia war gestorben – nicht von Dauer sein würde. Die Ägypterin übte auf ihn eine fast magische Anziehungskraft aus, und es sollte sich bald zeigen, dass er außer Stande war, sich dieser dauerhaft zu entziehen. Die Zuneigung, die er dieser aufregenden Frau entgegenbrachte, gründete nicht nur auf Überlegungen politischer Art, mochte man auch munkeln, er beabsichtige, sich von Rom abzuwenden und mit der Königin Ägyptens ein selbstständiges Ostreich zu errichten. Auch als Mann war er ihr verfallen. Welche Mittel mochte diese Frau anwenden, dass der an sich rechtschaffene Römer ihr hörig war?
Nur zwei Jahre nach der spektakulären Hochzeit mit Octavia, die im Auftrag von deren Bruder wie ein Staatsakt gefeiert worden war, entfremdete sich Antonius seiner Frau und kehrte reumütig in Kleopatras Bett zurück. Es hatte sich gezeigt, dass auch die familiäre Bindung die beiden Rivalen ihre Gegnerschaft nicht überwinden ließ, ja, sich die Beziehung immer mehr zu offener Feindschaft wandelte.
Als Tiberius Claudius Nero in das Haus seines Stiefvaters kam – nach unserer Zeitrechnung im Jahr 34 v. Chr. –, war die Propaganda gegen Antonius bereits voll im Gange. Es war längst offensichtlich, dass Octavian, der im Westen des Reiches und damit in der Hauptstadt selbst das Sagen hatte, die Alleinherrschaft über das gesamte Reich anstrebte. Er ließ nichts unversucht, seinen Gegner in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, bezeichnete ihn als unrömisch und entartet, verstrickt in den Fängen einer exotischen Hexe. So überzeugend wirkten seine gegen Marcus Antonius gezielten vergifteten Pfeile, dass das Volk immer mehr von dessen Schuld überzeugt war.
Tiberius, der, weit über sein Alter hinaus, schon als Kind am politischen Geschehen interessiert war, mag die Entwicklung aufmerksam verfolgt haben. Vielleicht war auch ihm bewusst, dass so viel Hass wieder nur da enden konnte, wo Rom bis vor kurzem noch gestanden hatte: in einem neuen Bürgerkrieg.
Möglicherweise waren es die Erfahrungen des Heranwachsenden, die den späteren Herrscher veranlassten, von kriegerischen Unternehmungen abzusehen, wenn es denn möglich war. Er hatte, anders als sein Vorgänger, nicht den Ehrgeiz, Roms Einflussbereich in der Welt noch zu steigern. Von Eroberungszügen und einem Versuch, Rom bis an die Elbe auszudehnen, ist für seine Regierungszeit nichts bekannt.
Jetzt war Tiberius neun Jahre alt und lebte mit der von ihm misstrauisch beäugten Mutter im Haus seines Stiefvaters. Immer wichtiger wurde die dem römischen Hochadel entstammende Frau für den Aufsteiger, dessen Vorfahren noch aus der Unterstadt gekommen waren. Durch ihre vornehme Herkunft öffnete sie ihm die Türen zu den höchsten Kreisen Roms, ohne deren Einfluss dort niemand zu Macht und Ansehen gelangen konnte. Im Gegenzug schätzte sie Octavians Möglichkeiten und Ehrgeiz richtig ein. Nur über ihn, der frischen Wind in die Politik brachte, würde es ihr gelingen, ihren eigenen Machthunger zu stillen.
Allenthalben war nun vom bösen Antonius die Rede – und von Kleopatra, die es beide zu bekämpfen galt. Beleidigungen und Beschimpfungen, die zwischen Rom und Alexandria hin- und hergingen, forderten schließlich die Entscheidung mit Waffen heraus. Und die ließ nicht lange auf sich warten.