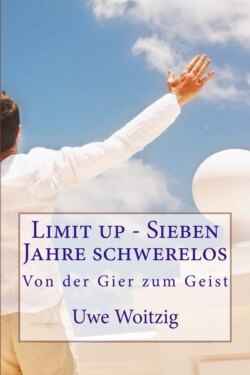Читать книгу Limit up - Sieben Jahre schwerelos - Uwe Woitzig - Страница 10
Kapitel 7
ОглавлениеWer den Fluss der Natur in sich aufnimmt,
hat damit liebevoll schon für alles gesorgt.
Tao Te King
Die Zeit war reif. Nach den fast zehn Jahren, in denen ich mein Geld an den amerikanischen Börsen verdiente und eigene Büros in New York, Chicago, München, Monte Carlo und Athen besaß, hatte ich die Schnauze voll. Tag für Tag investierten meine Börsenmakler Hunderte von Millionen in Wertpapiere und Derivate. Bei jedem Einstieg in einen Börsenwert hofften wir mit flatternden Nerven, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt hatten. Ständig standen wir unter Erfolgszwang. Wir spekulierten schließlich mit dem uns anvertrauten Geld unserer Kunden, die jeden Monat einen kräftigen Zuwachs in den bei uns geführten Konten erwarteten. Blieb er aus, würden sie ihr Geld sofort abziehen. Mein Leben bestand nur aus Druck. Es orientierte sich ausschließlich an der Erwartungshaltung anderer, deren Vorgaben auf höchstem Niveau ich zu erfüllen hatte. Das führte zu einem Magengeschwür und meine Psyche fing an, verrückt zu spielen. Jede Woche saß ich in einem Flugzeug, kreuz und quer um die Welt. Irgendwann wachte ich in einem Hotel auf und wusste nicht mehr, in welcher Stadt ich war. Meine Seele kam einfach nicht mehr mit, wie die Indianer sagen. Meinem Partner ging es ähnlich.
Als er eines Tages wegen einer üblen Erpressung seine Geschäftsanteile an unseren Firmen verpfänden musste, zogen wir die Reißleine. Wir ließen unser mühsam aufgebautes Imperium zusammenbrechen, setzten uns in einen Flieger und flogen in ein neues Leben. Bevor ich dort ankam, musste ich in den Knast, der mich wie eine Zentrifugalschleuder in meine Einzelteile zerlegte und wieder neu zusammensetzte.
*
Die Haftzeit rettete mir das Leben und ließ mich eine radikale Veränderung meiner bisherigen Sichtweisen vornehmen. Vor allem begriff ich während meiner Inhaftierung, dass die Freiheit, die ich mein Leben lang gesucht hatte, nicht mit Geld zu erlangen ist (siehe mein Buch „Hofgang im Handstand“).
Nach meiner Entlassung zog ich mich mit meiner zweiten Frau Maria in das schönste, von einer begnadeten Innenarchitektin perfekt und stimmig umgebaute Bergbauernhaus Oberbayerns zurück. Dennoch scheiterte unsere Ehe nach sieben Jahren, weil ich die uralte Erkenntnis übersah, dass die erfolgreichsten Liebenden der Welt diejenigen sind, die niemals zusammenleben. Sie kommen sich nie so nahe, dass sie sich erkennen und begreifen müssen, dass sie nicht füreinander geschaffen sind. Unglücklicherweise war ich wie die meisten Liebenden erneut eine Ehe eingegangen, was die größte Tragödie im Leben ist.
Vergeblich versuchte ich, meine im Knast gewonnenen Erkenntnisse mit der Realität des Alltags in Einklang zu bringen. Nach meinen fast 10 Jahren unter den Schönen und Reichen, den Mächtigen und Prominenten dieser Welt und den anschließenden 2 ½ Jahren im Knast, die ich Wand an Wand und Angesicht zu Angesicht täglich mit Gesetzlosen und von der Gesellschaft Ausgestoßenen und Verachteten gelebt hatte, wollte ich weg von den Menschen und mein Leben in Abgeschiedenheit und Frieden verbringen. Tatsächlich hatte ich es scheinbar geschafft. Ich lebte in einem idyllischen, wunderschön restaurierten Bergbauerhof auf 1200 Meter Höhe in den Alpen, an meiner Seite eine der schönsten Frauen Münchens, für die ich jahrelang geschwärmt hatte. Und die Hauseigentümerin und unsere einzige Mitbewohnerin Anja war nicht nur eine gute Freundin geworden, sondern auch noch eine perfekte Innenarchitektin und Köchin.
Dank ihrer Aufträge vom Saudi-arabischen Königshaus zur Einrichtung seiner diversen Paläste waren bei uns regelmäßig Mitglieder der Regierung und des Könighauses zu Gast.
Wir führten an unserem von Maria und Anja liebevoll dekorierten Tisch bei erlesenen Gerichten auf unserer Terrasse höchst interessante Gespräche über die Weltpolitik. Besonders über die Abhängigkeit der Saudis von den Amerikanern und dem Einfluss der Bilderberger und anderer Logen in dem Land. Lustig fand ich, dass eines Abends der saudische Minister for Development mein Faxgerät benutzte, um einen von ihm unterschriebenen Vertrag über ein Milliardenprojekt in sein Büro in Riad zu faxen. Vor der Tür stand mein ansehnlicher Fuhrpark und ich hatte genug Kohle, um sorgenfrei zu leben. Doch trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, erneut gescheitert zu sein.
Als ich aus dem Knast entlassen wurde, war ich im Sinne William Saroyans Roman ´Die menschliche Komödie´ voller Lebensoptimismus - full of optimism of life. Mein verloren gegangenes Vertrauen und meine Zuneigung zu meinen Mitmenschen waren zurückgekehrt. Ich trug eine rosa gefärbte Brille und übersah, dass Maria krass gesagt „beschädigte Ware“ war.
Sie war in ihrem Innern wie schockgefroren. Mit ihren tief sitzenden Ängsten vor dem Leben hatte sie pausenlos Elementale erzeugt, die alles daran setzten, diese Realität werden zu lassen. Sie waren sehr erfolgreich gewesen. Maria war vollkommen beherrscht von diesen selbst erzeugten Phantomen der Furcht. Völlig unfähig, in irgendetwas oder irgendjemandem noch etwas Positives zu sehen oder sich gar daran zu erfreuen, erwartete sie jeden Moment die nächste Katastrophe. Und genau diese schwer belastete Frau wurde mir zur Prüfung meiner angeblich erreichten Bewusstseinsstufe vom Universum zugespielt. Natürlich war ich noch längst nicht da, wo ich mich wähnte. Und fiel mit Pauken und Trompeten durch.
Dabei fing alles so gut an. Allein, wie wir diesen einmaligen Platz zum Leben gefunden hatten. Während meiner Haft hatte ich in einem „GEO“ gelesen, dass die ideale Lebenshöhe für den Menschen auf 1200 m liegt. An einem Wochenende, an dem ich Hafturlaub hatte, war ich deswegen mit Maria nach Garmisch gefahren, um mir die Berge aus der Nähe anzuschauen. Wir fuhren weiter Richtung Mittenwald, als ich plötzlich eine kleine Straße von der Bundesstraße abzweigen sah, die offensichtlich bergauf führte.
Ich liebe Nebenstrecken, also bog ich ohne zu zögern ab. Es ging anfangs noch auf geteertem Grund bergauf, dann aber wurde es staubig und steinig. Maria sah mich von der Seite mit diesem „Was-soll-das-denn-jetzt?“ – Blick an, aber ich ließ mich nicht beirren. Meine innere Stimme sagte mir, fahr weiter.
Wir erreichten ein kleines Plateau, auf dem drei Häuser standen. Eins entpuppte sich als ein bewirtschaftetes Gasthaus, eine Alm, wie die Bayern sagen. Daneben stand ein ganz gewöhnliches Wohnhaus im Jodlerstil.
Der Hammer aber war das anscheinend uralte Holzhaus, das perfekt renoviert zu sein schien und um das herum liebevoll platzierte Details den auserlesenen Geschmack der Besitzer verrieten.
Besonders ein mit Rosenstöcken bewachsener Pavillon fiel mir ins Auge, der neben einer mit Holzdielen ausgelegten Terrasse stand, auf der teure Teakholzmöbel verrieten, dass hier auch Geld vorhanden war. Das für mich Beeindruckendste war jedoch der Ausblick auf das höchste Kirchendorf Deutschlands auf der anderen Seite des Tales, hinter dem sich das Wendelsteinmassiv erhob, überragt von der Zugspitze.
Wir ließen uns auf einer Almwiese unterhalb dieses Traumanwesens nieder und ich öffnete eine mitgebrachte Flasche Champagner.
„Das wäre doch was, in dem Haus zu wohnen und mit diesem Blick jeden Morgen aufzuwachen, findest nicht?“ fragte ich Maria und prostete ihr zu.
Maria, die einen Großteil ihres Lebens in Sylt und St. Moritz an den Bars der In-Discos und - Clubs gearbeitet hatte und den Trubel und das turbulente Leben in der Stadt liebte, sah mich misstrauisch an. Aber dann hakte sie den Satz als eine für einen Mann übliche Spinnerei ab und zuckte die Achseln. Sie hatte allerdings keine Ahnung, wozu ich fähig war. Ich hatte einen Wunsch an das Universum gesandt und zu jener Zeit hatte ich noch den direkten Draht.
Kurz vor Weihnachten kam ich auf die Idee, meinen Weihnachtsurlaub mit Maria in Garmisch zu verleben. Deshalb bat ich einen Mithäftling, der aus Garmisch stammte, mir einen Prospekt von Ferienwohnungen mitzubringen, von denen ich eine für die Feiertage mieten wollte.
Tatsächlich brachte er mir eine Broschüre mit. Mir fielen vor Überraschung die Augen aus dem Kopf, als ich sie öffnete: Ich sah ein Bild dieses wunderschönen alten Bauernhauses. Und es gab darin eine Ferienwohnung, die hier angeboten wurde. Der Preis war astronomisch, aber das war mir egal. Ich schrieb Maria, sie solle unbedingt dort anrufen und die Wohnung buchen. Und nachfragen, ob wir sie eventuell für länger mieten könnten.
Wenige Tage später besuchte sie mich und erzählte mir ganz aufgeregt, dass die Eigentümerin des Hauses eine enge Freundin ihres Chefs sei. Sie habe schon am Telefon gemerkt, dass sie sich hervorragend verstehen würden. Daraufhin sei sie nach Garmisch gefahren und habe sich mit ihr getroffen. Sie seien zu dem Haus gefahren und es sei innen noch schöner als von außen.
„Und“, fragte ich sie aufgeregt, „können wir die Wohnung haben?“
Sie fiel mir um den Hals.
„Ja, sie gibt sie uns. Aber sie kostet …“, und sie nannte einen Preis, für den ich eine Villa in Grünwald, dem Nobelviertel im Speckgürtel Münchens, hätte mieten können.
„So what“, dachte ich. „Dafür sparst du viel Geld, weil du die Ebene des sogenannten Jetsets verlassen hast und gegen wirkliche Lebensqualität eintauscht. Irgendwie sehr interessant, dass du für ein Leben in einem Bergbauernhof genauso viel zahlst wie für eine Villa in München.“
„Macht nichts, miete sie“, sagte ich zu Maria.
„Was ist mit meinem Job? Wenn wir dort leben, kann ich unmöglich weiter arbeiten.“
„Den gibst du selbstverständlich auf. Ich glaube, wir haben uns beide eine Auszeit verdient, meinst du nicht?“
Maria sah mich nachdenklich an. Dann nickte sie zögernd.
„Also gut. Ich werde die Wohnung mieten und meinen Job aufgeben.“
Spontan nahm ich sie in den Arm. Ich dachte nicht weiter darüber nach, dass sie gerade eine Entscheidung getroffen hatte, die ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellte. Naiv dachte ich, dass ich endlich meine „Elaine Robinson“ gefunden hatte, die die Kirche mit mir verlässt und mit dem Bus davon fährt. Ich hatte keine Ahnung, dass Maria einfach die Schnauze voll hatte und keine Perspektive mehr in ihrem Job an der Bar des besten Feinkosthauses in München sah.
Sie war sehr früh von Zuhause weggegangen und hatte sich alleine durchs Leben gekämpft. Dabei hatte ihr ihre fast übernatürliche Schönheit viele Türen geöffnet, aber sie hatte niemals daraus Kapital geschlagen. In jener Zeit, in der sie als Bardame in Gunter Sachs´ „Dracula Club“ in Sankt Moritz arbeitete, hatten sie zahllose sehr reiche Männer umschwirrt wie die Motten das Licht. Sie hatte jedoch stets zugunsten von armen Schluckern verzichtet, weil sie sich vor den erfolgreichen, selbstbewussten Männern fürchtete. Ihr Ziel war es gewesen, eines Tages genau an der kleinen, aber feinen Bar des Feinkosthauses zu arbeiten.
Das war ihr gelungen, obwohl sie den etwas zwielichtigen Ruf einer Nacht-Bardame hatte. Der Chef des Hauses war von ihr begeistert gewesen, als er sie kennenlernte, und hatte sie trotz der Bedenken seiner Geschäftsführer eingestellt. Da Maria eine ungeheure Erfahrung, Kompetenz und Souveränität im Umgang mit Menschen hatte, wurde die Bar ein echter Renner. Doch diese Fähigkeiten waren wie weggeblasen, wenn sie nicht die sichere Barriere des Tresens vor sich hatte, der ihr wie eine Zugbrücke Schutz vor der Nähe zu ihren Gästen bot. Sie war eine Frau, die diesen Schutz, zu dem auch ihre absolute finanzielle Unabhängigkeit gehörte, brauchte wie die Luft zum Atmen.
Genau die warf sie gerade über Bord – und ich merkte es nicht. Für mich war es vollkommen normal, dass meine Frau nicht arbeitete. Wozu sollte sie? Ich war jederzeit in der Lage, ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen, das für ein luxuriöses Leben zu zweit ausreichte. Außerdem hatte ich ausreichend Reserven.
Aber ich hatte noch nie von Otto Mainzer und seinen Thesen über die „sexuelle Zwangswirtschaft“ gehört und keine Ahnung, dass eine solche Basis das Ende jeder Lust, Leidenschaft und Liebe bedeutet.
„Wunderbar, dann werden wir deine Wohnung in München vermieten“, sagte ich leichthin.
Sie sah mich mit ihren schönen braungrünen Augen undurchdringlich an.
„Wie du meinst.“
„Und einen Mieter habe ich auch schon: Meinen Freund Gus“, fuhr ich fort. „Er sucht eine Wohnung.“
Maria nickte langsam.
„Gute Idee“, sagte sie mit leiser Stimme.
Ich verstand nicht, dass ich von ihr verlangte, nicht nur ihr bisheriges Leben substanziell zu verändern, ihre sämtlichen mühsam aufgebauten Schutzzonen und sogar ihre geliebte Insel am Viktualienmarkt aufzugeben und sich mir auf Gedeih und Verderb auszuliefern. Wenn ich aus heutiger Sicht über ihre Persönlichkeit nachdenke, ist es unfassbar, dass sie damals einwilligte.
Maria verweigerte nämlich jede Weiterbildung, alles Neue war ihr suspekt. Mein Lebensstil eines Studenten auf hohem Niveau war ihr fremd. Ich ging spät zu Bett, schlief lange und hatte ständig neue Ideen, wie man den Tag verbringen könnte. Permanent zerstörte ich ihre selbst erzeugte tägliche Routine. Ohne diese war sie aber verloren. Sie wurde aggressiv und war keinen Argumenten mehr zugänglich. Maria hatte sich als eine Reinlichkeitsfanatikerin entpuppt, die täglich wie ein Derwisch durchs sowieso sehr saubere Haus fegte und mehrere Stunden mit Putzen verbrachte.
Das hatte den Vorteil, dass ich in Ruhe Lesen und Meditieren konnte. Der Nachteil war, dass sie nicht zu bewegen war, das Haus zu verlassen, bevor nicht alles „in Ordnung“ war. Da sie auch dank der Inspiration durch Anja eine sensationelle Köchin war und mir täglich die besten und ausgefallensten Mahlzeiten kochte, war auch das zu verschmerzen. Nicht zu ertragen war allerdings ihre Unlust, zu reisen oder sich kulturell zu betätigen.
Ich bin auch nicht gerade der große Theaterfreak, aber ab und an eine gute Aufführung ist eine ebenso willkommene Abwechslung für meinen danach dürstenden Geist wie eine Städtereise am Wochenende. An Marias Seite darbte er.
Außerdem war ich ungeheuer verwöhnt durch den täglichen Umgang mit teilweise blitzgescheiten Ganoven. Mir fehlten der witzige Schlagabtausch, das Lachen und der Esprit dieser Männer. Am meisten aber sehnte ich mich nach der Intensität des Seins im Knast, so dass sich in mir eine völlig ungewöhnte Unruhe bemerkbar machte, die ich durch ausgedehnte Bergwanderungen vergeblich zu kompensieren versuchte.
Doch es gab immer wieder Highlights, nach denen sich ein „Normalsterblicher“ die Finger geleckt hätte. Zum Beispiel unsere ersten Weihnachten in dem Bergbauernhof. Anja war eng befreundet mit Marias ehemaligem Chef, dem Inhaber des berühmtesten Münchner Feinkosthauses. Deshalb erlaubte sie ihm, für seine besten Kunden eine Weihnachtsfeier in ihrem Wohnzimmer zu arrangieren, das wegen seiner exklusiven, aber dennoch urgemütlichen Einrichtung regelmäßig in allen Einrichtungsjournalen der Welt abgebildet wurde.
Der Feinkostkönig rückte mit einer Brigade an, die neben dem Haus ein Zelt mit einer kompletten Küche aufstellte. Die auserwählten Gäste fuhren mit dem gläsernen Zug von München nach Garmisch, wurden am Bahnhof mit Pferdeschlitten abgeholt und zu uns hochgefahren. Dort hatten sich inzwischen Alphornbläser in ihrer Werdenfelser Tracht zu ihrem Empfang aufgestellt. Während unten im Wohnzimmer die Gäste in bester Stimmung am Tisch tafelten, lagen wir oben gemütlich im Bett, an das uns ein Kellner die im Zelt frisch zubereiteten Gänge des feinen Menüs inklusive der Getränke brachte, und draußen die Alphornbläser weihnachtliche Weisen bliesen.
Während ich diese einmalige Situation und Stimmung aus vollem Herzen genoss, konnte Maria nicht damit umgehen, dass ich sie gebeten hatte, im Bad zu verschwinden, während der Kellner uns die Teller im Bett arrangierte. Da sie jahrelang für dieses Feinkosthaus gearbeitet hatte, kannte sie jeder Mitarbeiter. Ich wollte vermeiden, dass man sie erkannte und wir schon wieder in den Schlagzeilen des Münchner Boulevards auftauchen würden.
Nicht nur deswegen maulte sie die ganze Zeit und nörgelte herum. Ich vermutete, dass ihr gerade bewusst geworden war, wen sie da geheiratet hatte. Und dass sie statt mit mir im Bett zu liegen, viel lieber bei ihren ehemaligen Kollegen gewesen wäre und beim Service mitgeholfen hätte. Nicht zum ersten Mal fing ich an zu zweifeln, ob es wirklich so klug gewesen war, sie zu heiraten.
Dieser Gedanke vertiefte sich, als ich erlebte, wie sie Auto fuhr. Nach etwa sechzig Fahrstunden, drei nervlich verschlissenen Fahrlehrern und zwei leichten Blechschäden hatte sie endlich ihre Führerscheinprüfung bestanden.
Um sie ans Fahren zu gewöhnen, bot ich ihr an, sich entweder den Jaguar, den Range Rover oder den Porsche für eine erste Fahrt auszuwählen. Sie entschied sich für den Porsche, weil er der kleinste war. Dasss er der PS-Stärkste und eine echte Rakete war, übersah sie geflissentlich. Ich unterließ es, sie darauf hinzuweisen, fuhr selbst den Berg hinunter und auf einem Parkplatz neben der breiten Bundesstraße nach Mittenwald ließ ich sie ans Steuer. Wie sie es gelernt hatte, justierte sie sorgfältig den Sitz und den Außenspiegel, startete den Motor und fuhr los, als weit und breit kein anderes Auto zu sehen war. Schon nach wenigen Sekunden erreichten wir die Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h. Ich sagte nichts und ließ sie gewähren. Aber als sich nach einigen Kilometern hinter uns eine lange Schlange bildete, riet ich ihr sanft, sie möge doch bitte etwas beschleunigen. Ein Porsche, der auf einer völlig freien Landstraße mit 40 km/h dahin schleicht, sei etwas merkwürdig. Vorsichtig gab sie Gas. Die 328 PS ließen den Wagen davon schießen wie eine Rakete. Entsetzt trat sie voll in die Bremsen, stellte den Porsche quer und würgte den Motor ab. Ich knallte gegen die Windschutzscheibe. Selbstverständlich schnalle ich mich niemals an, wegen der Freiheit und so. Leicht gereizt rieb ich mir meine schmerzende Stirn, an der sich eine nicht unbeträchtliche Beule gebildet hatte.
Wir blockierten beide Spuren der Fahrbahn. Ich riet ihr, den Gang herauszunehmen und erneut zu starten. Die anderen Verkehrsteilnehmer sind nicht besonders tolerant, wenn am Steuer eines Porsches ein absoluter Anfänger sitzt, der auch noch eine bildschöne Blondine ist. Die ersten Hupen ertönten. Maria wurde nervös und meinte, ich solle das Steuer übernehmen.
„Ich denke nicht daran. Du sollst fahren lernen, darum geht es.“
Ihr Blick verriet aufsteigende Panik. Und aufsteigenden Hass. Nach einigen Fehlversuchen gelang es ihr, den Motor zu starten, den Wagen gerade zu stellen und los zu fahren. Mit 30 km/h. Die Fahrer hinter uns konnten nicht überholen, weil sich auch auf der Gegenfahrbahn wegen unseres Querstellens und Marias Rangierens eine lange Schlange gebildet hatte. Ein ohrenbetäubendes Hupkonzert setzte ein. Mir wurde es zu bunt. Ich beugte mich zu ihr hinüber und drückte ihr Knie nach unten. Ihr Fuß wurde aufs Gaspedal gepresst und der Porsche raste los. Sie wurde leichenblass und schrie: „Mit dir fahre ich nie wieder.“
Ich hielt ihr Knie eisern fest und zwang sie, 100 km/h zu fahren. Auf schnurgerader, freier Strecke. Sie fing an, mich aufs Übelste zu beschimpfen.
„Wenn du bremst, fliegst du von der Straße“, sagte ich ruhig.
Sie war so voller Panik, dass sie mir glaubte. Verkrampft hielt sie sich am Lenkrad fest. Ohne Probleme schaffte sie es bis zum nächsten Parkplatz. Dort ließ ich sie von der Straße abbiegen. Ich beugte mich zu ihr rüber und gab ihr einen sanften Kuss, weil ich sie belohnen wollte, dass sie acht Kilometer unfallfrei gefahren war. Aber sie war völlig außer sich, sprang aus dem Auto und schluchzte hemmungslos.
In diesem Moment wurde mir klar, dass unsere Ehe nicht gut gehen würde. Der Knast hatte mich zu sehr romantisiert und meine Schärfe der Wahrnehmung getrübt. Ich war täglich mit der Aufrichtigkeit und Authentizität meiner Knastbrüder konfrontiert gewesen und musste mich erst wieder an die verlogenen Spiele und dem hinter dem Berg Halten der Menschen hier „draußen“ gewöhnen. Wie konnte es mir sonst entgangen sein, dass Maria ihr Leben in ganz engen Bahnen gelebt hatte? Ich hatte mir eingebildet, so was wie eine feine Version der völlig durch geknallten Uschi Obermeier, der Ikone der 68er, erwischt zu haben. Stattdessen hatte ich eine kleinbürgerlich denkende, angstbesetzte Persönlichkeit geheiratet, der Sicherheit und Ordnung über alles ging. Die jedes Risiko und jede neue Erfahrung scheute wie der Teufel das Weihwasser.
Endgültig warf ich meine Theorie über Bord, dass eine schöne Frau auch innerlich makellos sein muss. Wie innen so außen passte einfach nicht bei Frauen. Sokrates hatte sich geirrt mit seiner Theorie der Verbindung von Schönheit und dem Guten. Dieses Häufchen Elend am Straßenrand war von meinem Ideal einer ebenbürtigen Partnerin Lichtjahre entfernt. Völlig unbrauchbar für mein wildes Leben, in dem es mir letztendlich darum ging, mein wahres Selbst im Sinne des delphischen Orakels kennenzulernen. Indem ich nicht nur meditieren, sondern auch in den Extremen des Seins meine Belastbarkeit und meine Grenzen erfahren wollte. Aber konnte ich das überhaupt jemanden an meiner Seite zumuten? Sagen nicht alle Erleuchteten, dass man den letzten Teil des Weges zur Selbsterkenntnis alleine beschreiten muss? Gehe in die Wälder oder Berge und lass alles hinter dir? Ohne Frau oder sonstige Bindungen?
Der in mir wohnende alte Löwe hob sein kluges Haupt und besänftigte mich.
„Hast du nicht gelernt, ohne Erwartungshaltung zu leben? Lass die Dinge sich entwickeln. Viele Beziehungen halten gerade deshalb, weil es eine feste Rollenverteilung gibt. Deine auf rauschartiger Verliebtheit, auf einem illusionären, vergänglichen Gefühl basierenden Beziehungen sind alle gescheitert. Gib dieser doch eine Chance, indem du deinen Weg gehst und Maria ihre Rolle in deinem Leben finden lässt. Wenn sie keine findet, auch gut. Dann lass sie mit liebevollen Gedanken los und ziehe weiter.“
„Du weißt, dass ich niemals sofort die Flinte ins Korn werfe und immer bereit bin, alles anzunehmen und auszuprobieren“, antwortete ich ihm bei unserem stillen Dialog.
Aber ein weiteres Ereignis zeigte mir, dass unsere Ehe hoffnungslos war. Ich wollte mit Maria zum Skifahren und bat sie, die Kanten unserer Ski schleifen zu lassen. Sie holte die bearbeiteten Bretter ab und wir fuhren die Axamer Litzum hinunter. Zu meinem großen Erstaunen rutschte sie ohne Halt auf den vereisten Hängen herum. Offensichtlich griffen ihre Kanten überhaupt nicht.
„Was ist los? Ich denke, du hast sie schleifen lassen?“ fragte ich ratlos.
„Nur deine. Ich hatte Angst, dass meine dann zu schnell würden“, antwortete sie kleinlaut.
Ich lotste sie im Schneepflug ins Tal, ihr Bauch an meinen Hintern gepresst. Im wahrsten Sinne des Wortes klebte sie mir am Arsch. Während ich beruhigend auf sie einsprach, tobte ich innerlich. Um eine fiktive Gefahr zu vermeiden, hatte sie eine reale erzeugt. Maria stand auf dem Entwicklungsniveau einer Neunjährigen. Was sollte ich jetzt machen? Sollte ich mich auf ihre Ebene begeben und meinen Lebensstil ihren Erwartungen anpassen, um mit ihr friedlich zusammenleben und einigermaßen mit ihr kommunizieren zu können? Das bedeutete, dass ich meinen gesamten mühsam erworbenen Erfahrungsschatz und meinen Bewusstseinszustand in die Mülltonne werfen müsste.
Niemals.
Auf jenem vereisten Hang der Axamer Litzum beschloss ich, genau das Gegenteil zu machen. Ich würde ab sofort Gas geben und an meine Grenzen gehen. Jedes Abenteuer und jedes Risiko waren mir recht, nur damit ich dieses kleinbürgerliche geistige Milieu hinter mir lassen konnte, in das ich wieder geraten war.
Ich wusste, das Leben sendet mir immer die Personen, die mich spiegeln. Also schien es irgendwo noch diesen angstbesetzten Sicherheitsfanatiker und kleingeistigen Spießer in mir zu geben. Das würde ich ändern. Den Typen würde ich exorzieren. Mit Tollkühnheit und beispielloser Verwegenheit. Was sollte mir passieren? Knast? Bitte ja. Tod? Immer gerne, am besten im Handstand. Auf einmal dachte ich zurück an einen ganz besonderen Moment, den ich während meiner Haft erlebt hatte:
Am Silvesterabend lag ich auf meinem Bett und lauschte dem Radiosprecher, der die Sekunden bis zum Jahreswechsel zählte. Vor einigen Wochen war ich zu fünf Jahren wegen schweren Betrugs verurteilt worden. Meine bürgerliche Fassade war zerbröckelt und der von mir erzeugte Popanz des seriösen Geschäftsmannes in die Luft geflogen. Das potemkinsche Dorf zerplatzt wie eine Seifenblase. Um Punkt Mitternacht setzte ein ohrenbetäubendes Gejohle ein. Aus allen Zellenfenstern flogen brennende Toilettenpapierrollen, Flaschen, Gläser und alles andere, was Krach machte oder brannte, und segelte an meinen Gittern vorbei in den Hof. Ich stand auf, trat ans Fenster und genoss einen Schluck Orangensaft, während ich das surreale Inferno auf mich wirken ließ.
In diesem desolatesten Moment, allein, von der Gesellschaft (aus-) gerichtet, bespuckt und ehrlos, war ich unbeschwert, frei und sehr glücklich. Ohne an die Vergangenheit oder Zukunft zu denken, von der Anstalt versorgt und geborgen in meiner 8-qm-Zelle. Umgeben von allen wesentlichen Dingen und Nahrungsmitteln, die ich mir entweder beim Knasteinkauf besorgt oder per Weihnachtspaket von Viktoria erhalten hatte, fühlte ich mich absolut frei. Ich schaute durch die Stäbe hinauf zu den Sternen und mein Geist verschmolz mit dem Universum. Eine unglaubliche Kraft durchströmte mich. In diesem Augenblick hatte ich verstanden und verinnerlicht, dass die Reduzierung auf das Notwendige einen freien Geist und - Glück erzeugen kann.
Mir wurde klar, wie ich diese Erkenntnis gerade ad absurdum geführt hatte. Meine erneut aufgeflammte Sucht nach einem Leben auf der Überholspur hatte Bilder und Träume erzeugt, die sich manifestierten und zur sogenannten Realität wurden. Der Dämon begann zu leben, machte sich selbstständig und zwang seinen Schöpfer, nämlich mich, zum Sklavendasein. Meine Schwäche holte Astralgesindel herbei, die das Rohmaterial der wertvollsten unbehüteten Schöpfungskräfte aufsaugten und als Waffe gegen den Menschen verwendeten, der in ihre Falle der Gier und Macht geraten war. Und dieser Mensch war ich..
*An einem warmen Sommerabend saß ich ein halbes Jahr später mit Maria auf der Terrasse des „Kleinen Seehauses“ in Münsing am Starnberger See. Am Nachbartisch unterhielten sich zwei gut aussehende Pärchen über die Party, auf der sie gestern Abend gewesen waren.
„Das Catering vom Käfer war wirklich einsame Spitze. Und dieser Klavierspieler, den sie mitgebracht haben, ein Gott auf dem Piano“, sagte eine der beiden Frauen.
Ich registrierte, wie Maria innerlich zusammenzuckte. Die Erwähnung des Klavierspielers, mit dem sie jahrelang zusammengearbeitet hatte, ließen Erinnerungen an ihre Zeit wach werden, in der sie die Barchefin des Restaurants des berühmten Münchner Feinkosthauses gewesen war. Von da an war sie noch einsilbiger als sonst, weil sie jedes Wort der beiden Pärchen in sich aufsaugte. Bei der Rückfahrt legte sie sanft ihre Hand auf meinen Arm.
„Ich möchte wieder arbeiten, versteh das bitte. Du holst mir die Sterne vom Himmel herunter, aber du hältst sie nicht fest. Ich bin es nicht gewöhnt, von jemandem so abhängig zu sein, noch dazu von einem so wilden und unberechenbaren Mann, wie Du es bist. Mein Leben lang hatte ich meinen Job und war unabhängig. Lass uns in Freundschaft auseinandergehen. Du willst auf dem Land leben, aber meine Welt ist die Stadt, ist München“, sagte sie leise.
Ich wusste sofort, dass sie es vollkommen ernst meinte und es zwecklos wäre, es ihr auszureden. Die letzten Jahre hatte sie immer wieder davon geredet, in ihren Job zurückkehren zu wollen. Obwohl ich vorbereitet war, schmerzte es, es so klar und entschieden zu hören.
Wieder einmal stand ein Abschied bevor. Es gab nichts mehr zu sagen. Ich sah sie an und überlegte, ob ich ihr einen größeren Geldbetrag geben sollte. Doch dann verwarf ich die Idee. Sie hätte es mit einem Schlag für allerlei sinnloses Zeug ausgegeben und wäre wieder mittellos gewesen. Absurderweise suchte sie ihr Leben lang die angebliche Sicherheit einer Geldreserve, aber sobald sie ein wenig Geld angespart hatte, warf sie es mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Ich hatte immer den Verdacht, dass sie sich dann ihres Hauptmotivs um zu arbeiten, das heißt, sich zu beschäftigen, nicht berauben wollte.
Als wir uns nach einem belanglosen Streit endgültig trennten, kam ich auf die Idee, ihr meinen Range Rover, meinen Porsche, meine wertvollen Uhren und unsere gesamte Einrichtung zu überlassen. Damit hatte sie nicht sofort einen Batzen Geld zum Verprassen auf dem Konto, sondern musste erst ein wenig dafür arbeiten, bevor sie es erhalten würde. Der Erlös sollte locker ausreichen, um ihr die Anmietung und Einrichtung einer neuen Wohnung zu ermöglichen. Und ein nicht unerheblicher Rest würde übrig bleiben als Abfindung und Bonus für mir geleistete Dienste. Seit geraumer Zeit sah ich sie nämlich nicht mehr als gleichberechtigte Partnerin, Geliebte oder Ehefrau, sondern nur noch als Dienerin, die mir den Haushalt geführt hatte. Das hatte sie sehr gut gemacht und dafür sollte sie entlohnt werden. Immer noch dachte ich wie der Kaufmann, der ich nie doch wieder sein wollte. So erfuhr ich am eigenen Leibe, wie die Ehe die Liebe zu einem Geschäftsmodell verkommen lässt.