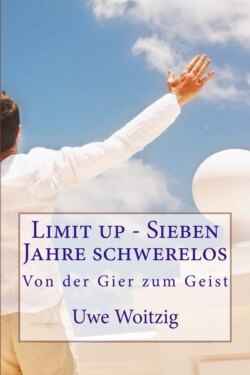Читать книгу Limit up - Sieben Jahre schwerelos - Uwe Woitzig - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеDu bist deine Erfahrung. Darum solltest du mehr Erfahrung sammeln. Bevor du Wurzeln schlägst, solltest du so viele Erfahrungen wie möglich machen. Der wahre Mensch schlägt nie Wurzeln; der wahre Mensch bleibt immer heimatlos, ein Zigeuner, ein Wanderer, ein Vagabund der Seele. Er bleibt ständig auf der Suche, bleibt ein Forscher, ein Lernender – er wird nie zu einem Gelehrten. Darum habe keine Eile zu einem Gelehrten zu werden, bleibe ein Lernender. Ein Lernender zu bleiben hat eine ungeheure Schönheit und Würde, denn darin besteht das Leben.
(Osho)
Über ein Jahr war vergangen, seit sich die Gefängnistür für mich geöffnet hatte und ich in die sogenannte Freiheit zurückgekehrt war. An einem lauen Septemberabend raste ich mit sehr schlechter Laune in meinem silbergrauen Porsche GTI von Bozen nach München. Heute Morgen erst war ich aus New York zurückgekommen, wo ich mich an seinem Grab von meinem besten Freund Clinton verabschiedet hatte. Er war während meiner Haft gestorben. An Magenkrebs. Mit 45. Im allerbesten Mannesalter. Ohne den Knast wäre es mir vermutlich ähnlich ergangen. Angelo, der damalige Direktor meiner Firma in Monte Carlo, hatte mir kurz nach meiner Entlassung eher beiläufig am Telefon von Clints Tod erzählt. Mir war der Hörer aus der Hand gefallen, so geschockt war ich. Clint, mein bester Freund und Trauzeuge, war gegangen. Auf einmal war ich skeptisch geworden und zweifelte an der für mich unfassbaren Nachricht. Aber dann fand ich Clints Todesanzeige im Internet. Fassungslos las ich seinen Nachruf und auf welchem Friedhof er begraben worden war. Sofort hatte ich beschlossen, sein Grab aufzusuchen
Aber ich hatte den Flug nach New York auch gebucht, um dem „Big Apple“ endgültig Adieu zu sagen. Am Abend nach meiner Ankunft in Manhattan stand ich gedankenverloren am Fenster meiner Suite des Waldorf Astoria und starrte in den regenverhangenen New Yorker Nachthimmel, der von den unzähligen Lichtern der Metropole fast taghell erleuchtet wurde. Niemand hatte mich wie früher mit einer dunklen Stretch-Limousine am JFK-Airport abgeholt und mich während der Fahrt mit humorvollen Stories und Sprüchen unterhalten. Erst jetzt wurde mir so richtig bewusst, was Clints Tod für meine Beziehung zu der „Stadt, die niemals schläft“ bedeutete. Wehmütig dachte ich daran zurück, welche Ereignisse dazu führten, dass wir uns kennenlernten …
Unsere vier ersten Geschäftsjahre in München hatten uns viel Geld in unsere Kassen gespült. Wir waren mit unserer Investment-Firma ins Nobelviertel Bogenhausen in ein 1400 qm großes Bürohaus umgezogen, das wir komplett angemietet hatten. Unsere modifizierte Anlagestrategie war sehr erfolgreich gewesen und hatte uns viele zufriedene Kunden gebracht, die uns alle weiter empfahlen. Wir brauchten nie eine Anzeige zu schalten oder eine Werbekampagne zu starten. Die Kunden gaben sich die Klinke in die Hand, weil wir zu dem Geheimtipp der Stadt für erfolgreiche Geldanlagen geworden waren. Wir hatten so viel verdient, dass wir uns die Mehrheitsanteile einer renommierten Privatbank leisten konnten. Der Erwerb der Bank war äußerst hilfreich gewesen, um das Vertrauen neuer Kunden zu gewinnen. Mein Partner, der ein genialer Verkäufer war, nutzte beide Tatsachen weidlich aus und das Geld floss in Strömen auf unsere Konten.
Aber noch wickelten wir unsere Börsentransaktionen über ein in München ansässiges Brokerhaus ab, sodass uns einige Interessenten als Dépendance davon ansahen. Sie zogen es vor, ihr Geld lieber direkt vom scheinbaren Mutterhaus verwalten zu lassen und wir verloren sie als Kunden.
Es störte mich gewaltig, dass die renommierte US-Investmentbank von unserer Leistung profitierte. Ich wollte ein eigenes Brokerhaus mit besseren Konditionen als ihre besitzen. Dazu ließ ich meinen Prokuristen sogenannte Discount-Broker in New York heraussuchen und für mich mit ihnen Termine vereinbaren, um mit ihnen über eine mögliche Partnerschaft zu verhandeln. Da ich gerne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinde, flog ich statt direkt nach New York erst eine Woche auf die französischen Antillen nach Gouadeloupe, um mir karibisches Flair um die Nase wehen zu lassen. Die Insel gefiel mir so gut, dass ich mit einem gemieteten Jeep jeden Tag Ausflüge zu neuen Stränden oder in den Urwald der anderen Hälfte machte. Dabei verfuhr ich mich des Öfteren und lernte die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Inselbewohner kennen und schätzen.
Mein Flieger erreichte Manhattan in den frühen Abendstunden. Gerade hatte der berühmte spektakuläre Sonnenuntergang begonnen und tauchte den Himmel über der Skyline des „Big Apple“ in ein faszinierendes Farbenfeuerwerk. Wir mussten einige Warteschleifen fliegen, bevor wir in La Guardia landen durften. Ich presste meine Nase an das Bullauge des Fliegers und konnte mich nicht satt sehen an dem überwältigenden Anblick. One of the views of the world.
Die Zollfarmalitäten dauerten und so erreichte ich erst spät am Abend das „Waldorf Astoria“, in dem ich meine Sekretärin ein Einzelzimmer hatte buchen lassen. An der Rezeption der ganz in Dunkelblau gehaltenen Halle mit der mächtigen goldenen Uhr erwartete mich ein freundlich lächelnder Schwarzer in einem gut geschnittenen dunkelgrauen Anzug.
„Where did you get your suntan? “, fragte er mich.
„In the Caribbean“, antwortete ich.
„Where exactly? “, fragte er mit dieser typisch amerikanischen Forschheit nach, die ernsthaftes Interesse vorgaukeln soll.
„Well, I spent a few days on Guadeloupe. “
“What you think of the people of Guadeloupe?” fragte er erneut nach, diesmal aber anscheinend wirklich interessiert.
Also erklärte ich ihm, dass ich die Menschen dort sehr, sehr freundlich, warmherzig und liebenswert erlebt hätte.
Er strahlte mich an.
„By the way, I am from Guadeloupe.“
Er fragte mich, wie lange ich bleiben wollte. Ich antwortete eine Woche. Er sagte, er könnte mir für diese Zeit eine Junior Suite geben. Ich hob bedauernd die Schultern.
„Sorry, but that´s beyond my budget. “
Schon die 100 US-$ für mein Einzelzimmer – der Kurs des Dollars war gerade auf 3,20 DM geklettert – fand ich astronomisch.
„No Sir, I can give you the Suite for the price of a single room. Is that ok?“
Ich war fassungslos.
„Sure, thank you so much”, erwiderte ich. Ich konnte es kaum glauben, als er mir seine Karte gab und sagte, wann immer ich in Zukunft nach New York käme, sollte ich bei ihm reservieren. Er würde mir jedes Mal eine Suite für den Einzelzimmerpreis geben.
Wenig später saß ich in den für mich am elegantesten möblierten Räumen, in denen ich jemals gewesen war. Auf dem antiken Mahagonitisch stand ein perfekt zubereiteter und fein dekorierter Hamburger mit wunderbar knusprigen French Fries, den ich mir vom Roomservice hatte bringen lassen. Während ich genüsslich kauend mein Mahl vertilgte, ließ ich meinen Blick vom 76. Stock des Waldorf über die Lichter der Stadt gleiten, die angeblich niemals schläft.
Nicht nur das wunderbare Welcome–Geschenk durch den Portier hatte mich inzwischen überzeugt, dass das „meine Stadt“ werden würde. Obwohl alles um mich herum gigantisch, kalt und vollkommen unnatürlich wirkte, fühlte ich mich hier zuhause.
In so einer Umgebung musste es ein ungeheuer spannendes menschliches Potential aller Facetten geben. Der Portier aus Gouadeloupe hatte mir einen ersten Hinweis darauf gegeben.
Auf einmal überliefen mich wohlige Schauern.
Ich witterte Sex und Geld.
Viel Sex.
Viel Geld.
Plötzlich war ich nicht mehr müde. New York hatte offensichtlich eine Energie, die meine verbrauchte wieder auflud. Ich zog mich an, fuhr ins Erdgeschoss hinunter und setzte mich an die Bar. Ein hünenhafter Barkeeper fragte mich, was ich trinken wollte.
„Campari Orange, please“ bestellte ich meinen Lieblingsdrink von Ios. Wenig später stellte er mir ein Glas Campari mit einer Orangenscheibe vor die Nase. Ich erklärte ihm, dass ich eine Mischung von Orangensaft und Campari haben wollte. Er sah mich skeptisch an, brachte mir aber das Gewünschte. Ich ließ ihn probieren. Er fand es fabelhaft.
„I will put it on my drink list. If you allow me I will call it „Joe´s Special“. By the way, my name is Joe. I am from Poland. This drink is on the house. Is it your first time to New York?” fragte er mich.
Ich bejahte und freute mich über mein zweites Willkommens-Präsent.
“Ok, if I may I will give you some recommendations.”
Ich nickte und er erklärte mir, dass hier viele alleinstehende Frauen hereinkämen, die hofften, einen wohlhabenden Mann zu finden. Manche kämen nur wegen schnellem Sex. Er kenne sie fast alle. Er schlage mir vor, wenn interessante Frauen da seien, würde er ihnen einen Drink hinstellen und ihnen sagen, dass ich sie eingeladen hätte.
Alles Weitere sei dann ein Kinderspiel für mich, „cause you´ re a ladies´ man“, wie er anfügte. New York gefiel mir immer besser. Ich trank aus und ging zufrieden in mein Kingsize Bett.
Am nächsten Tag lernte ich Clinton kennen. Er sollte uns dabei helfen, eine neue geschäftliche Dimension zu erreichen. Clinton hatte sein Büro etwa 150 Meter vom Waldorf Astoria entfernt im Helmsley Building über dem Grand Central Terminal, deshalb war er mein erster Termin an diesem Tag. Aber von der Sekunde an, in der ich sein Büro betrat und dem untersetzten Typen mit der hohen Stirn, den fein geschnittenen Zügen und seinen klugen braunen Augen begegnete, wusste ich, dass ich meine anderen Termine absagen konnte. Er war genau der Partner, den ich gesucht hatte.
Schnell stellte sich heraus, dass er mit seiner Firma nicht nur alle unsere geschäftlichen Ansprüche befriedigen konnte, sondern auch noch denselben Humor besaß wie ich. Er hatte in Harvard studiert und Zutritt zu den elitären Kreisen in New York. Wie bei uns gehörten sehr prominente Menschen zu seinen Kunden.
Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen und besprachen alle wesentlichen Punkte, wobei wir uns nebenbei köstlich über die trockenen Sprüche des anderen amüsierten. Clint hatte immer eine „Punchline“, mit der er eine Aussage abschloss, und nur zu gerne übernahm ich diesen in New York üblichen Habitus. Wenn zum Beispiel jemand sagt, „I think we have a problem.“ Antwortet sein Gesprächspartner sofort „What you mean we, white man?“ und Beide brechen in Gelächter aus.
Hintergrund ist die Story von „Tonto und dem Lone Ranger“, zwei Comicfiguren aus den dreißiger Jahren. Tonto ist der mexikanische Gefährte des „Lone Rangers“, einem ganz in Weiß gekleideten Kämpfer für Recht und Ordnung im Wilden Westen. Eines Tages reiten die Beiden durch einen Canyon, als plötzlich auf den Kämmen zu beiden Seiten des Tales Hunderte von Apachen in Kriegsbemalung auftauchen und wild schreiend auf sie zureiten. Da sagt der Lone Ranger: „Tonto, I think, we have a problem.“ Und Tonto antwortet mit dem Klassiker: “What d` you mean we, white man?”
Diese humorvolle Leichtigkeit Clintons bei zielführenden Geschäftsgesprächen gefiel mir ungeheuer gut. Sie war ein wohltuender Kontrast zu der bleifüßigen Ernsthaftigkeit, mit der wir Deutschen jedes Mal so tun, als sei eine neue Entscheidung das Bedeutsamste auf der Welt und müsse unendlich lange diskutiert und abgewogen werden. Da war nichts von der Leichtfüßigkeit des Kairos zu spüren und deshalb ging es meistens schief.
Clint und ich hingegen stellten in wenigen Stunden nicht nur die Weichen für eine geschäftlich sehr erfolgreiche Zukunft, indem wir eine Partnerschaft vereinbarten und ich Konditionen für unsere Börsentransaktionen mit ihm aushandelte, die ein Bruchteil von dem waren, was wir augenblicklich in München bezahlten.
Nebenbei entwickelten wir noch ein Steuersparmodell, von dem später einmal der Chef der Münchner Steuerfahndung bei einem seiner Besuche in der JVA Stadelheim zu mir sagen sollte, dass uns da ein Geniestreich gelungen war, den er noch nie zuvor erlebt hätte und von dem er hoffe, dass ihn niemand kopieren werde.
Nach einem gemeinsamen Abendessen im „Tavern in the Green“, einem von Clints Lieblingslokalen, bei dem wir uns unsere Lebensgeschichten erzählten, verabredeten wir uns zum Frühstück um neun Uhr. Ich ging sehr zufrieden in die Bar des Waldorf, um noch einen Absacker zu trinken. Unaufgefordert stellte mir mein neuer Freund Joe augenzwinkernd einen Campari Orange hin.
„I have invited the two ladies opposite of you for a drink in your name. You should stand up and walk over“, raunte er mir zu. Tatsächlich saßen mir gegenüber zwei dieser hübschen, fitten, typisch New Yorker Blondinen mit ihren harten Augen, die mir gerade freundlich zulächelten und mir mit ihren Gläsern Champagner zuprosteten.
Wie Joe mir empfohlen hatte, stand ich auf und ging zu ihnen. Wir verbrachten eine feuchtfröhliche Zeit bis in die frühen Morgenstunden. Irgendwann lud ich sie ein, bei mir zu übernachten. Sie nahmen an und wir fuhren mit einem der lautlos fahrenden Lifts zu mir nach oben.
Als sie meine Suite sahen, gingen sie davon aus, dass ich zu den sehr reichen Jungs dieser Welt gehörte und ich hatte gewonnen. In dieser Nacht lernte ich eine weitere Form des amerikanischen Perfektionismus kennen: die Bettakrobatik. Die Beiden spielten mit mir fast jede Stellung des Kamasutra durch und das in perfekter Grundhaltung.
Dabei wurde der Sex allerdings zu einer Turnstunde, was schon in der Schule nicht mein Ding war. Ich wollte immer den Rausch des Orgasmus, um nichts anderes ging es mir. Ausgefeilte Vorspiele und diverse Stellungen auszuprobieren, langweilte mich damals. Ich liebte den puristischen Akt in der Lieblingsstellung der jeweiligen Partnerin. Mit meinem intensivem Höhepunkt als krönenden Abschluss. Ich war mit einer starken Potenz gesegnet und konnte immer wieder. Da ich nach den ersten Malen immer mehr Zeit brauchte, um wieder zu kommen, kam jede Frau auf ihre Kosten. Auch meine beiden.
Wir trieben es die ganze Nacht und schliefen erst in den frühen Morgenstunden ein.
Bis uns mein Wake-up-Call um 8.30 Uhr weckte. Schlaftrunken, verkatert und völlig neben der Kappe stand ich auf, duschte, zog mich an und sagte den Beiden, sie sollten noch ein wenig liegen bleiben und dann einfach gehen. Ich hätte eine Business-Verabredung zum Frühstück. Wir verabschiedeten uns mit zärtlichen Küssen.
Clint sah mich prüfend an, als ich ihm wenig später gegenübersaß.
„Uwe, du siehst trotz deiner Bräune kreidebleich aus. Und deine Hände zittern wie verrückt.“
Tatsächlich schaffte ich es kaum, meine Kaffeetasse an den Mund zu führen, ohne dass der Kaffee heraus schwappte.
„Das ist der Jetlag“, antwortete ich geistesgegenwärtig, „bei mir schlägt er erst heute zu.“
Nach dem opulenten Frühstück mit Eiern und kross gebratenem Speck ging es mir zunehmend besser. Wir wollten in Clints Büro gehen, aber ich hatte ein paar wichtige Dokumente vergessen. Während wir zu meiner Suite hochfuhren, betete ich, dass die Mädels verschwunden wären. Ich wollte meinen Eindruck des seriösen Geschäftsmannes nicht schon am zweiten Tag wieder verwischen. Die Suite war leer, als wir sie betraten. Ich atmete innerlich auf und ging kurz auf die Toilette.
Als ich in das Schlafzimmer zurückkam, stand Clinton grinsend neben dem zerwühlten Bett und hielt einen Ohrring hoch, den eines der Girls verloren haben musste.
„So this is your “Jetlag”, right? You bastard have obviously screwed your brains away last night!”
Lachend fielen wir beide aufs Bett. Dieser Augenblick war der Beginn einer tiefen Freundschaft und „Jetlag“ wurde unser Code für wilden Sex außerhalb unserer Beziehungen und Ehen.
Bei unserem gemeinsamen Mittagessen im „La Grenouille“, einem der besten Restaurants der Stadt, fragte ich Clint, ob wir seine Adresse auf unseren Briefbogen einsetzen könnten.
„Sure“, erwiderte er.
Damit hatte unsere Firma dank Clinton eine Anschrift auf der Park Avenue in Manhattan, einer der feinsten Adressen New Yorks, und wir waren unabhängig von unserem ehemaligen Brokerhaus. Nichts stand unserem kometenhaften Aufstieg mehr im Wege. Das Motto hieß: limit up.