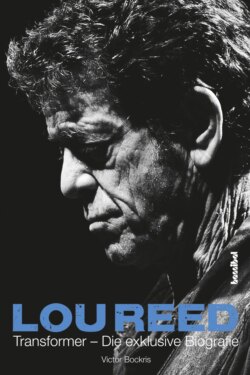Читать книгу Lou Reed - Transformer - Victor Bockris - Страница 7
ОглавлениеDer Horizont erweitert sich
Syracuse University: 1960–1962
„Lou spielte gern mit den Menschen, er verleitete sie dazu, bis zum Äußersten zu gehen. Aber wenn man selbst bei Lou eine gewisse Grenze überschritt, dann schnitt er einen einfach aus seinem Leben heraus.“
— Allen Hyman
Um ihre Freundschaft fortzusetzen, beschlossen Lou und Allen Hyman, die gleiche Universität zu besuchen. „In der letzten Klasse der Highschool fuhr ich mit Lou und seinem Vater hinauf nach Syracuse zu einem Aufnahmegespräch“, erinnert sich Allen. „Wir redeten nicht viel mit seinem Vater. Mr. Reed war ein sehr stiller Mann; still im Sinne von steif. Wir übernachteten im Hotel Syracuse, einem dieser richtig alten Hotels, die es damals noch gab. Außer uns stieg dort aus dem gleichen Grund noch eine Menge anderer Kids mit ihren Eltern ab. Alles Bewerber für die Syracuse-Uni. Lous Vater nahm ein Zimmer, das andere teilte ich mir mit Lou.
In der Empfangshalle machten wir die Bekanntschaft einer Gruppe von Kids, die schon auf der Uni waren, und die ganze Nacht hindurch feierten wir eine Party mit diesen Mädchen. Wir malten uns schon aus, wie toll es werden würde, richtig fantastisch. Am nächsten Tag kannten wir also schon ein paar Leute, die zu der Zeit bereits auf die Syracuse gingen und in Verbindungshäusern wohnten. Der ganze Campus wirkte so freundlich, ich glaube es war Sommer, es war warm damals, alles sah einfach herrlich aus.“
Die Jungen vereinbarten, dass sie sich, falls man sie hier aufnehmen würde, in Syracuse immatrikulieren wollten. „Wir schafften es beide“, sagt Hyman.
„Kaum hatte ich die Aufnahmebestätigung erhalten, teilte ich ihnen mit, dass ich kommen würde, und dann rief ich Lou an und sagte noch ganz aufgeregt: ‚Ich bin in Syracuse angenommen worden, du auch?‘ Und er sagte: ‚Ja.‘ Also fragte ich ihn: ‚Gehst du hin?‘ Und er antwortete: ‚Nein.‘ – ‚Was soll das heißen, nein?‘, wollte ich wissen. ‚Wir wollten doch hingehen, wir hatten eine Abmachung.‘ Doch er sagte nur: ‚Ich bin an der N. Y. U. angenommen worden, und ich gehe dorthin.‘ Ich sagte: ‚Warum machst du denn so etwas, es hat uns da oben doch so gut gefallen, ich habe ihnen schon mitgeteilt, dass ich kommen werde, ich dachte, du würdest auch mitkommen …‘ Er sagte: ‚Nein, ich bin an der N. Y. U. Uptown angenommen worden, da gehe ich hin.‘“
Ab dem Herbstsemester 1959 besuchte Lou das College. Mitten in New York City gelegen, war die New York University eine clevere Wahl für jemanden, der nichts lieber tat, als im Five Spot, im Vanguard und anderen Klubs in Greenwich Village Jazz zu hören. Doch Lou hatte sich nicht den im Village beheimateten Teil der N. Y. U. ausgesucht, sondern schrieb sich unverständlicherweise in der Abteilung ein, die recht weit uptown in der Bronx lag. N. Y. U. Uptown konnte Lou jedoch weder die Möglichkeiten noch die Unterstützung bieten, die er brauchte. Stattdessen fand er sich dort in einer fremden, feindseligen Umgebung ganz auf sich allein gestellt. Eine seiner wenigen Vergnügungen bestand in den regelmäßigen Besuchen im Mekka des modernen Jazz, dem Five Spot; allerdings reichte sein Geld nicht immer für den Eintritt, und so stand er oft vor der Tür und lauschte den Klängen von Thelonious Monk, John Coltrane und Ornette Coleman, die bis auf die Straße hinausdrangen.
Lous Hauptinteresse galt ohnehin nicht dem College. Das Uni-Gelände in der Bronx lag nicht weit vom Payne-Whitney-Institut entfernt, einer psychiatrischen Klinik an der Upper East Side von Manhattan, wo er sich einer Reihe von intensiven Nach-Schockbehandlungen unterzog. Hyman zufolge, der mit ihm während des Semesters mindestens einmal pro Woche telefonierte, ging es Lou damals sehr, sehr schlecht. „Er war drei- oder viermal pro Woche in der Therapie“, erinnert sich Hyman. „Er hasste die N. Y. U., er hasste die Uni wirklich. Er durchlief eine ziemlich schwierige Phase und stand unter Medikamenten. Es fiel ihm außerordentlich schwer, das College und seinen Alltag auf die Reihe zu kriegen. Er war fertig. Er hatte zu jener Zeit dermaßen viel mit seinen emotionalen Geschichten zu tun, und womöglich war er nicht weit von einem mittleren Nervenzusammenbruch entfernt.“
Im Frühjahr 1960, nach zwei Semestern, hatte Lou die Sitzungen im Payne-Whitney-Institut abgeschlossen; er war immer noch auf Tranquilizern und hatte mit der Szene an der N. Y. U. endgültig nichts mehr am Hut.
Einer der wenigen, die Lou während seiner einjährigen Depression ermutigten, war sein treuer Jugendfreund Allen Hyman, der ihn auch jetzt dazu drängte, sich von seinen Eltern zu lösen. Allen war in Syracuse eingeschrieben – einer großen, renommierten Privatuniversität, hunderte von Kilometern von Freeport entfernt. Allen brachte Lou dazu, ihm dorthin zu folgen. Im Herbst 1960 ließ Reed die dunklen Schatten von Creedmore und die Medikationen von Payne Whitney hinter sich und immatrikulierte sich in Syracuse.
Der Campus der Syracuse-Uni sah wie der perfekte Drehort für einen Horrorfilm über das Leben in einem College in den frühen Sechzigerjahren aus. Die romantischen Gebäude schienen der Fantasie eines Drehbuchautors entsprungen. Tatsächlich sollte der Autor der TV-Serie Addams Family, der diese Universität zur gleichen Zeit wie Lou besuchte, später die im schönsten neogotischen Stil erbaute Hall of Languages als Grundidee für den Familiensitz der Addams-Familie benutzen. Die Architektur des umliegenden, vier Straßen im Quadrat umfassenden Collegegeländes wurde von viktorianischen Holzhäusern sowie Restaurants, Läden und Bars aus der Depressionszeit ergänzt. Die allgegenwärtige gelbgraue Farbe verlieh den heruntergekommenen, in Seitenstraßen versteckten und die meiste Zeit über mit Schnee, nassen Blättern oder Regen bedeckten Holzhäusern ein düsteres Aussehen. Diese ideale Atmosphäre zur Förderung poetischer Betrachtungen oder manischer Depressionen war als Hintergrund für den Lebensstil der Beatniks geradezu prädestiniert.
Das Industriestädtchen Syracuse selbst, das sieben Monate im Jahr unter Schneemassen begraben lag und die restlichen Monate in Regenschauern versank, bot ringsherum ein nicht weniger abgerissenes Bild. Nur im Sommer, wenn die meisten Studenten sich zuhause auf Long Island oder in New Jersey aufhielten, bekam die Stadt etwas Wärme und Sonnenschein ab. Zunächst schien Syracuse nicht gerade ein geeigneter Ort für Lou. Das auch unter dem Namen Salt City bekannte blühende Industriezentrum, das sich auf Metallverarbeitung und Elektrogeräte spezialisiert hatte, lag dreihundertzwanzig Kilometer nordwestlich von Freeport, fünfundsechzig Kilometer südlich des Ontariosees und der kanadischen Grenze und acht Kilometer südwestlich des Oneidasees. Syracuse war militant konservativ und religiös, doch zu der Zeit, als Reed dort ankam, wandelte es sich gerade mit atemberaubender Geschwindigkeit zum akademischen Zentrum des Bundesstaates New York. Die Stadt unterstützte ihre renommierte Universität, deren Footballteam, die Orangemen, während der vier Jahre, die Lou dort verbrachte, ungeschlagen blieb. Und die Bevölkerung pilgerte in hellen Scharen zu allen sportlichen Ereignissen herbei. Trotz aller akademischen Standards galt Syracuse immer noch in erster Linie als Football-Uni. „Where the vale of Onondaga / Meets the eastern sky / Proudly stands our Alma Mater / On her hilltop high (Wo das Tal des Onondaga / sich mit dem östlichen Himmel vereint / Erhebt sich stolz unsere Alma Mater / Hoch oben auf dem Berge)“, so lauteten die ersten Zeilen des offiziellen Schulliedes; ein Song, den Lewis, wie ihn dort viele seiner Freunde nannten, nicht vergessen sollte.
Die für Studenten beiderlei Geschlechts zugelassene Universität, die von über neunzehntausend Studierenden der Natur- sowie der Geisteswissenschaften besucht wurde, war im Jahr 1871 gegründet worden. Sie erstreckte sich auf einem Gebiet von über sechshundertvierzig Morgen, auf einem Hügel mitten in der Stadt. Mit achthundert Dollar pro Semester lagen die Studiengebühren relativ hoch für eine private Universität. Die meisten Studenten lebten in nach Männlein und Weiblein getrennten Verbindungshäusern und erfreuten sich einer letzten, vier Jahre währenden Party, bevor sie ihr kindisches Gehabe ablegten und gegen die Verantwortung des berufstätigen Erwachsenendaseins eintauschten. Unter ihnen gab es eine große und gut betuchte jüdische Fraktion, die größtenteils aus eingefleischten Verbindungsleuten bestand, die fest auf Juristen- oder Medizinerkarrieren abonniert waren. Außerdem existierte eine kleine Truppe von bildenden Künstlern, Schriftstellern und Musikern, denen sich Lou anschloss. Dort fand er zum ersten Mal in seinem Leben eine Nische, in der er sich bis zu einem gewissen Grad heimisch fühlen konnte. In Reeds Jahrgangsklasse machten 1964 neben vielen anderen talentierten und erfolgreichen Leuten der bildende Künstler Jim Dine, die Modeschöpferin Betsey Johnson und der Filmproduzent Peter Gruber ihren Abschluss. Als Neuzugang wurde Lou in die äußerste Südwestecke des North Campus, in die Sadler Hall verwiesen, ein nüchternes, kastenförmiges Wohnheim, das an ein Gefängnis erinnerte. Die meiste Zeit verbrachte er jedoch in dem herrlichen, großen Steingebäude der Hall of Languages, das die University Avenue und den University Place überblickte und in dem das Englische, das Historische sowie das Philosophische Institut untergebracht waren.
Reed genoss außerdem den Vorteil, dass ihn sein großartiger Freund aus der Kindheit, der sanfte Manipulator und Prinz der guten Zeiten Allen Hyman, in das Uni-Leben einführen konnte. Hyman, der gerade sein zweites Collegejahr begann und als verwöhntes Vorstadtkind nicht nur einen Cadillac, sondern auch einen Jaguar fuhr, war großzügig, immer gut gelaunt und äußerst scharfsinnig; obendrein mochte er Lou wirklich gern und setzte so einiges daran, auch weiterhin sein Freund zu bleiben. Hyman hatte gute Beziehungen zur konventionellen Studentenschaft, einer Szene, in die er selbst aufsteigen wollte, und er war versessen darauf, auch Lewis dort einzuführen.
Zunächst kam es jedoch dabei zu einer unangenehmen Situation, als Allen versuchte, Lou in seine Verbindung, die Sigma Alpha Mu (genannt „The Sammies“) einzuschleusen. „Die Initiation in eine solche Verbindung war ein schreckliches Erlebnis und die meisten Leute waren mächtig eingeschüchtert davon“, erinnert sich Hyman. Neuankömmlinge wurden gezwungen, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu betrinken, und wurden zudem physisch, sexuell und geistig von den Verbindungsbrüdern bloßgestellt. Als Allen Lou erzählte, was er alles durchgemacht hatte, um in die Verbindung aufgenommen zu werden, sah Lou ihn fassungslos an und schnauzte: „Stehst du jetzt auf Masochismus, oder was?“
„Er sagte, er wolle nichts damit zu tun haben, dass es faschistisch und widerlich sei“, erzählt Hyman. „Er konnte sich nicht vorstellen, dass sich jemand so schikanieren ließ, ohne zu versuchen, die Person umzubringen, die einen schikanierte.“ Trotzdem – typisch pervers – willigte Reed ein, an solch einer Aufnahmeprüfung teilzunehmen.
Von Beginn an war klar, dass er die Absicht hatte, großen Eindruck zu machen. Er erschien zu dem Aufnahmeritual in einem schmutzbespritzten und drei Nummern zu kleinen Anzug. Damit verabschiedete er sich radikal vom Erscheinungsbild der anderen Rekruten mit blauem Blazer, schicker Krawatte und glatt gekämmtem Haar. Allen begriff sofort, dass Lou sich vorgenommen hatte, so herausfordernd wie nur mög-lich aufzutreten. Als eines der Mitglieder Lous Aufmachung kritisierte, erwiderte Lou „Fuck you“, und damit kam seine Karriere in einer Verbindung zu einem abrupten Ende. Hyman musste seinen Freund hinausbegleiten. Ein bekümmerter Allen ließ auf dem Weg zu Lous Zimmer den Kopf hängen, aber Lou, alles andere als verzweifelt, schien sich sehr über das Erlebnis zu amüsieren. „Ich glaube, das ist wirklich nicht deine Sache“, sagte Allen.
„Stimmt genau“, erwiderte Lou. „Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit diesen Idioten nicht klarkomme. Wie kannst du es da bloß aushalten?“
Beim Aufnahmezeremoniell des Reserve Officer’s Training Corps fiel Lou ebenfalls durch. Als Neuzugang am College musste er bestimmte Kurse belegen, darunter auch entweder Leibeserziehung oder R. O. T. C. (in der Zeit wählte man im Allgemeinen das R. O. T. C., um später der Armee als Offizier und Gentleman beitreten zu können). Lou versuchte, beidem aus dem Weg zu gehen, indem er behauptete, er würde sich beim Turnen den Hals brechen und in R. O. T. C. jemanden umlegen, aber am Ende schrieb er sich widerwillig für R. O. T. C. ein. Die Aktivitäten dieses Korps bestanden aus zwei wöchentlichen Unterrichtsstunden, in denen es darum ging, wie man ein guter Soldat oder sogar eine Führungspersönlichkeit wurde. Lous militärische Laufbahn war jedoch fast genauso kurz wie sein Auftritt bei der Bruderschaft. Nur wenige Wochen nach Semesterbeginn wurde er auch schon wieder ohne größeres Aufhebens vor die Tür gesetzt, als er sich weigerte, einem Befehl des Offiziers Folge zu leisten.
Er schaffte es jedoch auf anderem Weg, in seinem ersten Jahr einigen Eindruck zu machen. Mit seinem jungenhaften Charme gelang es Lou, die ernsten Bedenken der Programmdirektorin Katharine Griffin zu zerstreuen, und so drängelte er sich in die Syracuse University Radio Station WAER FM mit einer Jazzsendung hinein, die er Excursions On A Wobbly Rail (Ausflüge auf verzogenen Schienen) nannte – nach dem Titel eines verrückten Cecil-Taylor-Stücks, das auch gleichzeitig als musikalisches Intro diente.
Der klassisch orientierte, konservative Radiosender befand sich in einer Art Hütte, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammte und versteckt hinter der Carnegie-Bücherei lag. Hier saß Lou dreimal die Woche zwei Stunden lang und fror sich an eiskalten Abenden den Hintern ab, während er zusammengekauert über seiner altmodischen technischen Ausstattung hing wie ein Widerstandskämpfer hinter der Front; von hier aus sendete er eine bunte Mischung der Musik seiner Lieblingsmusiker, die allesamt der Avantgarde des Freejazz angehörten, Ornette Coleman und Don Cherry, den Doo-Wop-Sänger Dion und den sexuell anrüchigen Hank Ballard ebenso wie James Brown und The Marvelettes. Diese Mischung enthielt Lous Quintessenz. „Ich war ein großer Fan von Ornette Coleman, Cecil Taylor und Archie Shepp“, erinnert er sich. „Dann kamen James Brown, die Doo-Wop-Gruppen und Rockabilly. Pack alles zusammen, und du hast mich.“
Unglücklicherweise traf Lous Musikgeschmack nicht auf die Gegenliebe der anderen Mitarbeiter des Senders; zahlreiche Mitglieder der Fakultät, darunter auch der Dekan der Studentenschaft, beschwerten sich über die – ihrer Ansicht nach – entsetzliche und unzumutbare Kakophonie, die ihnen während Reeds Sendungen entgegendröhnte. Die negative Reaktion der Universitätsleitung war keineswegs Lous einziges Problem. Allen Hyman rief Lou häufig mit verstellter Stimme an und belästigte ihn mit lächerlichen Musikwünschen. Einmal, so erinnert sich Allen, „wollte ich ein Musikstück hören, von dem ich wusste, dass er es nicht ausstehen konnte und niemals spielen würde. Er sagte: ‚Nein, das spiele ich nicht, vergiss es.‘ Und ich sagte: ‚Hör mal, wenn du das jetzt nicht spielst, dann bring ich dich verdammt noch mal einfach um. Ich warte auf dich, und ich bring dich um!‘ Lou bekam es mit der Angst zu tun; er dachte, ich sei irgendein Wahnsinniger. Später habe ich ihn dann angerufen und gesagt, dass ich es war. Er hat mich angeschrien und gesagt, wenn ich das noch einmal machen würde, dann würde er nie wieder mit mir reden.“
Wie sich herausstellte, hatte Allen jedoch nicht lange genug Zeit, um durch solche Scherze seine Freundschaft mit Lou aufs Spiel zu setzen; bereits nach kurzer Zeit kam Katharine Griffin, die wachsame Programmdirektorin, zu dem Schluss, dass „Excursions On A Wobbly Rail eine völlig verrückte Jazzsendung war, die sich mehr nach einer Art neuem Lärm als nach Musik anhörte. Es war einfach zu exzentrisch und überschritt eine bestimmte Grenze.“ Noch vor Semesterende wurde es ohne viel Federlesens aus dem Programm gestrichen, was Lou natürlich sehr ärgerte.
Im Rückblick stellten Griffin und ihre Zeitgenossen fest, dass Reed seiner Zeit einfach voraus war. „Die meisten von uns, die auf dem Campus den Ton angaben, waren ganz normale Kinder ihrer Zeit, der Fünfziger“, erklärt sie. „Damals trugen die Jugendlichen Karohemden und Chinos, korrekt geschnitten. Lou sah eher so aus wie die Rockmusiker später in den Sechzigern. Er nahm schon die Sechziger- und Siebzigerjahre vorweg, aber wir waren noch nicht reif dafür. Er befand sich genau am Scheidepunkt zwischen zwei Generationen. Und er war schon ein bisschen zu weit weg, um noch in den Fünfzigern bewundert zu werden.“
In seinem ersten Jahr in Syracuse, so schließt die strebsame Griffin, hieß es „Lou gegen den Rest der Welt“.
Lou stilisierte sich selbst als merkwürdigen Einzelgänger. Er ging allen studentischen Organisationen aus dem Weg und war damit beschäftigt, ein Image von sich aufzubauen, das schon bald als die Essenz des angesagten New-Yorker Szenegängers bekannt werden sollte. Lou war ein Jahr älter als die anderen Erstsemester und voll ausgewachsen. Er war 1,70 Meter groß (obwohl er behauptete, es seien 1,74 Meter), ein bisschen dicklich und noch einige Schritte von dem späteren Lou Reed von „Heroin“ entfernt. Er trug Mokassins, Jeans und T-Shirts und war meistens etwas schlampiger angezogen als die Mehrzahl der anderen Studenten, die die Bruderschaftsuniform, bestehend aus Anzug und Krawatte, trugen. Sein Haar war ebenfalls eine Spur länger als das seiner Kommilitonen. Ohne diese Accessoires wäre er in der Menge nicht aufgefallen. Sein Aussehen tendierte zum Niedlichen, Jungenhaften, Lockenköpfigen, Schüchternen, Kaugummi Kauenden hin. Unter seinem rechten Auge hatte er eine kleine Narbe. Am ungewöhnlichsten an ihm waren seine Finger. Kurz und kräftig, verbreiterten sie sich zu fast quadratischen Fingerkuppen hin, ideal zum Gitarrespielen.
Die Syracuse University verfügte über ein ausgezeichnetes Lehrangebot. Obwohl Lou durch große Teile davon einfach schlafwandelte, stürzte er sich doch in die Philosophie-, Musik- und Literaturkurse und tat sich dort auch hervor. In Musikinterpretation, Theorie und Komposition saugte er alles wie ein Schwamm auf und machte sogar vor Oper nicht Halt. Zuerst versuchte er, im Journalismus einzusteigen, ließ aber die Finger davon, als sein Lehrer ihm mitteilte, seine persönliche Meinung sei ohne Bedeutung. Dann vertiefte er sich in Philosophie. Er verschlang alles über die Existenzialisten, war besessen von Hegels quälender Dialektik und fühlte sich innig mit Furcht und Zittern von Kierkegaard verbunden. „Ich beschäftigte mich sehr mit Hegel, Sartre und Kierkegaard“, erinnert sich Reed. „Wenn man Kierkegaard ausgelesen hatte, fühlte man sich, als sei etwas Schreckliches geschehen – Furcht und Zittern. Genau da kam ich her.“ Er liebte auch Krafft-Ebing und die Dichter der Beat Generation, besonders Kerouac, Burroughs und Ginsberg. Um seinen Eindruck als Erstsemester abzurunden, ließ er sich stilistisch durch die draufgängerischen, gequälten Vorbilder eines James Dean, Marlon Brando und vor allem Lenny Bruce inspirieren.
Lou war sich bereits darüber im Klaren, dass er Rockmusiker und Schriftsteller werden wollte. Die reichhaltige Musikszene der Universität bestand aus einem vielfältigen Gemisch aus Talenten wie Garland Jeffreys, einem zukünftigen Songschreiber und Weggefährten Reeds, der zwei Jahre jünger war als Lou; Nelson Slater, für den Lou später ein Album produzieren sollte; Felix Cavaliere, dem zukünftigen Bandleader der Young Rascals; Mike Esposito, der die Blues Magoos und Blues Project formieren sollte; und Peter Stampfel, einem frühen Mitglied der Holy Modal Rounders, der ein Pionier der Folkmusik werden sollte. Während die Colleges in New York und Boston Folksänger in der Art von Bob Dylan hervorbrachten, kamen aus Syracuse eher die Vorläufer der Punkrocker.
Musikalisch entscheidend für Lou war, dass er in Syracuse auf einen anderen Gitarristen namens Sterling Morrison stieß; er kam aus Bayport, Long Island, und hatte einen ähnlichen (sozialen) Hintergrund wie Lou. Kurz nachdem Lou aus dem R. O. T. C. hinausflog, besuchte Sterling, der niemals in Syracuse immatrikuliert war, sondern nur ab und zu dort herumhing, Jim Tucker, der ein Stockwerk unter Lou wohnte. Während Morrison eines Nachmittags aus Tuckers Fenster starrte und den R.-O.-T.-C.-Kadetten beim Marsch über den Hof zusah, hörte er plötzlich „ohrenbetäubende Dudelsackmusik“ aus irgendeiner Anlage schallen. Danach „warf sich jemand die Gitarre um und schlug ein paar quietschende Akkorde aus ihr heraus“. Aufgeregt dachte Morrison: „Oh, über uns wohnt ein Gitarrist“, und sofort begann er Tucker zu bedrängen, ihn vorzustellen. Als sie sich schließlich am nächsten Tag um drei Uhr morgens trafen, stellten Lou und Sterling fest, dass sie eine gemeinsame Vorliebe für schwarze Musik und Rock ’n’ Roll hatten. Beide verehrten auch Ike und Tina Turner. „Damals kannte sie noch kein Mensch“, erinnert sich Morrison. „Syracuse war sehr konservativ. Da gab es kaum mehr als eine Hand voll Verrückter.“
Glücklicherweise war für diese Hand voll das Geschehen im Bereich Drama, Dichtung und Literatur genauso anregend wie im Bereich Musik. Bald verbrachte Lou einen Großteil seiner Zeit mit Gitarrespielen, Lesen oder Schreiben, oder er war in lange Diskussionen mit gleich Gesinnten verstrickt. Viele dieser ausgedehnten Unterhaltungen über Philosophie und Literatur fanden in Bars und Coffee Shops statt, in denen er und seine Freunde sich bald heimisch fühlten. Jedes Restaurant war Hauptsitz einer bestimmten Gruppierung. Lous Clique schlug ihre Zelte im Savoy Coffee Shop auf, dessen Besitzer ein liebenswerter alter Mann namens Gus Josephs war. Gus hätte direkt aus der Fernsehserie Happy Days stammen können. Nachts tranken sie in der Orange Bar, die vornehmlich von intellektuellen Studenten besucht wurde. Lou zufolge ging er zwei Schritte vor das College, und da war eine Bar. „Es war die Welt von Kant und Kierkegaard und metaphysischer Polemik, die bis in die Nacht hinein dauerte“, erinnert er sich. „Ich ging oft allein und trank auf alles, was in der Woche schief gegangen war.“ Er hatte sich daran gewöhnt, verschreibungspflichtige Medikamente zu nehmen und Marihuana zu rauchen, hatte aber noch nicht viel mit harten Drogen zu tun. Wenn es hoch kam, trank er einmal einen Scotch und ein Bier.
Das Leben der Erstsemester verlief nach Regeln, die für die männlichen Studenten viel vorteilhafter waren als für die weiblichen. Während die Mädchen in ihren Zimmern auf dem Mount Olympus um neun Uhr abends eingeschlossen wurden und bei Missachtung der Sperrstunde einen sofortigen Hinauswurf riskierten, war es den männlichen Studenten, die keine Sperrstunde hatten, möglich, in der Nacht ein Leben zu führen, das sich vom Universitätsalltag abhob. Sie erforschten die Stadt, tranken in der Orange Bar oder in den Verbindungshäusern und gerieten in alle möglichen Schwierigkeiten. Lou, der die Angewohnheit entwickelt hatte, die Nächte mit Lesen, Schreiben und Musizieren zu verbringen, verlor selbstverständlich keine Zeit damit, seine neue Umgebung kennen zu lernen. Er sah sich kurz in Syracuse um und entdeckte im nahe gelegenen Ghetto der Schwarzen einen Klub namens The 800, wo funky Jazz und R & B gespielt wurde. Außerdem gab es hier eine Szene, die sich nur um Drogen, Musik und Gefahr drehte, was Lous Wunsch, die dunklen Seiten des Lebens kennen zu lernen, entgegenkam.
Lous erste Freundin am College hieß Judy Abdullah; er nannte sie „die Araberin“. Vielleicht nahm er sie eher als exotisches Objekt denn als Person wahr. Judy brachte einen sonderbaren Zug in Lous Sexualität zum Vorschein: es stellte sich heraus, dass er auf „vollschlanke“ Frauen stand. Judy Abdullah war zweimal so breit wie er. Sie war eine leidenschaftliche Frau, und die beiden verstanden sich großartig im Bett, aber zumindest eine Bekannte fügte Reeds Persönlichkeit eine weitere Nuance hinzu, indem sie darauf hinwies, dass Lous Schwäche für dicke Frauen ebenso Herausforderung wie Fluchtmöglichkeit darstellte. Lou konnte die Einstellung haben, dass er ihr gegenüber keine ernsthaften Verpflichtungen hatte und sie auch sexuell nicht befriedigen musste. Die Beziehung verlief im Sand, bevor das Jahr zu Ende war. Lou, der keine Zeit mit Verabredungen vergeuden wollte, konnte ziemlich unangenehm werden, und er war gemein zu Judy. Als es mit den beiden auseinander ging, hatte sie allen Grund dazu, von ihm die Nase restlos voll zu haben. Trotz allem blieben sie in Kontakt, und Lou traf sich während seiner Collegezeit noch gelegentlich mit ihr. In Syracuse stellte sich Lou als gequälter, introspektiver, romantischer Dichter dar.
Getreu dem Glaubenssatz, dass der erste Schritt, ein Dichter zu werden, darin besteht, wie einer auszusehen, lag Lou viel daran, den Eindruck zu erwecken, er sei ungewaschen, obwohl das nicht stimmte. Ein Freund berichtete: „Er ging niemals aus, ohne vorher zu duschen.“ Was seine Kleidung anbelangte, saß er zwischen zwei Stühlen: einerseits Teenager aus der Vorstadt mit Mokassins und Button-down-Hemd, andererseits verknitterte Arbeitskleidung und das grobe Hemd des Kerouac-Rebellen. Beobachter erinnern sich an einen eher molligen und engelhaften als dünnen und asketischen Jungen. Tatsache ist, dass er sich nicht ungewöhnlich anzog. Falls man überhaupt etwas dazu sagen kann, dann höchstens, dass er sich unauffällig kleidete und monatelang in den gleichen Jeans herumrannte. In seinem Auftreten kopierte Lou die überdrehte Attitüde des jungen Rimbaud. Er war gerade dabei, die Legende von seinen Elektroschockbehandlungen zu verbreiten, und ließ die gesamte, von James Dean inspirierte „Ich habe so viel gelitten, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin“-Routinenummer anlaufen.
Ein Student, der gelegentlich gemeinsam mit ihm improvisierte, erinnert sich: „Ein Teil seiner Ausstrahlung beruhte darauf, dass er eine geistig gestörte Person war und in seiner Jugend Elektroschocks bekommen hatte, die deutliche Auswirkungen auf ihn gehabt hatten. Wer wusste schon, wo sich da Realität und Fantasie überschnitten?“ Für einen sarkastischen Jungen mit vorstehenden Zähnen, Zahnspange und der Garderobe eines Langweilers war Lou gar nicht so schlecht darin, sich selbst nach und nach als einen total perversen Psychokrüppel darzustellen. Was er auch immer mit seiner Kleidung, seinem Verhalten und seinen Meinungen zum Ausdruck bringen wollte, um hip zu sein, es gab ein albtraumhaftes Detail an seinem Äußeren, dem er sich niemals richtig gewachsen fühlte – seine Haare. Der krause Haarschopf quälte ihn, seit er als Zwölfjähriger zum ersten Mal mit nachhaltigem Interesse in den Spiegel geschaut hatte. Es war, als starrte während seiner ganzen Jugendzeit eine jüdische Version von Alfred E. Neumann daraus hervor, dem Coverstar der Mad-Hefte.
Seit Amerika eine ziemlich antisemitische Nation geworden war, betrachtete man den jüdischen „Afro“ als unangenehmes, ethnisches Merkmal. Bob Dylan änderte dann im Alleingang Anfang der Sechzigerjahre die Einstellung dazu, wie jemand auszusehen hatte, der hip ist. Und obwohl die Filmindustrie und medienwirksame Gestalten wie Allen Ginsberg dazu beitrugen, den jüdischen Mann in irgendetwas Ultraschickes zu verwandeln, hatte doch niemand einen so weit reichenden Einfluss wie Bob Dylan. Wie Ginsberg es seinem Biografen Barry Miles erklärt, sorgte Dylan dafür – speziell in seinem 1965er-Bringing It All Back Home-Look –, dass die Hakennase und das krause Haar zum Kennzeichen der modernen, intellektuellen Avantgarde wurden. Zu der Zeit, als Lou ins College kam und damit begann, sich als Lou Reed neu zu erschaffen, beschloss er jedenfalls, etwas gegen sein krauses Haar zu tun. Erst 1966 würde er als der Lou Reed auftauchen, der als schärfster Konkurrent von Dylan für den Titel des hippsten jüdischen Rockstars ins Rennen ging. In Syracuse entdeckte er im schwarzen Wohnviertel einen Laden, der sich auf Haarbehandlung spezialisiert hatte, und ließ sich hier mehrmals die Haare glätten. Diese Behandlungen hielten aber nie lange genug vor, um das Problem dauerhaft zu beseitigen, und so verfeinerte Lou den ursprünglichen Stil, indem er es entweder so kurz trug, dass keine biblischen Löckchen zu sehen waren, oder so lang, dass man ihn für leicht verrückt hielt.
Genau wie seine britischen Gegenstücke Keith Richards von den Rolling Stones oder John Lennon von den Beatles verwarf auch Lou alles, was vor der Atombombe stattgefunden hatte, und orientierte sich bei seiner Selbsterschaffung ausschließlich an seinen eigenen Idolen. Das fiel Lou nicht schwer, behauptete er doch immer, er habe acht verschiedene Persönlichkeiten. Als handle es sich um Rollen in einem Drehbuch, verlieh er diesen Persönlichkeiten bestimmte Eigenschaften und kleidete sie in bestimmte Kostüme. Sie waren für seine Selbstdarstellung genauso wichtig wie die ersten kreativen Freunde, mit denen er in Syracuse zusammen herumhing.
An erster Stelle kam hiebei Lenny Bruce. Obwohl ihn kurze Zeit später durch seine ständigen Zusammenstöße mit der Polizei ein schlimmes Schicksal erwartete, stand Bruce 1962 auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In den Augen des Publikums war er der Größte, der amerikanische Dichter und Philosoph mit der schnellsten Zunge, die man sich vorstellen konnte. Bruce würzte seine Auftritte – eine Art Will Rogers auf schnellem Vorlauf – dadurch, dass er sich pures, flüssiges Methamphetamin-Hydrochlorid injizierte, das später einmal auch Lous bevorzugte Droge werden sollte. Viele von Reeds Manierismen, zum Beispiel einige seiner Gesten, die Art, wie er am Telefon antwortete, sowie bestimmte Intonationen und Rhythmen beim Sprechen gingen direkt auf Bruce zurück.
Was die anderen Medienidole Lous anbelangte, so genügte es, sich eine Reihe von Porträtaufnahmen der Stars jener Epoche anzusehen, und man konnte erkennen, wen Lou zu gegebener Zeit als Inspirationsquelle benutzte: Frank Sinatra, Jerry Lewis in The Bellboy, Montgomery Clift und William Burroughs, um nur einige der Offensichtlicheren zu nennen. Tatsächlich gehörte zu Lous sympathischen Zügen die Art und Weise, wie er seine Helden schätzte und verehrte. Zum Beispiel versuchte er immer, Hyman, der ein konservativer Jurastudent war und dessen Lebensweg in die entgegengesetzte Richtung von Lous führen würde, dazu zu überreden, Kerouac zu lesen, um dann mit ihm darüber zu diskutieren. Lou war begeistert davon, Leute mit neuer Musik, neuen Szenen oder neuen Menschen zusammenzubringen.
Eine Menge künstlerisch orientierter Jugendlicher, die Syracuse besucht haben, erinnern sich voller Verachtung an das College als eine reine Football-Schule, dominiert von den „verdammten“ Orangemen. Tatsächlich war es jedoch so, dass in der Umbruchperiode zwischen dem Ende der McCarthy-Ära und Kennedys Tod eine Welle der Liberalisierung durch die Colleges im Lande ging. In Syracuse lebten und gediehen viele verschiedene Gruppierungen. Sicherlich dominierten die Verbindungen noch immer den amerikanischen Campus, und die Mehrheit der männlichen und weiblichen Studenten trat den Bruder- oder Schwesternschaften mit der Gehorsamkeit von Schafen bei. Auf jeden Fall bestand ein tiefer kultureller Graben zwischen den jüdischen und den nichtjüdischen Verbindungen. Die jüdischen Bruderschaften waren zumeist moderner, neuen Entwicklungen und einer neuen Art zu leben gegenüber aufgeschlossener. Obwohl er Sigma Alpha Mu völlig ablehnte und sich vor allem einer kunstorientierten, intellektuellen Gruppe anschloss, deren Mitglieder teilweise sogar außerhalb der Universität lebten, blieb Lou doch immer mit Hyman befreundet und wurde sogar von den Sammies als Maskottchen adoptiert, sozusagen als der Hofnarr. Sie wollten jemanden, dem es bereits im ersten Semester gelungen war, sich einen Ruf als besonders launenhafte und düstere Persönlichkeit zu verschaffen, nicht völlig außer Acht lassen. Aus den jüdischen Bruderschaften in ganz Amerika rekrutierte sich während Lous gesamter Karriere ein besonders empfänglicher Teil seiner Fangemeinde.
Am Ende des ersten Semesters, so einer der Sammies, unterschied sich Lou besonders durch seine Originalität und Sturheit von allen anderen Studenten, „die ich kannte. Er tickte nach seinem eigenen Rhythmus. Er war schon dafür, irgendetwas für Leute zu tun, aber immer auf seine Art. Er hätte sich niemals so gekleidet oder verhalten, um jemandem zu gefallen. Lou hatte einen unglaublich beißenden, trockenen Humor, er liebte witzige Dinge. Er verstellte sich oft. Oder er verhielt sich sehr provozierend. Er wollte einfach anders sein. Lou war ein lustiger Typ, in einem besonders trockenen, witzigen Sinn. Bestimmt keiner von den Komödianten, über die man sich lustig macht. Er machte sich niemals über etwas lustig, sondern sah den Witz in den Dingen selbst – das Banale und das Gewöhnliche. Alles, was er tat, war unterschwellig vernünftig. Er war immer etwas durchgedreht, aber das lag an seiner Schizophrenie.“
Was Lou dringend brauchte, war jemand, dem er seine Ideen anvertrauen konnte und der ihn seinerseits inspirierte. Wie durch ein Wunder fand er diesen Menschen in der zweiten goldenen Periode seines Lebens (die erste goldene Periode war die Entdeckung der Rockmusik). Lincoln Swados, brillant, exzentrisch, talentiert, gequält und einem harten Schicksal entgegenschreitend, wurde Lous erster enger Freund, indem er sich wieder erkennen konnte und mit dem er zusammenarbeitete. Die beiden teilten sich in Lous zweitem Jahr an der Uni ein Zimmer. Swados kam aus einer aufsteigenden, sehr jüdischen Mittelschichtfamilie aus dem nördlichen Teil des Bundesstaates New York. Genau wie Lou hatte auch er eine kleine Schwester namens Elizabeth, in die er ebenfalls vernarrt war (und mit der er sich, auch hierin Lou ähnlich, zum Teil identifizierte). Wie Gefangene in einem sibirischen Arbeitslager, die nach Jahren der Einsamkeit endlich einen Kameraden und Seelenbruder gefunden haben, fielen sich die beiden in die Arme. Um die Sache perfekt zu machen – jedenfalls nach Lous Ansicht –, wollte Lincoln ebenfalls Schriftsteller werden (er arbeitete an einem endlosen Roman im Stil Dostojewskis); sein Lieblingssänger war Frank Sinatra; Lincolns Zimmerhälfte sah noch wüster aus als Lous, und – das gab den Ausschlag – er litt unter Platzangst. Er verkroch sich die meiste Zeit in ihrem Zimmer im Erdgeschoss und hing dort über seinem Schreibtisch, der wie ein Schlachtfeld aussah; oder er hörte Platten von Frank Sinatra und diskutierte mit Lou. Wenn Lou jemanden brauchte, dem er seine neuen Lieder vorspielen oder seine Gedichte und Geschichten vorlesen konnte, so war Lincoln immer zur Stelle. Seit Beaumont und Fletcher hatte es keine Schriftsteller gegeben, die so gut zusammenarbeiten konnten.
Einer der hervorstechendsten Charakterzüge Lous bestand in dem Bedürfnis, alles um ihn herum zu kontrollieren, immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und insgesamt die markanteste Persönlichkeit aller Anwesenden darzustellen. Auch hier erwies sich Lincoln als der perfekte Partner, denn wenn Lou von der Angst verfolgt wurde, noch nicht der hippste Mann der Welt zu sein, so hatte Lincoln sicherlich keinerlei Ambitionen auf diesen Titel. Meistens trug er eine Hose, die irgendwo oberhalb des Knöchels endete und etwa in Brusthöhe gegürtet war. Das Kurzarmhemd, das er für gewöhnlich trug, passte grundsätzlich nicht dazu. Aus einem leichenhaften Gesicht starrten stark hervortretende Augen, die auch Caryl Chessman auf dem elektrischen Stuhl wie einen übermüdeten Junkie aussehen ließen, und schmutziges, ungekämmtes Haar umkränzte seinen Kopf. Lincolns Körper befand sich in dem gleichen Auflösungszustand wie seine Gedanken. Nur höchst selten badete er oder putzte sich die Zähne, und der Geruch, den er manchmal ausströmte, machte jeden engen körperlichen Kontakt unmöglich. Das Bild wurde durch ein etwas geisterhaftes Lächeln vervollständigt, das einem aufmerksamen Beobachter wie Lou verraten musste, wie weit sich Lincoln bereits von der Realität entfernt hatte.
Ihr gemeinsames Zimmer war eingerichtet wie eine karge Dichterklause, die Kafkas Vorstellungswelt entsprungen zu sein schien. Auf dem grün gestrichenen Betonboden standen zwei schwarze, eiserne Bettgestelle, identische Tische und ramponierte Stühle; die Beleuchtung bestand aus einer kümmerlichen, kalt leuchtenden Glühbirne. Für die Verzweiflung und den Ehrgeiz der beiden Brüder im Geiste hätte man kein besseres Symbol finden können als diesen Raum. Beide verachteten die Welt ihrer Eltern, der sie nun zumindest zeitweise entkommen waren. Beide hatten die Absicht, diese Welt und ihre Wertvorstellungen zu zerstören, indem sie etwas schrieben, das genauso beißend und zerstörerisch war wie Burroughs’ Naked Lunch, das dieser in Tanger auf der kampferprobten Tastatur seiner Schreibmaschine in das Papier hineingefräst hatte. Dieses Zimmer wurde ihr geistiges Waffenlager, ihr Hauptquartier, ihre Höhle des Wissens und der Gelehrsamkeit, ihr Flugkörper für die Reise ins Unbekannte. Nach und nach übernahm Lou fast das gesamte lincolnsche Repertoire an Gesten, Gedanken und Gewohnheiten. Später gestand er: „Ich beobachte die Leute, die ich kenne, ganz genau, und wenn ich denke, dass ich alles verstanden habe, gehe ich weg und schreibe einen Song darüber. Und wenn ich ihn dann singe, verwandle ich mich in diese Menschen. Deswegen bin ich auch leer, wenn ich nichts tue. Ich habe keine eigene Persönlichkeit, ich leihe mir immer die Persönlichkeit der anderen.“
Er hatte nun sein männliches Gegenstück gefunden, aber um seine männliche und seine weibliche Seite im Gleichgewicht zu halten, benötigte Lou noch eine Freundin. Er erblickte sie, nachdem er eine Woche lang mit Swados zusammenwohnte; sie saß auf dem Vordersitz eines Autos neben einem blonden Footballspieler, der der anderen jüdischen Verbindung des College angehörte. Die beiden fuhren die Marshall Street hinunter, und ihr Begleiter erkannte Reed sofort als den ortsansässigen heiligen Narren. In dem Wunsch, seine Begleiterin, die atemberaubend schöne Shelley Albin aus dem mittleren Westen und frisch am College eingetroffen, zu amüsieren, hielt er an und sagte lachend: „Das ist Lou! Er ist sehr schockierend und böse!“ Er bot dem „verrückten“ Lou an, mitzufahren. Wie sich später herausstellen sollte, war das ein schwerer Fehler.
Obwohl keineswegs so schwierig und verdreht wie Lincoln Swados, war Shelley ein genauso guter Partner für Lou wie sein Zimmergenosse. Shelley war in Wisconsin aufgewachsen und hatte dort das frustrierende Leben eines Beatnik-Wildfangs geführt. Sie war nach Syracuse gekommen, weil es das einzige College war, auf das ihre Eltern sie gehen ließen. Zusammen mit einer Jugendfreundin hatte sie sich auf ihr neues Leben vorbereitet, indem sie beschloss, sich an die Anforderungen des College und der hiesigen Kultur anzupassen. Sie verwarf die Jeans und Arbeitshemden, die sie zuhause getragen hatte, und kleidete sich nun in knielange Röcke und geschmackvolle Blusen, zu denen sie eine Perlenkette trug, so wie alle Mädchen in den Jahrbuchfotos dieser Zeit. Als Lou – begierig darauf, sie kennen zu lernen – auf den Rücksitz des Autos sprang, krümmte sie sich vor Unbehagen über ihre spießige, uniformierte Kleidung und die pausenlosen dümmlichen Kommentare ihres Begleiters. Sie erinnert sich an Lous schmale Hüften, sein kindliches Gesicht, die verräterischen Augen und wusste sofort: „In dem Moment, als er einstieg, war klar, dass wir zusammen ausgehen würden.“ Sie wusste auch, dass sie eine impulsive Entscheidung traf und dass es mit Lou sicher jede Menge Ärger geben würde; doch es würde auch niemals langweilig sein. „Es war so eine Erleichterung, Lou zu treffen, weil er für mich einen normalen Menschen darstellte. Ich war so fasziniert von diesem ganzen düsteren Mist.“
Dieses Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Sobald die beiden Lou vor seinem Wohnheim abgesetzt hatten, stürmte er in sein Zimmer und berichtete Swados atemlos davon, dass er gerade das schönste Mädchen der Welt getroffen habe und sie sofort anrufen müsse.
Lincoln nahm manchmal bei völlig unpassenden Gelegenheiten eine sonderbar väterliche Haltung ein. Er sah sich dann in der Rolle desjenigen, der Lou sicher durch seine stürmischen Launen hindurchnavigierte, und versetzte Lous Plänen einen Dämpfer, indem er ihm erklärte, er, Lincoln, habe dieses Mädchen auch gesehen und betrachte sie als seinen Besitz, obwohl er sich noch nicht mit ihr getroffen habe.
Lou seinerseits sah seine Aufgabe in ihrer Freundschaft darin, den ständig angespannten und überaktiven Swados ruhig zu stellen. Er dachte also darüber nach, dass der unattraktive Lincoln, der in seinem ersten Jahr keine einzige Verabredung zustande gebracht hatte, durch eine Abfuhr, die Shelley ihm todsicher erteilen würde, nur unnütz verletzt werden würde; so verlor Lou keine Zeit und bootete ihn direkt aus, indem er Shelley sofort anrief und sich mit ihr verabredete. Auf diese Weise, so sagte sich Lou, kam Swados zumindest in das Vergnügen ihrer Gesellschaft.
Shelley Albin wurde Lous Freundin während seines zweiten und des folgenden Jahres am College – „Meine Bergspitze, mein Gipfel“, wie er sie später beschrieb – und blieb auch lange Jahre danach für ihn so etwas wie seine Muse. „Lou und ich kamen uns sehr nahe, aber wir waren noch zu jung, um es wirklich in Worte fassen zu können“, sagt Shelley. „Von Anfang an bestand eine sehr starke Bindung zwischen uns. Ohne ihn genau zu kennen, wusste ich alles von ihm. Am stärksten ist mir Lou als eine Art byronesker Charakter in Erinnerung geblieben, als ein sehr anziehender junger Mann. Er war interessant, nicht einer von diesen leeren, roboterhaften Menschen, er war sehr poetisch. Lou war wie Zuckerwatte, ein richtig süßer Schatz.“ Trotz seines exzentrischen Auftretens fand Shelley ihn „sehr geradlinig. Er wusste, was er wollte, war ein guter Tänzer und ein guter Tennisspieler. Seine Ansprüche an das Leben waren auch sehr klar. Er war ein Junge der Fünfziger, der Herr des Hauses, der liebe Gott. Er wollte eine Barbiepuppe als Frau, die ihm Schinken briet, wenn er Schinken haben wollte. Ich war sehr unterwürfig und naiv, und das gefiel ihm.“
Aber Lou hatte auch seine „verrückten“ Seiten, die er manchmal voll ausspielte. Wie viele aufgeweckte Jugendliche, die gerade Kierkegaard und Camus entdeckt hatten, war er der klassische, künstlerisch begabte „bad boy“. Zwischen offen und Angst einflößend hin- und herpendelnd, schwelgte Lou in beidem. „Ein Teil von Lou blieb für immer fünfzehn, ein anderer Teil war schon hundert Jahre alt“, erinnert sich Shelley liebevoll. Glücklicherweise mochte sie beide Seiten von Lou. Als sie anfing, mit Lou auszugehen, tauschte sie ihren Rock und die Perlenkette gegen Jeans und trug ihr Haar wieder lang und glatt statt dauergewellt. Der Junge, den sie wegen Lou fallen ließ, tadelte ihre Verwandlung mit den Worten: „Du gehst vor die Hunde, du bist ein Beatnik, Lou hat dich ruiniert!“ Dabei hatte Shelley, die Kunst studierte, nur zu sich selbst zurückgefunden. Der Vorwurf machte ihr jedoch Spaß, denn sie wusste, wie sehr es Lou mochte, wenn ihn die Leute beschuldigten, sie zu verderben; es verlieh seinem schlechten Ruf noch mehr Glaubwürdigkeit. Shelley war auch ungewöhnlich hübsch, und bis heute erinnern sich sämtliche Lehrer und Freunde von Lou vor allem daran, dass er „eine überwältigende, tolle Freundin hatte, die außerdem sehr, sehr nett war“.
Shelley Albins Gesicht war einzigartig. Wenn man sie direkt anschaute, so fielen vor allem ihre Augen auf. Ein inneres Licht schien in ihnen zu schimmern. Ihr Nase war gerade und vollkommen. Wangen und Kinn waren so fein gemeißelt, dass sie das Modell vieler Kunststudenten in Syracuse war. Ihr Gesicht war offen und geheimnisvoll zugleich. Ihr Mund sagte „Ja“. Aber ihre Augen hatten einen wie von Modigliani gemalten, madonnenhaften Ausdruck, der alle auf Distanz hielt. Ihr hellbraunes Haar leuchtete auf ihrer blassen, kremfarbenen Haut und verlieh dieser manchmal einen rötlichen Ton. Sie wog einhundertfünfzehn Pfund, war mit 1,68 Meter fast genauso groß wie Lou und konnte seine Kleider tragen. Tatsächlich fühlte sie sich ihm körperlich so ebenbürtig, dass sie sicher war, ihm bei Handgreiflichkeiten nicht unterlegen zu sein.
„Wir waren vom ersten Moment an geistig und körperlich unzertrennlich“, erinnert sich Shelley. „Wir waren ineinander verschlungen wie eine Brezel.“ Bald konnte man die innige Beziehung von Shelley und Lou im Savoy bewundern, wo die beiden öffentlich stundenlang herumknutschten. „Er küsste wirklich gut, alles war im Einklang. Und er war wirklich ein Meister im Slow-Dance. Als wir uns trafen, fühlten wir uns wie Freunde, die sich nach langer Trennung wieder gefunden hatten.“ Für beide war es die erste echte Liebesgeschichte. Sie entdeckten schnell, dass sie auch außerhalb der Wohnheime etwas gemeinsam unternehmen konnten. Sie spielten Basketball und Tennis zusammen. Sie hatten eine tolle sexuelle Beziehung. Schrieb Lou ein Gedicht oder eine Geschichte, so ertappte sich Shelley dabei, wie sie fast automatisch die ideale Illustration dafür zeichnete. In ihrer früheren Jugend war sie zu einem Psychiater geschickt worden, weil sie sich drei Jahre lang geweigert hatte, mit ihrem Vater ein Wort zu wechseln. Zwei Jahre später schrieb Lou das Lied „I’ll Be Your Mirror“ über Shelley. Sie war wirklich sein Spiegel. Ebenso wie er hatte auch sie eine Schwesternschaft besucht und – zu Lous Entzücken – den Schwestern eine Stunde nach ihrer Aufnahme gesagt, sie sollten zur Hölle fahren. „Er war geistig noch sehr mit der Elektroschockbehandlung beschäftigt, als wir uns kennen lernten“, sagt Shelley. „Er wies mich sofort darauf hin, dass er launenhaft, unberechenbar und gefährlich war und dass er jede Situation kontrollierte, indem er dafür sorgte, dass alle total nervös wurden. Es war ein reiner Nervenkrieg. Aber ich verstand mich auch auf dieses Spiel, deswegen kamen wir gut klar.
Was mir wirklich an Lou gefiel, war, dass er bis an die Grenzen ging. Das faszinierte mich an ihm. Dass ich mich ihm unterordnete, war mein Geschenk an ihn, aber er kontrollierte mich keineswegs, und ich hätte ihn jederzeit verprügeln können. Wenn man zurückblickt und darüber nachdenkt, wer das Sagen in der Beziehung hatte, dann wird sich herausstellen, dass er es nicht war.“
Häufig zieht das Erscheinen einer umwerfenden Frau eine gewisse Abkühlung in der Beziehung zweier Freunde nach sich. Auch Kerouac und sein Freund Neal Cassady hatten das, vorbildhaft für eine ganze nachfolgende Beat Generation, am eigenen Leib erfahren; dennoch hatte Lou ganz recht mit seiner Vermutung gehabt, dass Shelley die Beziehung zwischen ihm und Lincoln eher vertiefen würde. Die Freundschaft der drei wurde so eng, dass Lou gelegentlich spaßeshalber vorschlug, Shelley solle auch einige Zeit mit Lincoln im Bett verbringen. Ihre Beziehung ähnelte der Konstellation in dem damaligen Erfolgsfilm … denn sie wissen nicht, was sie tun – Lou als James Dean, Shelley als Natalie Wood und Lincoln als unglücklicher Sal Mineo.
Lou stellte Shelley Lincoln als eine wichtige, aber zart besaitete Person vor, die man bemuttern musste. Lincoln war sehr hausbacken, aber Shelley sah ihn – wie in einer anmutig bewegten Vision – „als Fred Astaire; Lincoln war immer sorglos, er konnte sich wunderbare Geschichten ausdenken, und ich denke, Lou war davon fasziniert. Lou fühlte sich Lincoln gegenüber verantwortlich, er beschützte ihn, denn niemand wollte etwas mit Lincoln zu tun haben, aber wir mochten ihn gern.“ Das Erste, was Lou zu Shelley sagte, war: „Lincoln ist scharf auf dich, und wenn ich ein netter Kerl wäre, würde ich zusehen, dass er dich bekommt, denn ich kann jede haben und Lincoln nicht. Lincoln liebt dich, aber er wird dich nicht bekommen, weil ich dich will.“ Shelley stellte fest, dass viel von Lous Charme und viele seiner Gesten direkt von Lincoln stammten. „Vieles, was ich an Lou liebte, hatte er von Lincoln. In vielerlei Hinsicht war Lincoln wie Jiminy Cricket, er stand sozusagen auf Lous Schulter und flüsterte ihm ins Ohr. Die beiden passten auf mich auf, zeigten mir, wo’s langging, und kümmerten sich um meine Erziehung.“
Das Wichtigste an Lincoln und Shelley waren das Verständnis und Einfühlungsvermögen, das sie Lous Talent und seiner Persönlichkeit entgegenbrachten. Dabei war Lincoln der eindimensionale Spiegel und Shelley der multidimensionale Reflektor, der viele verschiedene Seiten von Lou aufzeigte. Sie war eine aufmerksame, intuitive Persönlichkeit und verstand, dass Lou die Dinge, die um ihn herum vorgingen, auf vielen verschiedenen Ebenen wahrnahm und sie häufig anders interpretierte als andere Menschen. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Lou zwei Freunde gefunden, denen er sich öffnen konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass sie ihn lächerlich machten oder ihn durch den Kakao zogen. Für jemand, der so von anderen abhängig war, um sich zu vervollständigen, waren die beiden wichtige Verbündete.
Zu Beginn war Lous erste Liebesgeschichte idyllisch. Er stand selten vor Mittag auf, weil er die ganze Nacht über aufblieb. Er traf sich manchmal mit Shelley auf den verschneiten Stufen, die zu ihrem Wohnheim führten. Oder sie machte sich am frühen Nachmittag auf den Weg und trampte die zwanzig Minuten von ihrem Wohnheim zu dem Viertel, in dem Lou und Lincoln wohnten. Wie allen Studentinnen von Syracuse drohte ihr der sofortige Hinauswurf, wenn sie ein Männerwohnheim betrat; sie klopfte also nur an das Fenster des im Souterrain liegenden Zimmers und wartete darauf, dass Lou auftauchte. Und wenn er dann kam, bot sich ihm ein Blick auf seine Freundin, den er besonders schätzte: Er sah zu ihr hinauf und sie, das Gesicht von den langen Haaren und einem Schal umrahmt, blickte lächelnd zu ihm hinunter. „Ich mochte es, so von oben in ihre Höhle hineinzusehen“, erinnert sie sich. „Es war eine Art Niemandsland. Ich stand gern draußen. Meine Freiheit war mir wichtig. Und Lou fand es gut, dass ich jede Nacht in mein Wohnheim zurückkehren musste.“ Von dort brachen die drei ins Savoy auf, wo sie mit dem Kunststudenten Karl Stoecker, einem Freund von Shelley und dem Anglistikstudenten Peter Locke, mit dem Lou immer noch befreundet ist, zusammentrafen. Jim Tucker, Sterling Morrison und eine Menge anderer Leute trudelten auch so nach und nach ein, und sie verbrachten den Rest des Tages miteinander, hauptsächlich, indem sie schrieben, redeten, diskutierten, knutschten, Gitarre spielten und zeichneten. Lou war damit beschäftigt, akustische Gitarre zu spielen oder Folksongs zu schreiben. Der Rest der Zeit wurde mit Schlafen oder einem gelegentlichen Besuch des Unterrichts verbracht. Wenn es den dreien im Savoy langweilig wurde, gingen sie zu dem schrillen Corner Bookstore um die Ecke oder in die Orange Bar. Aber sie kamen immer wieder zurück zu ihrem Hauptsitz im Savoy und dem sympathischen Eigentümer, Gus Joseph, der seit fünfzig Jahren die Studenten kommen und gehen sieht und sich trotzdem noch an Lou als an jemand Besonderen erinnert.
Lou war so verliebt in Shelley, dass er im Herbst 1961 beschloss, sie zu den Weihnachts- beziehungsweise jüdischen Chanukkaferien nach Freeport mitzunehmen. Shelley war sich darüber im Klaren, dass Lou die Ursachen für seine rebellische Haltung in seiner schwierigen Kindheit sah, und so begriff sie, dass es nicht einfach für ihn sein würde, sie nachhause mitzunehmen. Sie erinnert sich aber daran, dass Lou dachte, er könne damit Punkte bei seinen Eltern sammeln. „Es war schwer einzuschätzen. Er wollte seinem Vater zeigen, dass er in Ordnung war. Er wusste, sie würden mich mögen. Ich habe den Verdacht, dass er in mancher Hinsicht seinen Eltern doch gefallen wollte und dass ihm daran gelegen war, jemanden nachhause mitzubringen, den sie akzeptieren würden.“
Zu ihrer Überraschung wurde Shelley von Lous Eltern in Freeport mit offenen Armen empfangen. Sie fühlte sich dort sehr wohl und herzlich aufgenommen. Lou hatte ihr stark den Eindruck vermittelt, dass seine Mutter ihn nicht liebte, aber Shelley sah das anders; sie empfand Toby Reed als eine warmherzige, wunderbare Frau, die alles andere als selbstsüchtig war. Und Sidney Reed, von Lou als kaltherziger Prinzipienreiter dargestellt, schien ihr ein liebender Vater zu sein. Beide waren genau das Gegenteil dessen, was Lou beschrieben hatte. Sie hatte den Eindruck, Mr. Reed „wäre für seinen Sohn über glühende Kohlen gelaufen“.
Gleichzeitig erkannte Shelley, dass Lou seinen Eltern sehr ähnlich war. Er sah nicht nur genauso aus, sondern besaß auch all ihre guten Eigenschaften. Als sie jedoch den Fehler beging, ihm ihren positiven Eindruck zu vermitteln, indem sie auf das sympathische Zwinkern in den Augen von Mr. Reed und dessen trockenen Humor, den auch Lou besaß, hinwies, blaffte ihr Freund nur: „Hast du nicht kapiert, dass sie Mörder sind?!“
Nach einer schönen Woche bei den Reeds, die allerdings nicht ganz ohne Spannungen verlief, machte sich Shelley ihren eigenen Reim auf die widersprüchliche Geschichte. In diesem Kampf zwischen klugen Köpfen, der schon seit Jahren im Gang war, ging Lou in Angriffsstellung, sobald er über die Schwelle seines Elternhauses trat. Er versuchte auf jede denkbare Art, seine Eltern in Angst und Schrecken zu versetzen und zu paralysieren. Über ihren Häuptern schwebte die ständige Drohung, dass Lou jederzeit die Nerven verlieren, eine besonders gemeine Bemerkung machen oder das harmonische Gleichgewicht des Zusammenlebens durch eine irrationale Handlung zerstören konnte, und auf diese Weise hatte er gelernt, sie zu kontrollieren. Beispielsweise gab Mr. Reed Lou an einem Abend den Autoschlüssel und Geld, um mit Shelley nach New York zu fahren und essen zu gehen. Aber solch ein Austausch konnte zwischen Vater und Sohn nicht ohne einen – an Comics erinnernden – Kampf vor sich gehen. Als Lou mit Shelley auf die Eingangstür zusteuerte, musste sein Vater unbedingt noch die Bemerkung loswerden, dass er, da er nun auf dem Weg in die Stadt sei, vielleicht doch eventuell noch ein sauberes Hemd anziehen sollte. Auf der Stelle war Lou auf hundertachtzig, brachte seinen Vater dazu, sich wie eine Küchenschabe zu fühlen, und warf seiner Mutter einen bitterbösen Satz an den Kopf, bevor er türknallend hinausstürmte.
Ohne jede Rücksicht auf andere, brachte er sich und Shelley durch seinen ungestümen Fahrstil auf dem Weg nach New York fast ums Leben. „Ich weiß noch genau, wie er mich, die ahnungslose Prärierose aus dem mittleren Westen, in die Großstadt mitnahm“, erzählt Shelley. „Bei dieser Fahrt, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde, standen mir wirklich die Haare zu Berge. Lou zeigte mir, wie man sich auf das Heizgitter des Village Gate stellen konnte. Man konnte Musik hören und hatte es gleichzeitig warm.“
Seine Eltern, so erkannte sie, „wussten überhaupt nicht, was in ihm vorging, und sie waren sehr unglücklich und beunruhigt wegen all der schrecklichen Dinge, die er dachte. Er muss sich wirklich mies fühlen, der arme Junge, wie schrecklich!“ Ihr Verhältnis resultierte darin, dass seine Eltern ihm, um allen unschönen Situationen aus dem Weg zu gehen, jeden Wunsch von den Augen ablasen, als sei er der heimgekehrte, verlorene Sohn. Die einzige Person im Hause Reed, die von Lou mit einer gewissen Zuneigung bedacht wurde, war Elizabeth; sie selbst war ganz vernarrt in Lou und fand ihn toll.
In ihrer netten, gewandten, offenen Art standen die Reeds da wie die Lämmer auf der Weide und warteten darauf, dass Lou ihnen sein Brandmal aufdrückte. Dieses Ritual begann damit, dass Lou als Erstes seine Zuneigung zu dem schwarzen Schaf der Familie, einer gewissen Judy, bekundete. Kaum zur Tür hereingekommen, erkundigte sich Lou ungeduldig nach ihren Aktivitäten und ließ sich des Langen und Breiten darüber aus, dass er sie jedem anderen in der Familie vorziehe; dann brach seine Mutter häufig in Tränen aus. Anschließend machte sich Lou daran, die Aufmerksamkeit der zwölfjährigen Elizabeth für sich in Anspruch zu nehmen. Mit großem Brimborium zog er sich mit ihr zu einem regen Austausch von Vertraulichkeiten zurück, von dem seine Eltern selbstverständlich ausgeschlossen waren. „Sie war niedlich“, erinnert sich Shelley. „Sie sah aus wie Lou. Seine Mutter und sein Vater sahen auch so aus. Sie sahen alle genauso aus wie er. Es war zum Überschnappen. Lou fühlte sich ihr gegenüber als Beschützer. Und sie war so süß. Sie hatte nicht so viel Charakter wie Lou, aber sie war auch nicht langweilig.“ Alle seine Aktionen waren darauf gerichtet, seine Eltern gleichzeitig auszuschließen und sie zu seinen Gefangenen zu machen. Und wie alle Studenten, die ihre Eltern besuchten, war Lou auch damit beschäftigt, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, während er zuhause ein und aus ging, als befände er sich in einem Hotel. Sobald er alle im Haus so weit hatte, dass sie genau das taten, was er wollte, begann Lou, an seinem Aufenthalt Geschmack zu finden.
Bei diesem ersten Besuch war die Lage so extrem, dass Toby Reed Shelley, die in ihren Augen die perfekte Schwiegertochter war, ins Vertrauen zog. „Sie waren ziemlich besorgt darüber, was er nachhause bringen würde“, erinnert sie sich. „Und als sie mich sahen, dachten sie dann: ‚O Gott, vielleicht ist doch alles in Ordnung mit ihm.‘ Wir beide, sie und ich, haben festgestellt, dass wir ihn wirklich gern hatten und liebten.“ Mrs. Reed erzählte ihr, wie schwierig Lou sein konnte, und versuchte herauszufinden, was Lou über seine Eltern sagte. Shelley hatte den Eindruck, dass die Reeds Lou nichts nachtrugen und nur sein Bestes wollten. Mrs. Reed schien nicht verstehen zu können, warum Lou seine Eltern hasste und ihnen Vorwürfe machte. Angesichts dieser sonderbaren Sachlage hinter der hübschen Fassade des reedschen Hauses zog Shelley zwei Schlussfolgerungen: Einerseits, da seine Familie einen normalen Eindruck machte und auch keine offensichtlichen Probleme hatte, schien sich Lou sein eigenes Psychodrama zurechtzuspinnen, damit er Stoff zum Schreiben hatte. Andererseits sehnte sich Lou danach, dass seine Eltern ihn akzeptierten. Ihre Weigerung, sein Talent anzuerkennen, verstörte ihn und trieb ihn dazu, sich von ihnen zu entfernen. Ein Punkt, der Lou frustrierte, war auch, dass er seinen Vater für einen Schwächling hielt, der seiner Frau das Steuer übergeben hatte. Das entsetzte und faszinierte Lou, der ein waschechter Macho war. Insgeheim war Lou stolz auf seinen Vater und hätte es liebend gern gesehen, wenn er mehr Selbstbewusstsein entwickelt hätte. Aber den Gedanken, sich die Aufmerksamkeit der ehemaligen Schönheitskönigin mit seinem Vater teilen zu müssen, ertrug er einfach nicht.
Zumindest für eine gewisse Zeit bereitete Lou seinen Eltern eine unerwartete Freude allein damit, dass er ihnen Shelley vorstellte. Begeistert davon, dass sein Sohn eine saubere, weiße und schöne Jüdin nachhause gebracht hatte, erhöhte Mr. Reed die monatliche Unterhaltszahlung an seinen Sohn.
Hätte er eine Ahnung davon gehabt, welches Leben Lou und Shelley in Syracuse führten, hätte er das vermutlich unterlassen. Im Verlauf des Jahres spielten Sex, Drogen und Rockmusik eine immer wichtigere Rolle in ihrem Leben, obwohl Shelley keine Drogen nahm. Doch Lou, der schon seit einiger Zeit regelmäßig kiffte, nahm jetzt zum ersten Mal LSD und begann mit Peyote zu experimentieren. 1961 war es am College noch nicht die Regel, dass Drogen genommen wurden. Obwohl ab und zu Marihuana in den Verbindungshäusern kursierte und einige wagemutige Studenten LSD nahmen, bestand die Mehrzahl der Studierenden aus ordentlichen Jugendlichen der Fünfzigerjahre, die sich auf ihre zukünftige Arbeit als Steuerberater, Juristen, Ärzte oder Lehrer vorbereiteten. In ihren Augen war das Benehmen Lous extrem. Und dann begann er auch noch, Drogen zu verkaufen, anstatt sie nur selbst zu nehmen. Er hatte immer einen Vorrat an Marihuana, den er in einer Einkaufstasche bei einer Freundin im Wohnheim versteckte. Wenn Kundschaft kam, schickte er Shelley los, um die Tasche zu holen.
Lou war nun auf dem Weg dazu, ein unersättlicher Konsument aller möglichen Drogen zu werden; zeitweise kaufte er sich auch einen kodeinhaltigen Hustensaft namens „Turpenhydrate“. Lou war meistens stoned. „Er hatte mich gern um sich, wenn er high war“, erinnert sich Shelley. „Er sagte dann häufig ‚Wenn’s mir nicht gut geht, kümmerst du dich um mich.‘ Er nahm Drogen hauptsächlich, um sich zu betäuben oder sich zu erholen, um vor seinen Gedanken Ruhe zu finden.“
Da er sich nun als wieder geborener Heterosexueller präsentiert hatte, verlor Lou keine Zeit, um seine Homosexualität unter Beweis zu stellen. In der zweiten Hälfte seines zweiten Jahres in Syracuse hatte er seine erste – allerdings platonische – schwule Liebesgeschichte. „Es war eine erstaunliche Erfahrung“, erklärt Lou. „Ich fühlte mich sehr schlecht deswegen, denn ich hatte eine Freundin, und ich betrog sie; ich bin auch nicht besonders gut darin, mir irgendwelche Ausreden auszudenken.“ Besonders stark erinnert er sich an die schmerzhafte Erfahrung, dass „man versucht, irgendetwas für Frauen zu empfinden, aber es ist einfach nicht möglich. Ich kam nicht dahinter, was falsch war. Ich wollte alles in Ordnung bringen, ich wollte keine Probleme. Ich stellte mir vor, dass ich das auch schaffen würde, wenn ich mich hinsetzte und darüber nachdachte.“ Die Beziehung von Lou und Shelley veränderte sich. Sie begannen, miteinander zu spielen. Lou hatte mehr als nur eine schwule Affäre in Syracuse, und er versuchte oft, sie damit zu schockieren, dass er gelegentlich fallen ließ, zu welchem Jungen er sich hingezogen fühlte. Shelley war ihm aber gewachsen; sie fühlte sich durch seine Affären nicht bedroht, sondern im Wettstreit mit ihm gelang es ihr sogar oft, die Aufmerksamkeit seines Favoriten auf sich selbst zu lenken. Wenn sie sein Spiel jedoch erfolgreich mitspielte, so war Lou immer schon dabei, die Einsätze zu erhöhen. Durch diese Spielchen, die ihre Beziehung komplizierter machten, als gut für sie war, verloren die beiden bald den Boden unter den Füßen.
Freunde hatten unterschiedliche Erinnerungen an Lous schwule Affären in Syracuse. Allen Hyman hatte Lou während seiner ganzen Universitätszeit als geradezu außergewöhnlich heterosexuell empfunden, während Sterling Morrison, der Lou für einen Voyeur hielt, dazu meint: „Er versuchte sich an der widerwärtigen Schwulenszene in Syracuse. Er hatte ein Techtelmechtel mit so einer schlappen, effeminierten Tunte. Ich sagte: ‚Mann, Lou, es ist mir unangenehm darüber zu reden, aber wenn’s schon sein muss, kannst du dir nicht wenigstens einen attraktiven Typ suchen?‘“
In den frühen Sechzigern war Homosexualität absolut tabu. Nichts war 1962 in Amerika ekelhafter als das Bild zweier Männer, die sich küssten. Der Durchschnittsamerikaner hätte einen Homosexuellen niemals in sein Haus gelassen, die Furcht, dieser könne eine fürchterliche Krankheit durch Kontakt mit dem Toilettensitz oder der Sessellehne übertragen, war riesengroß. An den amerikanischen Universitäten gab es Berichte darüber, dass gesunde junge Männer wie viktorianische Jungfrauen in Ohnmacht fielen, sobald ihnen ein Homosexueller körperlich zu nahe kam. Wie Andy Warhol bald beweisen sollte, galt der Homosexuelle Anfang der Sechziger als die größte Bedrohung und die subversivste Person überhaupt. Brad Gooch zufolge, dem Biografen von Frank O’Hara, war „schon im Januar 1964 eine Kampagne im Gange, um die schwulen Bars von New York zu observieren, und das Fawn in Greenwich Village war geschlossen worden. Als Reaktion auf diese Schließung, die durch Infiltrierung von Spitzeln – in der Szene ‚actors‘ genannt – möglich gewesen war, lautete die Schlagzeile der New York Times: ‚Große Betroffenheit in der Stadt durch Zunahme offener Homosexualität.‘“ Neben den großen Städten wie San Francisco und New York boten auch kulturelle Institutionen und besonders Privatuniversitäten vielen Homosexuellen die Möglichkeit, unterzuschlüpfen. Das College in Syracuse bildete hierin keine Ausnahme. Unter dem Schauspiellehrer Roberto Scarpatto, Lous Lieblingslehrer und von den Studenten liebevoll „Scarp“ genannt, hatte sich das College zu einer Brutstätte homosexueller Aktivitäten entwickelt.
„Als Schauspieler war ich nicht gerade das Gelbe vom Ei, wie man so sagt“, erzählt Lou. „Aber als Regisseur war ich gut.“ Lou entschloss sich, in The Car Cemetery (Der Autofriedhof) Regie zu führen. Um sein Leben zu illustrieren, hätte Lou keine bessere Form (das absurde Theater) und kein besseres Thema (das Stück basierte locker auf der christlichen Mythologie) finden können. Die Geschichte drehte sich um den Leidensweg eines begabten Musikers, der am Ende von einem Orchestermitglied an die Polizei verraten wird. Alles, was Lou schrieb oder tat, drehte sich um ihn selbst; hätte die Möglichkeit bestanden, so hätte er sicher nicht gezögert, eine Elektroschockfolterung als Höhepunkt einzubauen. Lou – dessen musikalische Karriere noch in den Kinderschuhen steckte – bearbeitete das Stück ganz nach seinem Geschmack, indem er dem Musiker die Rolle des Heilbringers in einer düsteren Welt voller grausamem Sex und Prostitution zuwies.
„Ich bin sicher, dass zwischen Lou und Scarpatto etwas lief“, bestätigt Richard Mishkin. „Dieser Typ holte sich die Burschen auf sein Zimmer und zog ihnen Damenunterwäsche an; dann machte er Fotos davon, und sie bekamen eine gute Zensur. Sogar der Dekan selbst hat sich entweder umgebracht oder er verschwand, weil er mit den Schwuchteln in der Fakultät in Zusammenhang gebracht wurde; später hat man sie dann angeklagt, weil sie komische Sachen mit den Studenten gemacht haben.“
Der „erste“ schwule Flirt kann nicht einfach übersehen und beiseite geschoben werden, wie es Morrison und Albin gern hätten. Einmal deshalb, weil es schon vorher passiert war. Während seiner Kindheit in Freeport hatte Lou des Öfteren beim Gruppenwichsen mitgemacht, und diese schwule Erfahrung hatte ihn auf eine Weise geprägt, die er später in seiner Karriere zu seinem Vorteil ausbauen würde. Besonders wichtig war der effeminierte Gang mit kleinen, vorsichtigen Trippelschritten, an dem man ihn schon von weitem erkennen konnte.
Obwohl er ursprünglich eher an eine Karriere als Schriftsteller dachte, hatte er die Gitarre immer in greifbarer Nähe und beschäftigte sich viel mit Musik. Seine erste Band in Syracuse war eine lose formierte Folkgruppe. Neben Lou spielte John Gaines, ein beeindruckend hoch gewachsener Schwarzer mit kräftigem Bariton; dann Joe Annus, hübsch, groß und weiß, ebenfalls mit einer guten Stimme; und ein sehr guter Banjospieler mit Afrolook, der aussah wie Art Garfunkel.
Die Gruppe spielte häufig auf einer kleinen Grünanlage in der Mitte des Universitätsgeländes, an der Kreuzung von Marshall Street und South Crouse. Gelegentlich traten sie auch in einer kleinen Bar namens Clam Shack auf. Lou sang nicht bei diesen Auftritten, da er seine Stimme nicht mochte, aber privat sang er Shelley seine eigenen Folksongs vor. Manchmal spielte er auch traditionelle schottische Balladen, die den Gedichten von Robert Burns oder Sir Walter Scott nachempfunden waren. Shelley, die Lou zu vielen seiner bekannten Songs inspirierte, war tief berührt von der Schönheit seiner Musik. Seine Akkorde waren für sie genauso fesselnd und verführerisch wie seine Stimme. Und oft war sie zu Tränen gerührt durch deren Empfindsamkeit.
Scarpatto brachte Lou nicht nur bei, wie man Regie führt, sondern auch, wie er seine Auftritte dramatischer gestalten konnte. Das kam Lou zugute, als er mit seiner Musik die ersten Bühnenauftritte absolvierte. Obwohl er sich selbst der Lyrik und den Folksongs verschrieben hatte, gab Lou den Ehrgeiz, ein Rock’n’Roll-Star zu werden, nicht auf. In seinem zweiten Jahr am College beschäftigte er sich dann auch weniger mit seinen Folksongs, sondern gründete seine erste richtige Rock’n’Roll-Band: L. A. And The Eldorados. L. A. stand für Lewis und Allen, die beide die Band gründet hatten. Lou spielte Rhythmusgitarre und sang, Allen saß am Schlagzeug, ein anderes Mitglied der Bruderschaft, Richard Mishkin, spielte Piano und Bass, und das Saxofon spielte Bobby Newman, den Mishkin in die Band geholt hatte. Stephen Windheim, ein Freund von Lou, spielte die Leadgitarre. Sie kamen gut miteinander aus, nur mit Newman, einem lauten, unangenehmen Typ, dem Mishkin zufolge „alles scheißegal war“, kam es zu Reibereien. Lou mochte Bobby überhaupt nicht und war sehr erleichtert, als Newman während des Semesters aus dem College flog. Sein Nachfolger war ein anderer Saxofonspieler namens Bernie Kroll, den Lou gut gelaunt als „Kroll, der Troll“ bezeichnete.
In der bis dato spießigen Musikszene war einiges Geld zu machen, und es dauerte nicht lange, bis die Geschäfte der Eldorados von zwei Studenten geführt wurden: Donald Schupak, ihrem Manager, und Joe Divoli, der ihnen die Auftritte in den örtlichen Klubs verschaffte. „Ich traf Lou, als wir beide Erstsemester waren“, erklärt Schupak. „Vielleicht hatten wir deswegen keine Probleme miteinander, weil wir als Erstsemester Freunde waren, denn er konnte immer sagen: ‚Mann, Schupak, das ist vielleicht ’ne blöde Idee‘, und ich sagte: ‚Hast Recht.‘“ Unter der Ägide von Schupak und mit Lou als Bandleader arbeiteten die Eldorados bald schon fast jedes Wochenende; sie spielten zwei- bis dreimal pro Woche auf Bruderschaftspartys, Tanzveranstaltungen, in Bars und Klubs und verdienten einhundertfünfundzwanzig Dollar pro Nacht.
Das Leben als Musiker und die Orte, an denen sie sich herumtrieben, besaßen für Lou eine große Anziehungskraft. Direkt neben dem College lag das Schwarzenviertel von Syracuse, der Fünfzehnte Ward genannt. Hier war er Stammgast in einem Kellerlokal namens Club 800, in dem schwarze Musiker und Sänger auftraten und improvisierten. Lou und seine Band waren dort gern gesehen und arbeiteten auch gelegentlich mit den Sängern der Gruppe The Three Screaming Niggers zusammen. „Das war eine ausschließlich schwarze Gruppe, die viel in den nördlichen Universitäten des Bundesstaates New York auftrat“, erinnert sich Mishkin. „Wenn wir zusammen spielten, traten wir unter ihrem Namen auf. Wir gingen ab und zu auch in den Norden. Die Leute da dachten, dass Weiße keinen Blues spielen können; dann kamen wir und spielten Blues. Da waren sie plötzlich nett zu uns.“ Manchmal traten die Eldorados auch zusammen mit einem schwarzen weiblichen Backgroundchor auf.
Was die Band aber besonders herausstechen ließ, war ihr Auto. Mishkin besaß einen Chrysler New Yorker, Baujahr 1959, mit gigantischen Heckflossen. An der Außenseite der Karosserie befand sich eine Zeichnung von roten Gitarren, aus denen Flammen hervorzüngelten, und auf dem Kofferraum stand „L. A. And The Eldorados“. Alle Mitglieder der Band kauften sich identische Westen mit Goldlurexpaspeln, Jeans, Stiefel und dazupassende Hemden. In diesem Salonlöwenpunk ausstaffiert und mit Mishkins goldener Kutsche, die sie zu ihren Auftritten brachte, machte die Band Furore, wenn sie durch die Straßen kreuzte. Wie es auf solchen Touren üblich war, erlebten sie eine Menge gemeinsamer Abenteuer, die sie noch mehr zusammenschweißten.
Mishkin erinnert sich: „Einmal spielten wir in Colgate, und als wir in Allens Cadillac zurückfuhren, blieben wir in einem Schneesturm stecken. Wir saßen also um ein Uhr nachts im Auto und rauchten Joints, aber schließlich dämmerte es uns, dass wir erfrieren würden, wenn wir einfach sitzen blieben. Es war bereits eine Menge Schnee gefallen, als wir aus dem Auto kletterten und uns in die nächste Stadt schleppten, die ungefähr eine Meile entfernt war. Irgendwo mussten wir bleiben, und so gingen wir in das einzige Hotel, aber es war natürlich voll. Immerhin gab’s da eine Bar. Schupak erzählte in der Bar Geschichten aus seiner Militärzeit, zum Brüllen komisch, Lewis und ich schnappten fast über, wir waren hysterisch vor Lachen. Irgendwann sagte der Barkeeper: ‚Ihr könnt hier nicht bleiben, ich muss die Bar schließen.‘ Wir gingen dann zum Gerichtsgebäude, und es endete damit, dass wir die Nacht im Gefängnis verbrachten.“
Was die Eldorados sonst noch von den anderen Bands unterschied, war die Zusammensetzung ihres Programms. Sie spielten zwar die Standardnummern von Chuck Berry, aber auch einiges von Lous eigenem Songmaterial. Ein Song von Lou, den sie häufig spielten, war ein Liebeslied, das er für Shelley geschrieben hatte, eine frühe Version von „Coney Island Baby“. „Außerdem haben wir noch einen Song namens ‚Fuck Around Blues‘ gespielt“, erinnert sich Mishkin. „Sehr provozierend. Manchmal kam’s gut an, aber ab und zu wurden wir deswegen auch bei den Verbindungspartys rausgeworfen.“
L. A. And The Eldorados waren ein wichtiger Teil von Lous Leben und vermittelten ihm viele Schlüsselerlebnisse über den Rock ’n’ Roll; aber er hielt die Band von seinem anderen Leben in Syracuse getrennt. Sein Ziel war es eigentlich, Schriftsteller zu werden, und Rock ’n’ Roll kam erst an zweiter Stelle. Damals, als die Beatles noch unbekannt waren, hatte der Begriff Rock ’n’ Roll einen negativen Beiklang. Man dachte dabei eher an Paul Anka und Pat Boone als an die Rolling Stones. Lou lag mehr daran, mit einem Schriftsteller wie Jack Kerouac in Verbindung gebracht zu werden. Diese Unentschlossenheit spiegelte sich auch in seiner kargen Garderobe wider. Wie es sich für den klassischen Beatnik gehört, trug Lou für gewöhnlich schwarze Jeans, T-Shirts oder Sweatshirts. Für den Fall, dass er mal wie John Updike auftreten wollte, hatte er jedoch ein Tweedjacket mit Lederflicken am Ellbogen in seinem Spind. Wie dem auch sei – Lou schien sich in jeder Rolle, als Rocker oder als Schriftsteller, irgendwie unwohl zu fühlen. Deswegen war er in jeder dieser Rollen auf Konfrontationskurs; einerseits hinterließ er auf die Art mehr Eindruck, andererseits beherrschte ihn eine sehr reale Unruhe, die dazu führte, dass er sich so benahm. Die Zusammenarbeit mit Lou war aus diesen Gründen für Hyman und die anderen sehr schwierig.
Allen berichtet: „Am schwierigsten war es mit Lou, wenn er am Tag unseres Auftritts aufwachte und beschloss, dass er nicht zum Gig gehen würde. Dann kam er einfach nicht. Wir waren schon alle fix und fertig und hielten nach ihm Ausschau. Ich erinnere mich an eine Bruderschaftsparty, wir sollten nachmittags auftreten, und wir waren alle startklar, aber Lou tauchte einfach nicht auf. Ich rannte schließlich zu seinem Zimmer, bahnte mir den Weg durch etwa vierhundert Pfund seiner geliebten Pistazien – und dann fand ich ihn im Bett, am Nachmittag, begraben unter ungefähr sechshundert Pfund Pistazien. Ich sah ihn an und sagte: ‚Was ist los? Wir müssen auftreten!‘ Und er antwortete: ‚Scheiß drauf! Ich will heute nicht arbeiten!‘ Ich sagte: ‚Das kannst du nicht machen, wir werden dafür bezahlt.‘ Mishkin und ich haben ihn dann mehr oder weniger auf die Bühne gezerrt. Zum Schluss hat er dann auch gespielt, aber er war stinksauer.“
Reed schien das Scheinwerferlicht gleichzeitig zu suchen und zu scheuen. „Lou war einzigartig und sehr dickköpfig, das machte es so schwierig mit ihm“, ergänzt Mishkin. „Es war schrecklich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war unmöglich. Immer kam er zu spät, immer hatte er irgendwas an dem herumzumeckern, was die Leute von uns erwarteten. Man musste ihn buchstäblich überall mit Gewalt hinschleppen. Manchmal wurden wir seinetwegen schon Pasha And The Prophets genannt, und öfter mal bekamen wir in manchen Klubs keinen zweiten Auftritt, weil er alle verprellt hatte. Es war so störrisch wie ein Maultier. Und die Leute wollten uns kein zweites Mal, weil er so ungehobelt und fies war, und die Tatsache, dass die Leute für unsere Auftritte bezahlten, schien ihm völlig zu entgehen. Es war ihm total egal. Falls wir also einen zweiten Auftritt wollten, benutzten wir den Namen Pasha And The Prophets. Oder die Leute waren am ersten Abend so betrunken, dass sie sich beim zweiten Mal nicht mehr an uns erinnern konnten. Er versuchte niemals, sich mit seiner Kleidung oder seinem Verhalten dem Geschmack des Publikums anzupassen. Meistens suchte er die Konfrontation. Er wollte anders sein. Aber Lou war auch sehr ehrgeizig. Er wollte ein Rock’n’Roll-Star und ein Schriftsteller werden. Das hat er mir ganz klar zu verstehen gegeben.“
Im Mai 1962 waren Lewis, Lincoln, Stoecker, Gaines, Tucker und andere die öde Universitätszeitung leid. Begierig danach, von sich reden zu machen und ein Zeichen zu setzen, brachten sie eine literarische Zeitschrift unter dem Namen Lonely Woman Quarterly heraus. Der Titel basierte auf Lous Lieblingskomposition von Ornette Coleman, „Lonely Woman“. Die erste Ausgabe, im Savoy unter den wohlwollenden Augen von Gus Josephs erstellt, enthielt eine Geschichte ohne Titel, im vorhergehenden Kapitel bereits erwähnt, die mit Luis Reed unterschrieben war. Darin wurde Sidney Reed als ein Typ dargestellt, der seine Frau verprügelt, und Toby als Kinderschänderin beschrieben. Shelley, die auch an der Publikation beteiligt war, war überzeugt davon, dass Lou mit dieser Geschichte ganz bewusst versuchte, sein Image als ebenso düstere wie geheimnisvolle Person auszubauen, genau wie seine homosexuellen Affären ein Versuch waren, mit der Off-Beat-Schwulenszene in Kontakt zu kommen. Sie nahm an, dass er intelligent genug war, um zu erkennen, wie unwohl man sich als Leser dieser Geschichte fühlen musste. „Und das wollte Lou immer erreichen“, sagt sie. „Er wollte, dass sich die Leute unbehaglich fühlen.“
Die erste Ausgabe von LWQ brachte „Luis“ seine erste Pressemeldung ein. Daily Orange, die Collegezeitung, hatte die Zeitschrift besprochen und Lincoln interviewt, der sich damit brüstete, dass die gesamte Hunderter-Auflage des Magazins in drei Tagen vergriffen gewesen sei. Die erste Ausgabe war auch wirklich wohlwollend aufgenommen worden, doch dann wurden alle Redaktionsmitglieder ziemlich träge, mit Ausnahme von Lou, der die zweite Ausgabe herausbrachte. Sie enthielt auf der ersten Seite sein Aufsehen erregendes zweites Stück. Unter dem Titel Profile: Michael Kogan – Syracuse’s Miss Blanding hatte er einen besonders aufmerksamkeitsheischenden und spektakulären Angriff auf den studentischen Führer der Jungen Demokratischen Partei zu Papier gebracht. Hyman erinnert sich: „Er schrieb so ungefähr, Kogan solle sich die amerikanische Flagge in den Hintern stecken und damit einmal quer übers Collegegelände marschieren. Das war damals ein echt haarsträubender Vorschlag.“
Unglücklicherweise entpuppte sich Kogans Vater als Rechtsanwalt. „Er befand, dass es sich hier um üble Nachrede handelte“, erinnert sich Sterling. Und er wollte Lou hochgehen lassen. Lou wurde also vor den Dekan zitiert. Aber Kogan und sein Vater waren so gereizt und beleidigend, dass der Dekan nach und nach für Lou Partei ergriff. Nach der Unterredung sagte er dann zu Lou nur, er solle weiterarbeiten und aus dem Zimmer verschwinden, er wolle nicht weiter gegen ihn vorgehen. Damit hatte Reeds literarische Karriere im Mai 1962 sozusagen mit einem Blitzstart begonnen.
Trotz all dieser Ereignisse war es aber nicht der Unterricht, der Lous zweites Jahr in Syracuse dominierte, sondern seine Beziehung zu Shelley. Sie verbrachten so viel Zeit wie nur möglich miteinander; am Wochenende stiegen sie oft in den Wohnungen von Freunden ab, und sie liebten sich in Verbindungszimmern, in Autos und hinter irgendwelchen Büschen, wenn es sein musste. Lou erhielt in „Einführung in die Mathematik“ ein D und ein F in „Englische Geschichte“ [die Noten D und F entsprechen den deutschen Notenstufen „Ausreichend“ und „Mangelhaft“; Anm. d. Ü.]. Er geriet wieder in Konflikt mit den Behörden, als Nelson Slater, der gelegentlich bei den L. A. And The Eldorados mitspielte, wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde und einige Leute verpfiff, darunter auch Lewis und Mishkin.
„Wir haben die ganze Zeit Dope geraucht“, gibt Mishkin zu. „Aber niemals während der Arbeit. Mag schon sein, dass wir ab und zu spielten, dann was rauchten und danach noch so ein bisschen vor uns hin improvisierten. In jedem Fall mussten Lou und ich und einige andere ins Büro des Dekans. Der sagte dann: ‚Wir wissen, dass ihr Marihuana raucht, packt also am besten gleich aus.‘ Wir hatten wirklich Angst, ich jedenfalls ganz bestimmt. Lou war sauer. Auf die Collegeleitung und auf Nelson. Alles in allem ging die Sache aber noch glimpflich aus. Wir hatten Glück, andererseits hatten sie auch keine Beweise in der Hand. Immerhin mussten wir ins Büro, und sie versuchten uns mit der bekannten ‚Wir wissen über alles Bescheid, der und der hat gesagt‘-Nummer zu bluffen.“
Aufgrund der vielen Überschreitungen und seines offensichtlich geringen „akademischen Eifers“ wurde Lou am Ende des zweiten Jahres auf akademische Bewährung gesetzt.
Der Sommer 1962 war nicht ganz einfach für Lou. Er hatte Probleme damit, das erste Mal länger als einen Tag von Shelley getrennt zu sein. Er versuchte trotz der tausend Meilen, die zwischen ihnen lagen, die Kontrolle über sie aufrechtzuerhalten, indem er einen intensiven Briefwechsel mit ihr begann: Jeden Tag schrieb er ihr einen langen Brief, der einer Geschichte glich. Die Briefe begannen mit einem Bericht über seinen Tagesablauf – bestehend aus einem nächtlichen Besuch des Hayloft, einer Schwulenbar. Dabei versuchte er, sie mit vieldeutigen Kommentaren in Unruhe zu versetzen. Dann schlug sein Brief plötzlich ins Romanhafte um, und er fing an, eine Kurzgeschichte zu erzählen, die seine Leidenschaft und Sehnsucht nach Shelley widerspiegelte. Eine solche Geschichte war zum Beispiel „The Gift“, die auf dem zweiten Album der Velvet Underground, White Light/White Heat, erschien. Lou beschreibt sich darin als einen einsamen Langweiler aus Long Island, der sich nach seiner Freundin sehnt. Höhepunkt der Geschichte war, dass der liebeskranke Autor sich selbst per Post in einem gebärmutterartigen Pappkarton abschickte. Im Schlussbild, einem guten Beispiel für den jüdischen Humor, der Reeds Arbeit prägte, bringt das Mädchen ihren Freund um, als sie den Pappkarton mit einem Cuttermesser öffnet.
Shelley, ein klassischer passiv-aggressiver Typ, schrieb ihm zwar kaum zurück, aber sie telefonierte ab und zu mit ihm, und Lou war von dem, was er hörte, gar nicht angetan. Lou hatte sich vorgestellt, dass sich Shelley den Sommer über, während sie getrennt waren, in ihrem Zimmer einschließen und ihre Zeit ausschließlich damit verbringen würde, an ihn zu denken. Aber das sah Shelley ganz und gar nicht ähnlich. Zu Beginn der Ferien war sie zwar im Krankenhaus gewesen, um sich ihre Mandeln entfernen zu lassen, aber schon im Juli hatte sie mehrere Verehrer, und einer von ihnen war sogar wahnsinnig in sie verliebt. Die Gefühle, die Lou in „The Gift“ beschrieb, waren seine eigenen. Frustriert tigerte er in seinem Zimmer auf und ab. Er ertrug es nicht, keine Kontrolle über Shelley zu haben. Es machte ihn wahnsinnig.
Er brütete einen Plan aus. Wieso nicht hingehen und sie besuchen? Schließlich war er ihr Freund, schrieb ihr jeden Tag und sprach mit ihr am Telefon. Seine Eltern, ausgehöhlt durch die Launenhaftigkeit ihres Sohnes in diesem Sommer, unterstützten das Unternehmen nur zu gern; seine Besuche im Hayloft und das tägliche Gitarrespielen stimmten sie misstrauisch. Ein Besuch bei Shelley war ihrer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Anfang August flog er nach Chicago.
Shelley hatte vehement gegen seinen Besuch protestiert; am Telefon warnte sie Lou davor, dass ihre Eltern ihn nicht mögen würden, dass er einen Fehler begehe und dass es einfach nicht gut gehen könne. Aber Lou, der „ihr direkt gegenüberstehen wollte“, wie sie sich erinnert, bestand darauf.
Lou hatte bereits seit einiger Zeit ein Verhaltensmuster entwickelt, das er immer dann anwandte, wenn er in eine neue Umgebung kam. Er sprengte die bestehenden Gruppen und machte sich selbst zum Mittelpunkt. Besuchte er eine Familie, ging er, kaum dass er die Türschwelle überschritten hatte, bereits davon aus, dass der Vater ein tyrannisches Ungeheuer sei, vor dem man die Mutter beschützen müsse. In seiner ersten Nacht im Haus der Albins verwickelte Lou Mr. Albin sehr geschickt in eine politische Diskussion. Er schätzte ihn, nicht unzutreffend, als liberalen Demokraten ein und schlug ihn mit einer detaillierten Verteidigungsrede für den berühmt-berüchtigten konservativen Kolumnisten William Buckley technisch k. o. Während Shelley, voller Grausen und Faszination, zuhörte, näherte sich ihr Vater einem Schlaganfall. Lou war offensichtlich nicht der richtige Mann für seine Tochter. Er wollte ihn nicht einmal im Haus haben.
Die Albins hatten im nahe gelegenen Evanston, in der Northwestern University, ein Zimmer für Lou gemietet. Lou griff noch einmal tief in seine Trickkiste und holte zu einem doppelten Schwinger für Mr. Albin aus. In derselben Nacht, als er Shelley um ein Uhr von einer Kinovorstellung im Wagen von Mr. Albin nachhause brachte, fuhr er den Wagen in den Straßengraben und zwang Mr. Albin auf diese Art, aufzustehen, sich anzukleiden und das verbeulte Auto herauszuziehen.
Von da an ging’s bergab. Lou machte noch einen tapferen Versuch, Mrs. Albin auf seine Seite zu ziehen. Eines Abends, als der Herr des Hauses abwesend war, saß er mit Shelley und ihrer Mutter beim Abendessen. Er begann auf seine klassische Tour und sagte: „Also Sie sind wirklich sehr nett. Wenn nicht dieses Monster hier im Haus wäre …“ Aber Mrs. Albin war völlig immun gegen seinen jungenhaften Charme. Sie hatte mehrfach die Briefe gelesen, die er während des Sommers an Shelley geschrieben hatte, und hatte sich ihre eigene Meinung über Lou gebildet. Sie hasste ihn leidenschaftlich – und tut es auch heute noch, mehr als dreißig Jahre später. Ihrer Meinung nach hat Lou Shelleys Leben zerstört. Shelleys Eltern reagierten auf seinen Besuch, indem sie ihrer Tochter damit drohten, sie dürfe nicht mehr nach Syracuse zurückkehren, wenn sie den Kontakt mit ihm nicht abbreche. Shelley schwor natürlich, dass sie den Rebellen niemals mehr treffen wolle. Sie war also gezwungen, heimlich mit Lou zusammen zu sein, und damit hatte Lou sie genau da, wo er sie haben wollte. Da es niemanden außerhalb seiner Clique gab, dem sie sich hätte anvertrauen können, hatte er sie nun unter Kontrolle. Von da an setzte Lou alles daran, alle seine Freundinnen auf diese Art zu behandeln. Zuerst entfremdete er sie von ihrem bisherigen Leben, um sie dann nach seiner Pfeife tanzen zu lassen.