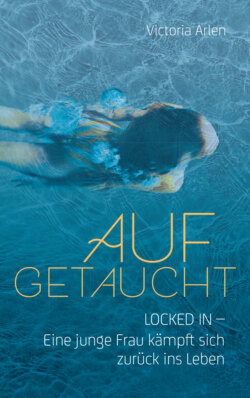Читать книгу Aufgetaucht - Victoria Arlen - Страница 9
Оглавление3
Die Hölle
Anfang August 2006
Rückblende. Als ich meine kognitiven Fähigkeiten nach und nach verliere, bringen mich meine Eltern wieder in die Notaufnahme einer angesehenen Kinderklinik in Massachusetts. Ich werde sofort stationär aufgenommen. Während dieses Krankenhausaufenthalts muss ich erneut jede Menge schmerzhafter Untersuchungen über mich ergehen lassen. Wieder ohne Ergebnisse. Nach einigen Tagen werden meine Eltern in ein Besprechungszimmer im Krankenhaus geführt, wo man ihnen von einer „Einrichtung für Rehabilitation und Schmerztherapie“ erzählt. Meine Eltern wollen mir unbedingt helfen. Sie machen sich große Sorgen, dass ich vielleicht sterbe, wenn sie mich mit nach Hause nehmen. Damals haben sie das Gefühl, dass ihnen kaum eine andere Wahl bleibt, als diesem Vorschlag zuzustimmen, wenn sie nicht das Risiko eingehen wollen, wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt zu werden.
Die Einrichtung für „Schmerztherapie“ ist in Wirklichkeit ein älterer, heruntergekommener Teil der Kinderklinik. Die Zimmer ähneln Schlafsälen, und die Wände sind weiß und kahl. Meinen Eltern ist anfangs nicht bewusst, dass es in Wirklichkeit eine psychiatrische Einrichtung ist. Die Besuchszeiten sind begrenzt, und man muss sich ausweisen, um überhaupt eingelassen zu werden.
In dieser Zeit habe ich immer wieder kurze Phasen, in denen mein kognitives Bewusstsein wach ist. Ich habe viele Erinnerungen an diese Zeit, von denen ich die meisten am liebsten vergessen würde.
In der Sonntagsschule habe ich gelernt, dass es Himmel und Hölle gibt. Der Himmel wurde als schöner Ort beschrieben, an dem Gott wohnt – ein Ort voll Liebe und Licht. Die Hölle hingegen wurde als sehr düsterer Ort beschrieben, an den böse Menschen kommen und wo es Feuer und Qualen gibt und viele sehr schlimme Dinge passieren. In meiner Zeit hier lerne ich, dass es auch auf der Erde eine Hölle gibt.
Als ich in meine neue „Unterkunft“ geschoben werde, bin ich desorientiert und verwirrt, aber ich bin so weit bei Bewusstsein, dass ich merke, dass mich meine Eltern verlassen. Sie sagen mir immer wieder, dass sie mich lieben und dass sie mich bald wieder besuchen kommen. Ich will schreien und weinen, als sich meine Eltern verabschieden, aber mein Mund weigert sich, auch nur einen Ton herauszubringen.
Bitte lasst mich nicht hier.
BITTE!!!
Als sie fort sind, packen mich grobe Hände an den Schultern und ich höre eine aggressive Männerstimme, die knurrt: „Deine Eltern kommen erst wieder, wenn du mit diesem Spielchen aufhörst. Ihnen kannst du vielleicht etwas vormachen, aber uns nicht.“ Ab diesem Moment weiß ich, dass ich an einem Ort bin, an dem ich keine Heilung und Hilfe erwarten kann.
Sie werden mir nicht helfen.
Sie halten mich für verrückt.
Bitte, lasst mich hier raus!
Lasst mich nach Hause.
Ich bin nicht verrückt.
Ich bin nicht verrückt.
ICH BIN NICHT VERRÜCKT!
Später erfahre ich, dass meine Mutter bei der Heimfahrt fast einen Nervenzusammenbruch erleidet. Als sie zu Hause ankommen, fängt sie an, sich über den Ort zu informieren, der ihrer Tochter angeblich „helfen“ soll. Aber sie stellt schnell fest, dass ich nicht in einer „Einrichtung für Rehabilitation und Schmerztherapie“ gelandet bin, sondern auf einer psychiatrischen Station. Meine Eltern fangen sofort an, eine Möglichkeit zu suchen, mich wieder herauszuholen.
Ich bin gefangen.
Sie werden mich umbringen.
Ich erinnere mich, dass ich dort gequält werde und dass man mir immer wieder sagt:
„Wir glauben dir nicht.“
„Hör auf mit diesem Spiel!“
„Deine Mami ist nicht da und kann dir jetzt nicht helfen.“
Anscheinend versuchen sie, mir Schmerzen zuzufügen, um mich „zu brechen“, damit ich „mit diesem Spiel aufhöre“.
Ich verstelle mich NICHT!
Kann mir jemand helfen!
Bitte!
Viele Pfleger und Schwestern gehen grob mit mir um, aber eine Schwester ist besonders schlimm. Ich erinnere mich, dass sie Mitte fünfzig ist und korpulent. Sie trägt eine dicke Brille, hat graublondes Haar und einen runden Haarschnitt. Nennen wir sie einfach F.
Jeden Morgen verfrachtet mich F unter eine kalte Dusche und verspottet mich, wenn die Kraft in meinem Oberkörper nachlässt und ich auf dem Duschhocker zusammensacke. Ich kann kein Essen schlucken, aber da F glaubt, ich würde das alles nur spielen, werde ich zwangsernährt. F stopft das Essen in meinem Mund und wenn es in meinem Hals stecken bleibt, huste ich und ringe nach Luft. Erst wenn ich kurz vor dem Ersticken bin, hört sie damit auf. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Sie fragt natürlich auch nicht, was ich mag oder nicht mag. Da ich „mich weigere, mein Essen zu schlucken“, bringen sie und eine andere Schwester mich in ein Zimmer, in dem mir F brutal eine Magensonde in die Nase schiebt und mir Flüssignahrung einflößt. Statt die Sonde anschließend in meiner Nase zu lassen, reißt sie sie heraus und wiederholt diese Tortur bei jedem Essen, dreimal am Tag. Später erfahre ich, dass Magensonden nicht mehrmals am Tag eingeführt und wieder herausgezogen werden müssen. Als meine Mutter fragt, warum sie die Sonde nicht einfach drinnen lassen, antwortet die Stationsschwester: „Wir verfolgen das Ziel, dass Victoria wieder isst. Dazu können wir sie nur bringen, wenn die Ernährung über die Sonde für sie unangenehm und keine schöne Erfahrung ist.“ Natürlich schäumt meine Mutter vor Wut über, aber ihr sind die Hände gebunden.
Ich bin in einer sehr verwirrten Verfassung. Durch diese Misshandlungen fühle ich mich wie eine Gefangene, die ein schlimmes Verbrechen begangen hat.
Bitte lasst mich einfach nach Hause.
Ich habe nichts verbrochen.
Ich habe nie verstanden, warum Menschen andere absichtlich verletzen. Schon als Kind konnte ich mich furchtbar aufregen, wenn ich sah, wie Kinder unfreundlich zu anderen waren. Ich habe jeden Abend zu Gott gebetet, dass sich alle lieben und einander helfen sollen.
Selbst wenn die Pfleger und Ärzte auf dieser Station überzeugt sein sollten, dass sie mir mit ihren groben und brutalen Methoden helfen könnten, so muss ich doch sagen, dass Unfreundlichkeit nie hilft. Und selbst wenn meine Krankheit psychischer Natur wäre: Wie sollte sich mein Zustand dadurch, dass mir noch mehr Schmerzen zugefügt werden, bessern? Ich finde, jede Art von Behandlung sollte von Liebe geprägt sein. Egal, ob eine Krankheit nun körperliche oder psychische Ursachen hat: Misshandlung ist immer ein absolutes „No go“. Wenn man einem Menschen bewusst neue Schmerzen zufügt, vertreibt das seine bisherigen Schmerzen ganz sicher nicht.
Und noch etwas: Meine Schmerzen sind nicht alle in meinem Kopf.
Ich bin eine Gefangene.
Ich befinde mich in einem Gefängnis aus Schmerzen.
Meinen Eltern ist nur eine begrenzte Besuchszeit erlaubt und sie dürfen nicht bei mir übernachten. Die schlimmste Behandlung erlebe ich nachts. Ich habe mich schon immer vor der Dunkelheit gefürchtet, und an diesem Ort wird meine Angst vor der Nacht noch verstärkt.
Je mehr Tage und Nächte vergehen, umso schwächer und teilnahmsloser werde ich. Das Krankenhauspersonal macht mir so viel Angst, dass ich zu niemandem mehr Augenkontakt herstelle. Ich halte meinen Kopf gesenkt. Ein kurzer Blick in den Spiegel zeigt ein graues, knöchriges, resigniertes Kindergesicht. Eingesunkene Wangen, glasige Augen ohne die geringste Spur des Funkelns, das früher darin getanzt hat.
Wie kann dieser Zombie im Spiegel ich sein?
Wo ist das lächelnde, energiegeladene, lustige Mädchen?
Wo ist das Leuchten in den Augen?
Ich hatte ein Grübchen in der linken Wange. Es war immer zu sehen, weil ich immer lächelte. Jetzt ist mein Gesicht zu ausgemergelt für dieses Grübchen. Ich kann nicht lächeln, ich kann nicht sprechen, und ich kann kaum den Kopf oben halten. Ich will das Entsetzen in den Gesichtern meiner Familie nicht sehen, wenn sie mich besuchen. Deshalb beschließe ich, ihnen nicht in die Augen zu schauen.
Ich bin machtlos.
Es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl, sich nicht wehren zu können.
Warum lasst ihr mich hier allein?
Später erfahre ich, dass sich meine Familie in dieser Zeit verzweifelt bemüht, mich aus dieser Einrichtung herauszuholen. Man sagt ihnen, dass ich nicht entlassen werden könne, weil ich psychiatrische Hilfe bräuchte. Aber meine Familie weiß instinktiv, dass mich dieser Ort umbringen wird, wenn sie mich nicht bald retten. Meine Eltern stellen ein Team aus Anwälten und Ärzten zusammen und erarbeiten einen Plan, um meine Entlassung zu erwirken. Zeitgleich kämpfe ich ums Überleben.
Mitten in dieser Hölle auf Erden ist immerhin eine Krankenschwester, die freundlich und mitfühlend ist. Sie meint es wirklich gut mit mir. Sie kümmert sich um mich und unterstützt mich. Wenn meine Eltern zu Besuch kommen, sagt sie ihnen, dass ich nicht hierher gehöre und dass sie mich herausholen müssen.
Aber leider wird diese Schwester nicht oft für mich eingeteilt. Offenbar hat mich F besonders „ins Herz geschlossen“ und scheint immer für mich zuständig zu sein. Wenn meine Eltern zu Besuch kommen, versucht sie, ihnen einzureden, ich würde nur eine „Show abziehen“, und behauptet, dass ich „bestens klarkomme“, wenn sie nicht da sind.
Mein Körper schaltet sich immer mehr ab und versagt langsam seine Dienste. Ich habe kaum noch die Energie, die Augen offen zu halten. Ich bin nicht sicher, wie viel ich noch verkraften kann, aber ich versuche weiterzukämpfen. F und einige andere Schwestern und Pfleger versuchen unermüdlich, mich dazu zu bringen, „mit diesen Spielchen aufzuhören“. Die Methoden, derer sie sich dazu bedienen, sind unmenschlich. Das, was sie mit mir machen, würde ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen.
Das war’s dann wohl.
Gib den Kampf auf.
Lass es einfach aufhören.
Wie viel halte ich noch aus?
Meine Gedanken überschlagen sich.
Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkrafte, aber etwas in mir versucht es weiter.
Versuche zu kämpfen!
Hol dir deine Würde zurück!
Ich, ich, ich kann nicht.
Ich will nicht mehr kämpfen.
Ich möchte unbedingt leben, aber der Wunsch, das alles hinter mir zu lassen, ist stärker.
In vielerlei Hinsicht fühlt es sich an, als wäre ich zwischen zwei Welten gefangen. Und wenn ich einfach aufhöre, es zu versuchen? Vielleicht ist das der Ausweg, und ich kann den Kampf aufgeben und sterben. Endlich frei sein.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal frei gefühlt habe. Ich habe grausame Schmerzen und fühle mich so elend, dass der Tod einladend wirkt. Schmerzen und Leiden bestimmen nun vollständig meine Identität und meine Existenz. Ich bete nur noch, dass Gott mir gnädig ist und alles wegnimmt.
Eines Nachts auf dieser Station werde ich brutal mit der Möglichkeit konfrontiert, dass ich sterben könnte. Obwohl schon lange alles furchtbar ist, ist in dieser Nacht etwas anders, ganz anders. Mein Herz rast, und die Schmerzen erreichen einen neuen Höhepunkt. Ich kann kaum atmen und mein Körper fängt an, sich zu verkrampfen. Ich sterbe. Mein Körper hat sich wie ein Embryo zusammengerollt und kann nicht mehr. Er gibt auf.
So fühlt sich also Sterben an.
Ich bin in meinem Zimmer allein. Die Tür wurde abgesperrt. Ich versuche, um Hilfe zu schreien, aber ich kann kaum atmen. Ich schaue aus dem Fenster zum Himmel hinauf und habe das beängstigende Gefühl, dass dies das Ende ist. Mein Körper hat gekämpft, so gut er konnte, aber jetzt ist es Zeit, loszulassen. Die Schmerzen werden immer stärker und mein Atem wird immer schwächer. Mein Körper verkrampft sich und zittert von Kopf bis Fuß. Er fühlt sich an, als würde er explodieren. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich kann nicht einmal weinen. Der einzige Trost sind die Wolldecken, die ich schon als Baby hatte. Meine Mutter hat sie mir dagelassen. Das weiche, vertraute Material gibt mir ein bisschen Halt. Für einen kurzen Moment schließe ich die Augen und fühle mich, als wäre ich zu Hause.
Ich will nach Hause.
Bitte lasst mich nach Hause.
Ich will nach Hause.
Die Realität reißt mich schnell wieder aus diesem angenehmen Gefühl, als ich zur Tür schaue und meinen Blick durch mein leeres Zimmer mit den weißen Betonwänden und den schmutzigen Deckenfliesen wandern lasse. Mir wird bewusst, was das Schlimmste an meiner Situation ist: Ich werde nicht nur an diesem kalten, schrecklichen Ort sterben. Ich bin auch noch allein. Ganz allein. Niemand ist da, der mich tröstet oder in den Armen hält. Ich werde mich nie von meiner Familie oder meinen Freunden oder meinem Leben verabschieden können. Ich werde nie wieder schwimmen können, nie wieder tanzen, nie wieder Hockey spielen, nie wieder zur Schule gehen, nie Auto fahren oder einen Freund haben. Ich werde nie wieder leben, die Welt sehen und lachen können. Mein Grübchen bleibt für immer eine ferne Erinnerung auf Fotos und Familienvideos. Meine großen, braunen Augen bleiben für immer geschlossen. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gelacht oder auch nur gelächelt habe. Den Ärzten bin ich egal. Wahrscheinlich sind sie einfach froh, wenn das Zimmer wieder frei wird. Sie halten mich sowieso für verrückt.
Das ist das, was sie wollten.
Sie haben mich gebrochen.
Niemand wird je erfahren, was hier wirklich passiert ist.
Niemand wird je wissen, welche furchtbaren Dinge die Ärzte und das Pflegepersonal mir angetan haben.
Die grausamen Dinge, die sie gesagt und getan haben.
Und niemand wird erfahren, wie schwer ich gekämpft habe und wie viel ich ertragen habe.
Ich werde zum Schweigen gebracht.
Für immer.
Und sie werden weiterhin Kinder wie mich misshandeln.
An diesem Punkt geht es mir unbeschreiblich schlecht. Ich habe die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Ich will nur noch, dass es vorbei ist. Selbst wenn das bedeutet, dass ich sterbe. Ich kann nicht einmal weinen, selbst wenn ich es noch so sehr versuche. Es ist buchstäblich nichts mehr übrig. Mit meinem Körper ist es vorbei. Mit mir ist es vorbei.
Ich weiß, dass ich ganz kurz davorstehe, frei zu sein und keine Schmerzen mehr zu haben. Ich bin nur noch einen kleinen Schritt davon entfert, diese leidvolle Welt zu verlassen. Ich begrüße den Tod wie einen alten Freund. Einen Freund, den ich nie kannte und den ich bis zu diesem Moment auch nie kennenlernen wollte. Ich sehne mich nach Freiheit und einem schmerzfreien Moment. Nur einen einzigen Moment, an dem ich lächeln und atmen kann, ohne das Gefühl zu haben, von einem Dolch durchbohrt zu werden. An diesem Punkt erscheint mir der Tod als einziger Ausweg. Die Welt um mich herum ist grausam und der Gedanke, noch länger zu bleiben und zu leiden, ist unerträglich. Ich kann nicht mehr. Ich wollte nie sterben oder aufgeben, und ich habe furchtbare Angst – nicht unbedingt vor dem Tod selbst, sondern davor, alles zurücklassen zu müssen und keine Chance mehr zu bekommen, zu leben und meine Träume zu verwirklichen. Aber mir graut noch mehr davor, auch nur einen Tag länger in dieser Hölle zu vegetieren. Wenn ich die Kraft und die Möglichkeit dazu hätte, würde ich mir jetzt wahrscheinlich selbst das Leben nehmen.
Ich hatte seit meiner Kindheit so große Träume: eine Goldmedaille gewinnen, Schauspielerin oder Fernsehmoderatorin werden, einmal bei Dancing with the Stars auftreten und die Welt zu verändern. Das waren neben vielen anderen Dingen meine Träume, die ich eines Tages verwirklichen wollte. Leider würde dieser Tag nie kommen. Diese Träume wurden mir von diesen Schwestern und Ärzten geraubt. Sie sind fest entschlossen, mich zu brechen. Und sie haben gewonnen.
Es tut mir leid, dass ich nicht stärker war.
Es tut mir so leid.
Während ich im Sterben liege, muss ich unweigerlich daran denken, wie meine Geschichte endet und wie resigniert ich mich fühle. Ich bin ein Opfer. Ein schlimmeres Gefühl kann es nicht geben. Ich habe den größten Kampf meines Lebens verloren. Im buchstäblichen Sinn.
So habe ich mir das Ende meiner Geschichte nicht vorgestellt.
Sterben ist furchtbar, aber wegen der Fehler von anderen zu sterben, ist noch viel entsetzlicher. Auch mit elf Jahren weiß ich, dass meine Geschichte eigentlich nicht so enden sollte. Ich habe nicht einmal annähernd das Leben geführt, das ich mir erträumt habe. Aber ich weiß einfach, dass ich nicht länger kämpfen kann. Ich muss loslassen. Ich weiß, dass ich stark bin, aber jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich alles Gott übergeben muss. Ich kann nicht anders und bete:
Bitte Gott, bitte hilf mir.
Sag meiner Familie, dass ich sie liebe.
Sag ihnen, dass es mir leidtut.
Ich wollte nie, dass es so endet.
Bitte pass besonders auf meine Mama auf.
Und lass meine Eltern wissen, dass es nicht ihre Schuld ist.
Der Gedanke, meine Familie zu verlassen, jagt mir schreckliche Angst ein. Drillinge fühlen sich ihr Leben lang eng miteinander verbunden und haben den tiefen Wunsch, zusammenzubleiben. Wir kommen gemeinsam in diese Welt und deshalb verlassen wir sie auch wieder gemeinsam – etwas in der Art. Mein älterer Bruder, LJ, ist mein Teddybär und Beschützer. Ich habe noch nicht einmal einen Freund mit nach Hause gebracht, dem er auf den Zahn hätte fühlen können. Und meine Eltern – oh, meine Eltern … Ich weiß, dass es sie in den Abgrund stürzen wird, wenn ich hier sterbe, und dann auch noch mutterseelenallein.
Tief in meinem Inneren ist mir klar, dass ich noch nicht wirklich gelebt habe. Dennoch müsste ich meine ganze Willenskraft zusammennehmen, um nicht aufzugeben. Aber der Wille, am Leben zu bleiben, ist verglichen mit dem Wunsch, dieser Hölle zu entfliehen, einfach zu schwach. Deshalb bete ich so intensiv, wie ich noch nie gebetet habe.
Bitte, Gott, rette mich aus dieser Hölle!
Ich will ja nicht sterben.
Aber ich kann hier nicht länger leben.
Bitte, Gott.
Lass mich hier nicht sterben.
Rette mich!
Ich habe Angst, die Augen zu schließen, weil ich nicht weiß, ob ich sie danach je wieder öffnen kann. Angst überrollt meinen Körper. Es ist, wie wenn ein Schwimmer von großen Wellen überspült wird und verzweifelt kämpft, um nicht unterzugehen, aber trotzdem spürt, dass er immer mehr versinkt.
Bleib wach, Victoria.
Bleib am Leben.
Hab keine Angst.
Sei stark.
Angst ist ein alles beherrschendes, verwirrendes Gefühl. Man weiß nie, wie schwer sie zuschlagen oder was sie auslösen wird. Später werde ich erfahren, dass viele Faktoren zu der bodenlosen Angst beitragen, die ich in dieser Situation empfinde. Tief in meinem Herzen graut es mir davor, allein zu sein, stumm zu leiden und aus diesem Leben gerissen zu werden, ohne die Chance bekommen zu haben, wirklich zu leben.
Wie kann meine Geschichte so enden?
Misshandelt.
Mit starken Schmerzen.
Allein.
Ein Opfer dieser Krankheit und dieses schrecklichen Ortes.
Ich will leben und frei sein, aber ich weiß, dass das in diesem Moment schlicht und ergreifend unmöglich ist. Der Preis, um dieser Hölle noch länger meinen Überlebenswillen entgegenzusetzen, ist zu hoch.
Ich kann nicht mehr kämpfen.
Es tut mir leid.
Es tut mir so, so, so leid.
Ich kämpfe darum, die Kraft zu finden, in Würde zu sterben. Nicht zu weinen. Keine Angst zu haben. Stark zu sein und mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich nach Kräften gekämpft habe. Jetzt ist es Zeit, sich von allen zu verabschieden.
Liebe Victoria,
du hast es wirklich gut gemacht. Du hast ein gutes Leben geführt. Du hast Mathe kapiert und hattest immer gute Noten. Du bist schnell geschwommen, du hast deine Familie geliebt und du hast immer mutig gelebt. Dein Lächeln konnte ein ganzes Zimmer erhellen und wird auch im Himmel erstrahlen. Du hast schwer gekämpft. Und du hast NICHT aufgegeben. Leider waren die Schmerzen und diese Krankheit ein stärkerer Gegner, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Du warst in der Unterzahl – ein Kind, das gegen viel zu viele Feinde gekämpft hat, gegen deren Waffen du machtlos warst. Ich weiß, dass du dein Leben nicht so geplant hast und auch nicht vorhattest, dass es so enden würde, aber das ist okay. Manchmal läuft nicht alles nach Plan. Hab keine Angst. Obwohl es ein kurzes Leben war, war es ein gutes Leben. Ein wirklich, wirklich gutes Leben. Ein Leben, das nie vergessen werden wird. Es wird Zeit, die Flügel auszubreiten und endlich frei zu sein.
Jesus, bitte nimm mich zu dir.
An Gott:
Danke, Gott, für ein schönes Leben. Bitte hülle meine Familie mit deiner und meiner Liebe ein. Lass mich jeden Tag, den sie leben, über ihnen scheinen wie die vielen Regenbögen, die ich früher so oft gemalt habe. Lass sie wissen, dass ich immer bei ihnen bin. Bitte halte sie, wenn sie um mich weinen, und beschütze sie, wenn die Trauer fast unerträglich wird. Und bitte lass sie nie vergessen, wie sehr ich sie liebe. Bitte lass meine Brüder mutig und furchtlos leben und lass mich der Wind unter ihren Flügeln sein.
An meine Familie:
Das Aller-, Allerwichtigste zurerst: Danke, danke, danke für die unglaublichsten elf Jahre, die man sich vorstellen kann. Ich kann nur lächeln, wenn ich an euch alle denke und daran, wie viel Spaß wir miteinander hatten. Das Haus am See, das Hockeyfeld, Skifahren, Tanzpartys und die vielen Ausflüge und Abenteuer – es war ein wunderbares Geschenk von Gott, dass ich Teil dieser Familie sein durfte. Ich war ein riesengroßer Glückspilz, weil ich euch alle in meinem Leben haben durfte. Und es tut mir so leid, dass es so enden muss. Mir fehlen wirklich die Worte, um zu sagen, wie sehr ich euch alle vermissen werde und wie viel mir jeder von euch bedeutet. Ich weiß, dass ich nur wegen euch allen überhaupt so lange durchgehalten habe. Ich habe mich so sehr bemüht zu kämpfen, weil ich mehr Zeit mit euch verbringen wollte. Es tut mir leid, dass wir nicht noch viel mehr Zeit miteinander haben können. William, Cameron und LJ, ihr wart die besten Brüder, die sich ein Mädchen je wünschen kann. William, ich werde es vermissen, dir beim Eishockeyspielen zuzusehen und mit dir Streethockey zu spielen und mit dir auf Bäume zu klettern und so zu tun, als wären wir Affen. Cameron, ich werde deine Umarmungen vermissen. Du hast mich immer zum Lachen gebracht und gesagt, ich sei schön. Ich werde es vermissen, dass wir die „drei Musketiere“ sind, die unzertrennlich waren. LJ, ich werde vermissen, wie du mich beschützt und auf mich aufgepasst hast und mir immer ein Lächeln entlocken konntest. Du warst das beste Vorbild und der beste große Bruder, den es geben kann, und ich werde nie vergessen, was du alles für mich getan hast. Jungs, ich hoffe, ihr lebt mutig und furchtlos, und ich bete, dass euch mein Tod nicht die Freude und euer Lachen raubt. Ich bete, dass ihr alle ein schönes und fantastisches Leben habt. Ihr wisst, dass ich bei euch bin, wohin ihr auch geht. Ihr seht mich vielleicht nicht, aber ihr sollt wissen, dass ich immer da sein werde. Ich werde nie von eurer Seite weichen.
Und schließlich, Mama und Daddy, danke, dass ihr immer versucht habt, mir zu helfen, und dass ihr mich so wunderbar und leidenschaftlich geliebt habt. Es tut mir so weh, dass ihr nicht hier seid. Aber ich weiß, dass ihr unablässig für mich kämpft. Obwohl dieser Kampf leider nicht so ausging, wie wir es uns vorgestellt haben, sollt ihr wissen, dass ich weiß, dass ihr ALLES getan habt, um mir zu helfen, und dass es NICHT eure Schuld ist, dass ich es nicht schaffen werde. Ich liebe euch mehr als das Leben und wünschte mehr als alles andere, dass ich euch beide noch ein letztes Mal umarmen könnte. Ich werde dein Lächeln vermissen, Mama. Du verbreitest immer Licht und Wärme, wohin du auch gehst. Und Daddy, ich werde dein Lachen vermissen und deine vielen albernen Scherze und dass du immer Tweetie Bird zu mir gesagt hast. Es macht mich traurig, dass du mich nicht als Braut in die Kirche führen kannst. Ich werde immer dein kleines Mädchen sein. Ich hätte so gern mehr Zeit auf dieser Welt, aber ich werde euch alle sehr bald wiedersehen. Ich hätte mir nie vorstellen können, meine letzten Momente so zu verbringen. Bitte glaubt mir, dass ich euch alle sehr liebe. Es tut mir so leid, dass ich nicht länger durchhalten konnte. Lebt mit Licht und Liebe und ohne Angst. Tut das für mich.
Ich werde immer über euch wachen, immer. Ich habe Angst, aber ich versuche, inmitten des Chaos und der Schmerzen einen Sinn und Frieden zu finden.
Bitte, Gott, mach es einfach schnell.
Ich halte das nicht mehr aus.
Bitte. Bitte.
Plötzlich werde ich an einen Bibelvers erinnert: „Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst“ (Josua 1,9).
Bitte, Gott.
Sei bei mir.
Lass es schnell gehen.
Lass mich gehen.
Lass mich fliegen und frei sein.
Ich habe wirklich Angst. Aber dann erinnere ich mich:
Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei;
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark, ich helfe dir,
mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!
Jesaja 41,10
Zu meiner Überraschung verschwindet die Angst tatsächlich, und eine unglaubliche Ruhe und Liebe umgeben mich auf einmal. Ich kann es nur als Gottes Liebe beschreiben. Er hält mich, und ich weiß plötzlich wieder: Egal, was passiert, es ist gut. Das ist eine prägende Erfahrung, die ich an diesem absoluten Tiefpunkt mache: Selbst in einem der schlimmsten Momente meines Lebens ist Gott an meiner Seite. Er hält mich, er liebt mich und er beschützt mich. Auch wenn ich – menschlich gesehen – allein bin, weiß ich, dass ich nicht allein bin, denn Gott ist bei mir. Nun spüre ich totalen Frieden. Ob ich noch in dieser Welt bleibe oder ob ich gehe, ich habe Frieden.
Es wird gut werden.
Ich danke Gott im Gebet und versuche langsam, die Augen zu schließen.
„Victoria?“
Was?
„Victoria, wach auf! Ich bin es, Mama.“
Mama?
Bist du es wirklich?
Meine Mama kommt mit zwei Sanitätern und einer Krankentrage in mein Zimmer. „Ich bin bei dir. Wir bringen dich von hier weg.“ Ich höre, wie sie das immer und immer wieder sagt.
Bin ich bereits tot?
Oder ist das ein Traum?
Ich bin verwirrt und habe keine Kraft, mich irgendwie zu bewegen, um ihr zu verstehen zu geben, dass ich sie höre. Ich werde schnell auf die Trage gelegt, aus dem Zimmer geschoben und von der Station gebracht. Ich sehe die kahlen Wände und die Schwestern und Ärzte im Gang stehen. Dann sehe ich sie, die Frau, die mein Leben zur Hölle gemacht hat: F. Am liebsten würde ich ihr wie ein kleines Schulmädchen zurufen: „Ha, ha! Du kriegst mich nicht!“ Da ich das nicht kann, sage ich es nur in Gedanken und male mir aus, wie sie von einem wütenden Delfin eine Ohrfeige bekommt.
Meine Eltern und ihre Anwälte sind unter dem Vorwand gekommen, dass sie mich in eine andere psychiatrische Einrichtung verlegen, die näher an unserem Wohnort liegt. Aber in Wirklichkeit bringen mich die Sanitäter in ein Krankenhaus in unserer Nähe, wo mich die Ärzte sachgerecht versorgen, bis ich so stabil bin, dass meine Eltern mich mit nach Hause nehmen können.
Ha! Ha! Frau F.!
Jetzt guckst du, was?
Aber alles, was ich wirklich zu sagen habe, ist:
Danke! Gott! Du hast mich gerettet!
An dem Tag, an dem ich diese Horror-Station verlasse, erlebe ich, dass Gott unsere Gebete immer erhört. Nicht unbedingt dann, wenn wir es wollen, oder so, wie wir es erwarten. Aber das Timing spielt keine Rolle. Ich bin gerettet und ich bin aus der Hölle befreit, in der ich gefangen war. Mit ist bewusst, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist, aber es ist ein guter Anfang.
Die Lichter werden wahrscheinlich irgendwann trotzdem endgültig ausgehen, aber ich bin bei Menschen, die mich lieben und die mir helfen wollen.