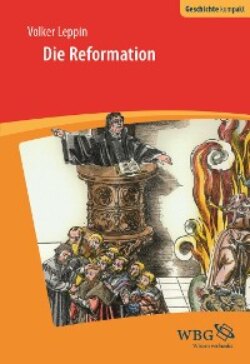Читать книгу Die Reformation - Volker Leppin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Um 1500: eine vielfältige Welt
ОглавлениеPolaritäten im Spätmittelalter
Nichts führte zwangsläufig auf die Reformation zu. Der Gedanke, dass die Welt des späten Mittelalters so dekadent gewesen sei, dass geradezu notwendig eine Reformbewegung habe entstehen müssen, die dann nicht nur evangelische Frömmigkeit begründet, sondern längerfristig auch die katholische Kirche zur eigenen Reform veranlasst habe (Erwin Iserloh, Joseph Lortz), vereinfacht die Dinge ebenso wie die Vorstellung von einer nie gesehenen Steigerung der Frömmigkeit im späten Mittelalter, die von der Reformation dann gerade in ihrer Konzentration auf das fromme Tun des Menschen gebrochen worden sei (Moeller). Wer um 1500 in Deutschland lebte, bewegte sich in einer Welt, die nicht von einlinigen Entwicklungen geprägt war, sondern von einer Vielfalt von Möglichkeiten, die man – grob vereinfachend – als Spannungen oder Polaritäten beschreiben kann. Mindestens drei solcher Polaritäten waren bestimmend für das Leben im 14. und 15. Jahrhundert: in institutioneller Hinsicht die zwischen Zentralität und Dezentralität, in sozialgeschichtlicher Hinsicht die zwischen Klerikern und Laien und in frömmigkeitsgeschichtlicher Hinsicht die zwischen innerer und äußerer Frömmigkeit.
Zentralität und Dezentralität: Die Vorstellung einer unmittelbar und umfassend durch den Papst geleiteten Kirche träfe das Mittelalter kaum. Zwar wurden solche Ansprüche gelegentlich formuliert, etwa im Dictatus papae von Papst Gregor VII. (1073–1085) oder, für die Reformationszeit noch präsenter, in der Bulle Unam Sanctam von Papst Bonifaz VIII. (1294–1303) aus dem Jahr 1302, die es sogar zur Heilsnotwendigkeit erklärte, dem Papst untertan zu sein und die durch das Fünfte Laterankonzil (1512–1517) noch einmal bestätigt wurde. Gleichwohl gab es im späten Mittelalter eine komplizierte Mächtebalance. Innerhalb der kirchlichen Hierarchie mussten die Päpste auf einen Ausgleich mit den jeweiligen Ortsbischöfen bedacht sein. Dabei lässt sich seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert ein Bestreben der Päpste beobachten, viele Funktionen an die Kurie zu binden. So wurden zum einen Rechtsprozesse – auch zu Häresiefragen – vor allem auf dem Weg der Appellation von der niederen an die höhere Instanz verstärkt nach Rom beziehungsweise während des Avignonesischen Exils nach Avignon gezogen.
Stichwort
Avignonesisches Exil
Im ausgehenden 13. Jahrhundert gerieten die Päpste in eine immer stärkere Abhängigkeit von der französischen Krone. Schon Clemens V. (1305–1314) hatte an wechselnden Orten in Frankreich, unter anderem in Avignon, residiert. Dies wurde unter Johannes XXII. (1316–1334) definitiv Amtssitz der Päpste, die den kleinen Ort in der Provinz zu einer machtvollen Metropole ausbauten. Erst Urban VI. (1378–1389) nahm seinen Sitz wieder in Rom. Da aber die französisch orientierten Kardinäle einen Gegenpapst bestimmten, kam es nun zum Schisma zwischen Rom und Avignon.
Zum anderen bedeutete diese Zeit eine bislang unbekannte Konzentration der Finanzkraft an der Kurie. Die Situation in Avignon machte es nötig, neue Finanzquellen zu erschließen. So wurden etwa bei vom Papst vergebenen Pfründen Abgaben in Höhe des ersten Jahreseinkommens (Annaten) oder eines Drittels des Jahreseinkommens (Servitien) verlangt. Das damit verbundene finanzielle Interesse erhöhte das Bedürfnis der Kurie, über Stellen zu verfügen und sich deren Besetzung vorzubehalten (Reservationen). Das wiederum brachte ein hohes Maß an unmittelbarer Kontrolle der Kirche durch ihre Spitze mit sich (Immediatisierung und Zentralisierung). Doch wurden auch Gegenkräfte laut. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts wurden auf den Reichstagen in Deutschland regelmäßig Gravamina (Beschwerden) vorgelegt, die vor allem aus den geistlichen Fürstentümern kamen und die Aussaugung und Entmachtung der lokalen kirchlichen Hierarchie durch Rom beklagten.
Papstsschisma und Konzilien
Die Folgen des avignonesischen Papsttums reichten aber hierüber hinaus: Seit 1378 bestand das Schisma zwischen den Päpsten der von Urban VI. gegründeten Linie in Rom und jenen, die in Avignon geblieben waren. Die Doppelung der Spitze, die eine Teilung Europas in unterschiedliche Obödienzen (Gehorsamsbereiche) nach sich zog, warf das Problem auf, dass es kein geregeltes Verfahren gab, das zur Schlichtung hätte herangezogen werden können. In ausgiebigen Diskussionen, die ihren Mittelpunkt an der Pariser Universität hatten, wurde schließlich als der angemessenste Weg zur Klärung die Einberufung eines Konzils befunden. 1409 in Pisa scheiterte ein solcher Versuch noch, denn im Ergebnis standen sich nun nach einer Neuwahl nicht zwei, sondern drei Päpste gegenüber. Doch dem Konzil von Konstanz (1414–1418) gelang es, eine solche Autorität zu erlangen, dass es mit Martin V. (1417–1431) einen einzigen Papst anstelle der bisherigen drei installieren konnte. Dieser Erfolg war im Blick auf die zentrale Leitung der Kirche ambivalent: Einerseits führte er zu einer neuen Stärkung der zentralen Macht, andererseits war nun die Frage aufgeworfen, ob diese eher beim Papst oder eben beim Konzil als der Repräsentanz der Ortsbischöfe zu suchen sei, was indirekt wiederum die dezentralen Kräfte stärken konnte. Vor allem das Basler Konzil, das ab 1431 tagte, steigerte in diesem Sinne den Notstandskonziliarismus von Konstanz zu einem prinzipiellen Konziliarismus: Dem Konzil sollte generell die oberste Autorität in der Kirche zukommen. Allerdings hatte die Kirchenversammlung mit dieser radikalen Haltung und überhaupt mit ihren Planungen keinen dauerhaften Erfolg. Papst Eugen IV. (1431–1447) gelang es, das Konzil nach Ferrara und dann Florenz zu verlegen und dabei einen gewichtigen Teil der Basler Teilnehmer auf seine Seite zu ziehen. Das Konzil in Basel selbst hingegen zerfiel nach und nach – und die päpstliche Macht war neu zementiert. In dem bald entstehenden Renaissancepapsttum gelangte sie sogar zu einer neuen, wegen der moralischen Ausschweifungen freilich zweifelhaften Blüte.
Stichwort
Renaissancepapsttum
Mit Nikolaus V. (1447–1455) beginnt die bis in die Reformationszeit hineinreichende Reihe der Renaissancepäpste. Sie bauten die nach Schisma und Konziliarismus niedergegangene Macht des Papsttums neu auf und aus und erwiesen sich dabei zugleich als Mäzene ersten Ranges. Das heutige Rom der Renaissance – der Ausbau der Stadt, insbesondere des Vatikans mit Petersdom, Sixtinischer Kapelle und Stanzen – verdankt sich ebenso wie der Grundstock der Vatikanischen Bibliothek ihrer Sorge um Kunst und Bildung. Rom wurde so zur prachtvollsten Residenz Europas ausgebaut. Die religiösen und moralischen Pflichten des Bischofs von Rom traten hingegen in den Hintergrund. Zur Hofführung der Päpste gehörte auch ein ausschweifendes Leben mit Mätressen und eigenen Kindern, die zum Teil sogar in Machtpositionen geschoben wurden. Dies hat schon die Kritik der Zeitgenossen, aber auch über Jahrhunderte hinweg die moralisch geprägte Geschichtsschreibung bestimmt.
Rom und das Papsttum waren so neu als Zentrum der weltweiten Kirche erkennbar. Dies wurde – besonders eindrücklich in der Summa de ecclesia des Kardinals Juan de Torquemada (1388–1468) – auch durch papalistische, d.h. ganz am Papst orientierte Kirchentheorien unterstrichen.
Hussitismus
Gleichwohl war die Kirche um 1500 kein monolithischer, vom Papst geleiteter Block. Die Auseinandersetzungen des 15. Jahrhunderts hatten ihre Spuren hinterlassen. In Böhmen hatte die um Jan Hus (gest. 1415) formierte Oppositionsbewegung der Hussiten durch den Frieden von Kuttenberg 1485 sogar die Anerkennung als Konfession neben der päpstlichen Kirche erlangt – mit einem gewissen Recht spricht daher die Forschung gelegentlich auch von einer böhmischen Reformation, die allerdings im Unterschied zu der Bewegung des 16. Jahrhunderts regional begrenzt blieb. Ausgangspunkt war eine Gemengelage aus ethnischen und religiösen Auseinandersetzungen rund um die Universität Prag gewesen. Durch die entgegen der Zusicherung freien Geleits vonseiten des deutschen Königs 1415 auf dem Konzil von Konstanz erfolgte Verbrennung von Jan Hus hatte der Protest an Schärfe gewonnen; zugleich bot ihm, von Hus noch kurz vor seinem Tod zugestanden, die Forderung nach der Spendung des Laienkelchs beim Abendmahl ein einprägsames Symbol zur Abgrenzung von dem üblichen katholischen Ritus der Spendung allein der Hostie. Auch wo es nicht zu einer solchen regional begrenzten Anerkennung einer zweiten Auslegung des Christentums neben der päpstlichen kam, gab es Verselbstständigungstendenzen. Markant war die Entwicklung in Frankreich. Unter Ausnutzung bestimmter Regelungen des Basler Konzils gelang es dem französischen König, sich 1439 in der Pragmatischen Sanktion von Bourges eine erhöhte Verfügungsgewalt über die Kirche seines Landes, insbesondere die Besetzung der Bischofsstühle, zusprechen zu lassen. Zwar wurde diese Erklärung selbst auf dem Fünften Laterankonzil aufgehoben, aber wesentliche ihrer Bestimmungen gingen in das Konkordat von Bologna von 1516 ein.
Was in Frankreich auf Ebene des gesamten Herrschaftsgebietes erreicht wurde, konnte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation (so die seit dem 15. Jahrhundert zunehmend gebrauchte Bezeichnung) auf kaiserlicher Ebene nicht erreicht werden. Das Wiener Konkordat von 1448 stand bereits im Schatten der wiedererstarkenden Papstmacht. Dennoch gab es auf territorialer Ebene Bemühungen, die Verfügung über die Kirche in weltliche Hand zu bekommen. Insbesondere in Brandenburg und Sachsen kam es so zur Entwicklung von „Landesbistümern“: Einzelne Bistümer wie etwa Meißen, Merseburg oder Naumburg gerieten immer mehr in die Verfügung der benachbarten Territorialherren, die sie mit Verwandten oder Wohlgesonnenen besetzen konnten. Die Funktionen der Bischöfe wurden dabei immer stärker nicht so sehr auf die Grenzen ihrer Diözesen ausgerichtet, sondern auf die Landesherrschaften, denen sie besonders verbunden waren. Sie standen somit quer zu der kirchlich vorgesehenen Hierarchie und zeigten den Anstieg weltlichen Einflusses an, der sich auch in anderen Territorien bemerkbar machte. So wird immer wieder als ein geflügeltes Wort zitiert: Dux Cliviae est papa in suis territoriis, „Der Herzog von Kleve ist in seinen Territorien Papst“. Rudolf IV. von Österreich (1339–1365) machte sich solche Vorstellungen mit seinem Ausspruch: „In meinem Lande will ich Papst, Erzbischof, Bischof, Archidiakon und Dekan sein“ zu eigen. Dies galt nicht nur für Territorialherren. Selbst Städte, insbesondere die Reichsstädte, die allein dem Kaiser untertan waren, bemühten sich, Rechte über die Kirche zu erlangen. Besonders wichtig war auch in diesem überschaubaren sozialen Kosmos die Verfügung über das Personal. So trieb die Reichsstadt Nürnberg einigen Aufwand, um im Jahre 1474 das Präsentationsrecht für die Pfarrer ihrer wichtigsten Kirchen zu erhalten. Andere Städte erreichten Ähnliches, sodass die Kirche immer stärker vor Ort verwaltet wurde und die beabsichtigten zentralen Zugriffe immer geringere Durchsetzungskraft besaßen.
Stichwort
Sachsen
Das wichtige mitteldeutsche Territorium Sachsen wurde 1485 durch die Leipziger Teilung in einen ernestinischen Westteil und einen albertinischen Ostteil getrennt. Die Universität Leipzig blieb dabei in der Hand der Albertiner, während die Ernestiner, die späteren Landesherren Luthers, die Kurwürde und damit das Recht auf die Beteiligung an der deutschen Königswahl behielten. 1502 gründeten sie in Wittenberg ihre eigene Universität.
Damit war also um 1500 eine Situation erreicht, in der einerseits der Anspruch des Papstes auf zentrale Kirchenleitung symbolisch durch die Herrschaftsgestaltung im Vatikan wie auch theoretisch durch entsprechende Traktate neu bestätigt wurde, andererseits sich aber in Bischöfen, Königen, Fürsten und städtischen Räten gewichtige Gegenkräfte etabliert hatten, die die Leitung der Kirche dezentral organisierten.
Dem entsprach die Schwierigkeit im Umgang mit dem Gegensatz zwischen Klerikern und Laien: Das mittelalterliche Kirchenrecht sah eine klare Unterscheidung zwischen den geweihten Klerikern und den Laien vor. Sie galten gar als duo genera, zwei Gattungen. Das machte sich real vor allem in unterschiedlichen Rechtsräumen bemerkbar: Der Kleriker unterlag eigenen Vorschriften, konnte sich vor allem auch dadurch der weltlichen Gerichtsbarkeit entziehen, dass er auf einer Verhandlung vor einem geistlichen Gericht, gegebenenfalls in Rom beharrte. Diese klare Unterscheidung verlor aber an Plausibilität, je stärker Laien sich selbst als mögliche Subjekte religiösen Handelns wahrnahmen. Schon im 11. Jahrhundert traten Momente des Antiklerikalismus auf, der seinen wohl wirkungsvollsten Ausdruck im Decamerone des Giovanni Boccaccio (1313–1375) fand; dessen Novellen waren zu guten Teilen von der schlichten Grundidee getragen, dass Kleriker und Mönche den moralischen Ansprüchen nicht gerecht wurden, die sie selbst und andere an sie stellten. Die hinter diesen gelegentlich recht derben Erzählungen steckende Wahrnehmung war, dass Apostolizität sich nicht allein in formaler Amtsnachfolge der Bischöfe gegenüber den Jüngern Christi erweisen konnte, sondern auch ein entsprechendes Leben erforderte. Was sich dieser Idee folgend im hohen Mittelalter als Vita apostolica-Bewegung formiert hatte, gewann mit der zunehmenden Bereitschaft von Bürgern, sich in ihrem Gemeinweisen zu engagieren, auch in breiten städtischen Kreisen Akzeptanz. Die typische soziale Ausdrucksform hierfür waren Bruderschaften, die, in der Regel aufgrund schon vorgängiger gemeinsamer Interessen, häufig der Verbindung in einer Zunft, gebildete Zusammenschlüsse zum Interesse gemeinsamer Pflege religiöser und auch karitativer Aufgaben darstellten. Wenn aber Laien in dieser Weise ihr religiöses Leben selbst organisieren, ja, unter Umständen für die Durchführung der vorgenommenen Aufgaben sogar einen eigenen Priester finanzieren konnten, musste die Sonderung der Kleriker als eines eigenen Standes an Plausibilität verlieren. So standen sich um 1500 die aufrechterhaltenen Ansprüche der Kleriker und eine religiös hoch engagierte Laienschaft gegenüber.
Mit diesem Gegenüber verband sich auch eine dritte Spannung, nämlich die zwischen innerer und äußerer Frömmigkeit. Eine starke Hervorhebung der Kleriker konnte nämlich vor allem damit begründet werden, dass allein die Weihe, die wiederum das einzige formale Kriterium war, welches den Kleriker vom Laien unterschied, dazu befähigte, die Sakramente zu vollziehen.
Stichwort
Sakramente
Die mittelalterliche Kirche hatte nach längeren Diskussionen eine Gruppe von sieben äußeren Zeichen definiert, die das Heil vermittelten: die Sakramente Taufe, Eucharistie, Buße, Firmung, Weihe, Ehe, Letzte Ölung. Lediglich die Ehe wurde durch die Brautleute selbst geschlossen, die hierzu freilich der Assistenz des Priesters bedurften. Firmung und Weihe wurden durch einen Bischof vollzogen, die anderen Sakramente durch Priester. Mit ihrer Hilfe wurde das geistliche Leben der Christen und Christinnen strukturiert und gestützt, wobei insbesondere die Bindung des Eucharistieempfangs an vorheriger Beichte im Rahmen der Buße auch eine Möglichkeit von Kontrolle eröffnete.
Eucharistie, Buße, Ablass
Damit waren die Priester vor allem für die äußeren Vollzüge der Religiosität von großer Bedeutung. Zwei Sakramente, Eucharistie und Buße, wiesen einen besonderen Hang zur Quantifizierung auf: Das Heil wurde mess- und zählbar, die innere Haltung trat in ihrer Bedeutung zurück. Eucharistischer Ausdruck hierfür war die Vielzahl von Privatmessen, die gefeiert wurden und deren Vervielfältigung im späten Mittelalter sich zum Teil noch heute in der seinerzeit rasant angestiegenen Anzahl von Seitenkapellen in großen Kathedralkirchen zeigt: In ihnen vollzogen eigens hierfür beschäftigte Priester, die „Altaristen“, Messen für bestimmte Zwecke. Grundlage war der Gedanke, dass die Messe als Opfer bestimmten Zwecken auf Erden zugutekommen könne. Der Gedanke, dass die Messe als Kommunion der versammelten Gemeinde vor allem dieser zur Erbauung diene, trat demgegenüber in den Hintergrund – was zählte, war der korrekte Vollzug. Noch massiver ist der Gedanke der Quantifizierung im Bußwesen nachvollziehbar, denn aus diesem heraus entstand jenes Phänomen, das den ersten reformatorischen Protest auslöste: das Ablasswesen. Der Ablass (indulgentia) bezeichnet eine Reduktion der Sündenstrafen. Dahinter steht der Gedanke, dass die Freisprechung von der Sündenschuld (culpa) im Bußsakrament, nachdem der oder die Glaubende in Reue des Herzens (contritio cordis) zum Bekenntnis des Mundes (confessio operis), der Beichte im eigentlichen Sinne, gekommen ist, mit der Auferlegung einer Wiedergutmachung durch die Tat (satisfactio operis) verbunden wird, die eine Strafe (poena) darstellt. Seit dem frühen Mittelalter aber gab es die Vorstellung, dass die auferlegte Strafe nicht persönlich durch den Schuldigen erbracht werden müsse, sondern es auch Ausgleich durch die Taten anderer geben könne. Hieraus entstand die Idee, man könne vollen Nachlass seiner Sündenstrafen erlangen, wenn man als Kreuzritter sterbe. Die Übertragungsmöglichkeiten vermehrten sich zusehends. Insbesondere wurden Wallfahrten als möglicher Grund für Ablass genommen und die Reisen durch ad-instar-Ablässe in der Weise erleichtert, dass man den eigentlich einem anderen Ziel zukommenden Ablass auch bei einer kleineren Wallfahrt in die Nähe erlangen könnte – so den Ablass der Portiuncula-Kapelle von Franz von Assisi an der Wittenberger Schlosskirche. Die Grundlage hierfür bildete die Lehre, dass Christus und die Heiligen durch ihre weit über das Verlangte hinausgehenden Taten einen Schatz angehäuft hätten (thesaurus ecclesiae), aus dem die Kirche Ablass geben könne. Da die Verfügung hierfür dem Nachfolger Petri zukam, unterstützte dies im Rahmen der beschriebenen Bemühungen um Zentralisierung die päpstliche Macht. Das Konzept der Ersetzung einer Leistung durch äquivalente andere wurde nun aber so weit getrieben, dass es auch reichen konnte, sich Ablass käuflich zu erwerben – ein Verfahren, das besonders attraktiv wurde, als Sixtus IV. (1471–1484) in der Bulle Salvator noster die Wirkung der Ablässe wenigstens auf Basis seiner fürbittenden Bemühungen (per modum suffragii) auch auf das Jenseits, also die schon Verstorbenen, ausdehnte. Damit kam der Gedanke auf, dass man das Leiden der eigenen Vorfahren im Fegefeuer, dem Zwischenraum zwischen Hölle und Himmel, in dem man leiden musste, wenn man in der Todesstunde noch nicht alle Strafen gesühnt hatte, um Hunderte von Jahren kürzen könne, wenn man Geld für Ablässe ausgäbe. So war ein Solidarsystem zwischen Lebenden und Toten etabliert, das hochattraktiv war, freilich von dem Bemühen um die Besserung des eigenen Lebens eher ablenkte.
Bilder von spätmittelalterlicher Frömmigkeit, die sich allein auf diese Aspekte konzentrieren, sind allerdings verkürzt. Ebenso gab es auch Bemühungen um eine echte innere Aneignung des Glaubens, und dies sowohl affektiv als auch kognitiv. In kognitiver Hinsicht drängt sich ein Zusammenhang mit dem beschriebenen Laienengagement auf: Die städtischen Bürger partizipierten auch deswegen so aktiv am kirchlichen Leben, weil sie sich selbst durch Lektüre wesentliche Inhalte des Glaubens aneignen konnten. Schon kurz vor 1400 sah Zerbold von Zutphen (1367–1398) die Notwendigkeit, in dem Traktat De libris teutonicalibus darüber zu reflektieren, welche Schriften Laien zuträglich seien und welche nicht. Das sich darin zeigende Interesse gewann mit dem Buchdruck, genauer der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gensfleisch von Gutenberg (gest. 1468), in den Fünfzigerjahren des 15. Jahrhunderts einen gewaltigen Schub. Nun bestand die Möglichkeit, Erbauungsschriften und mehr und mehr auch Bibelübersetzungen in reichlicher Stückzahl der lesefähigen Bevölkerung, die vorwiegend in den Städten konzentriert war, zur Verfügung zu stellen. Mit der „Frömmigkeitstheologie“ (Hamm) entstand sogar ein Typus theologischer Literatur, der eigens auf diese gesteigerten geistlichen Bedürfnisse reagierte und Theologie nicht nur spekulativ behandeln, sondern als Hilfe für den spirituellen Weg der Glaubenden gestalten wollte. Der eigenen Lektüre korrespondierte das Interesse an einer geistlichen Begleitung, die über die bloße sakramentale Versorgung hinausging. In vielen Städten wurden Prediger, Leutpriester oder Kapläne angestellt, deren Aufgabe eben vorwiegend die Predigt war. Im oberdeutschen Raum bildete sich in diesem Zusammenhang sogar eine eigene schlichte Gottesdienstform, der Predigtgottesdienst, heraus. Während das eigentliche Pfarramt mit den administrativen Aufgaben der Gemeindeverwaltung und der umfassenden sakramentalen Versorgung betraut war, brauchte man für die Predigerstellen, deren Besetzung bzw. Präsentation meist dem Rat oblag, Gebildete. In der Regel kamen sie aus Kreisen des Humanismus. Mit ihren gelehrten Predigten ermöglichten sie der anspruchsvoller werdenden Bevölkerung ein kognitiv ansprechendes geistliches Angebot.
Stichwort
Humanismus
Die Bewegung des Humanismus entstand, zunächst in Italien, aus einer vertieften Beschäftigung mit dem Trivium der artes liberales, den sprachlich orientierten Teilen des mittelalterlichen Grundwissens. Man grenzte sich von der lateinisch-aristotelischen Gelehrsamkeit ab und folgte dem Motto ad fontes, zu den Quellen, um in umfassender Lektüre der antiken Quellen, auch der griechisch-platonischen, an antike Bildungsideale anknüpfen zu können. Die Humanisten verständigten sich untereinander in Netzwerken: vor Ort als sodalitas, gebildeter Freundeskreis, überregional durch Briefwechsel. Sie verstanden sich als Gegenbild zur scholastischen Gelehrsamkeit, die gelegentlich, wie in den 1515 erschienenen „Dunkelmännerbriefen“ mit derbem Spott überzogen wurde. Die Verbindung aus dieser kritischen Haltung zur dominierenden scholastischen Gelehrsamkeit und einem hohen eigenen Bildungsanspruch machten diese Kreise für die städtische Bevölkerung attraktiv. Nach und nach breiteten sie sich auch an den Universitäten aus, in Deutschland zunächst in Heidelberg, später aber auch beispielsweise in Erfurt, Leipzig oder Wittenberg.
Stärker affektiv orientiert waren die mystisch beeinflussten Frömmigkeitsformen. Mystik war zunächst in den Klöstern beheimatet. Das gilt auch für die oberrheinische Mystik eines Meister Eckhart (gest. 1328). Doch schon bei Johannes Tauler (gest. 1361), der sich, ohne dessen direkter Schüler zu sein, stark auf Eckhart bezog, zeigt sich das Bemühen, die Vorstellung einer inneren Berührung durch Gott, der Gottesgeburt in der Seele, nicht allein auf asketische Kreise zu beschränken, sondern auch Menschen in Handwerk oder Bauernstand zuzugestehen, dass sie einem „ruoff“ Gottes folgten. Durch die Theologia deutsch, eine vermutlich auch noch dem 14. Jahrhundert entstammende Schrift, erhielten solche Gedanken weitere Verbreitung, und insbesondere in den Niederlanden entwickelte sich mit der Devotio moderna eine Bewegung, deren ausdrückliches Ziel es war, den Alltag fromm zu gestalten. All diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie das christliche Leben nicht in der Erfüllung äußerlicher Riten erschöpft sehen wollten, sondern auf eine Nähe Gottes zielten, die auch unmittelbar erfahrbar sein sollte. Die Ablassfrömmigkeit oder die Praxis veräußerlichter Eucharistie erschienen hieran gemessen bereits innermittelalterlich als defizitär, das eigentliche Ziel lag in der Erkenntnis der eigenen Niedrigkeit im Angesicht Gottes und der Erfahrung, dass dieser sich den Menschen dennoch gnädig zuwandte. Menschen, die um 1500 lebten, war dieses Angebot innerlicher Frömmigkeit ebenso präsent wie jene quantifizierten äußerlichen Formen des Glaubenslebens – zum späten Mittelalter gehört beides, und die Personen, die zu gestaltenden Kräften der Reformation wurden, hatten mit beidem umzugehen.