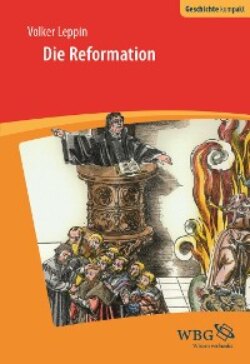Читать книгу Die Reformation - Volker Leppin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Von der universitären Disputation zur Publizistik
ОглавлениеAuch wenn Zwinglis Entwicklung sich nicht in Abhängigkeit von den Wittenberger Ereignissen vollzog, gehört doch diesen eindeutig der zeitliche Vorrang innerhalb der Reformation: Hier entwickelte sich die innermittelalterliche Erneuerung der Theologie durch eine Gruppe von Universitätsangehörigen nach und nach zu einer Bewegung, die sich im Gegensatz zur Kirche ihrer Zeit verstand. Tatsächlich hatte der Kreis um Luther, in dem dieser keineswegs von Anfang an die eindeutige Führungsgestalt war, zunächst nicht mehr vor als eine Neubestimmung der theologischen Lehre. Diese vollzog sich in Vorlesungen, dann aber zunehmend auch in Disputationen – dieses hergebrachte Medium der mittelalterlichen Scholastik war in besonderer Weise geeignet, eine bestimme Position nicht nur als eine unter vielen darzustellen, sondern als klare Alternative zu anderen zu profilieren. Der Grundaufbau einer Disputation, wie sie gängigerweise zu den akademischen Graduierungsverfahren gehörte, bestand darin, dass eine quaestio, eine Frage, nach ihrem Sic et Non abzuwägen war: nach dem, was für ihre Bejahung sprach, und dem, was dagegen stand. Wer dieses Verfahren im Zuge seiner Qualifikation zu meistern lernte, machte Erfahrung damit, Aussagen zu einander ausschließenden Gegensätzen zuzuspitzen. Dies musste anfänglich noch keineswegs eine Grundsatzalternative im Blick haben, aber schon die erste Disputation, mit der im September 1516 die neue Wittenberger Theologie wenigstens die universitätsinterne Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machte, lebte davon, dass die augustinische Theologie, wie sie Luther in seiner Römerbriefvorlesung gelehrt hatte, nun in das Gerüst des Ja oder Nein hineingezogen wurde. Sie handelte De viribus et voluntate hominis sine gratia, von den Kräften und dem Willen des Menschen ohne die Gnade und diente damit zur Exposition der völligen Angewiesenheit des Menschen auf eben diese Gnade Gottes. Diese Frage konnte man auch zuvor durchaus in Luthers Sinne beantworten, dass der Mensch zu seinem Heil ganz auf die Gnade angewiesen war. Im Wittenberger Kontext aber wurden die Thesen des Disputators Bernhardi aus Feldkirch so zugespitzt, dass mit großer Radikalität die Sündigkeit des Menschen und die Unfreiheit seines Willens ohne die Gnade ausgesprochen wurden. Wie sehr diese Zuspitzungen ein gemeinsames Bewusstsein der Erneuerung atmen, zeigt eine wenige Monate später von Luther privat getane Äußerung: Seinem Ordensbruder Matthäus Lang schrieb er am 18. Mai 1517: „Unter Gottes Beistand machen unsere Theologie und Sankt Augustin gute Fortschritte und herrschen an unserer Universität. Aristoteles steigt nach und nach herab und neigt sich zum nahe gerückten ewigen Untergang. Auf erstaunliche Weise werden die Vorlesungen über die Sentenzen verschmäht, so dass niemand auf Hörer hoffen kann, der nicht über diese Theologie, d.h. über die Bibel, über Sankt Augustin oder über einen anderen Lehrer von kirchlicher Autorität lesen will.“ (WA.B 1, S. 99, Z. 8–13 [Nr. 41]). Die wenigen Sätze machen deutlich, was in Wittenberg in diesen Jahren 1516/17 geschah: Seit der Wiederentdeckung des ganzen Aristoteles im 12. Jahrhundert war es, durch einige Auseinandersetzungen hindurch, zu einer engen Verbindung zwischen der Lehre des antiken Philosophen und der im 13. Jahrhundert entstandenen europäischen Universität gekommen. Wer sich an einer solchen einschrieb, durchlief zunächst die artes-Fakultät, und das hieß: Er absolvierte ein Programm aristotelischer Philosophie. Auch wenn dies in Wittenberg nicht unmittelbar infrage gestellt wurde, zeigt der Brief Luthers doch: Die konsequente Folgerung, dass sich das akademische Denken auf den Bahnen des Aristoteles zu bewegen habe, war ins Wanken geraten. Die Theologie sollte sich erneuern, indem das, was bislang in unterschiedlichen Schattierungen aufeinander bezogen worden war, nun gegeneinandergestellt wurde: Theologie und Kirchenväter auf der einen, Aristoteles auf der anderen Seite. Solche Konfrontation kam nicht ganz unvorbereitet: Schon seit dem 14. Jahrhundert hatte man in der Via moderna die Allgemeingültigkeit des Aristoteles infrage gestellt und besonders darauf insistiert, dass dessen Denkregeln im Bereich der Trinitätslehre, aber auch in der Beschreibung des Wirkens Gottes an seine Grenzen kam und diese nicht überschreiten durfte. Nun aber sollte dies prägend für den gesamten Lehrbetrieb der noch jungen sächsischen Universität werden.
Bibel und Kirchenväter
Ebenso auffällig wie dieser Umstand ist freilich, dass anderes, was später zu einer möglichen Alternative wurde, noch selbstverständlich zusammengehalten wurde: Bibel und Kirchenväter. Das galt auch noch für den nächsten wichtigen Schritt, der die Konfrontation weiter schärfte: die später sogenannte Disputation gegen die scholastische Theologie vom 4. September 1517. Ihre Form ist durch und durch von der den Disputationen eigenen alternativen Neigung zur Zuspitzung geprägt. In schroffen Thesen wird die für richtig gehaltene Lehre vorgebracht, und in der Regel schließen diese Sätze ab mit einem contra, das sich gegen Duns Scotus, gegen den großen Lehrer der Via moderna Gabriel Biel (gest. 1495), nach dessen Lehrbuch Luther selbst in Erfurt studiert hatte, oder auch schlicht gegen omnes, alle, richten konnte. Diese schroffe sprachliche Form hatte Luther freilich nicht erfunden: Im April 1517 hatte Johannes Eck (1486–1543), ein junger ehrgeiziger Theologieprofessor aus Ingolstadt, den Wittenbergern eine eigene, in Wien gehaltene Disputation übermittelt, die genau nach diesem Muster – scharfe These und knappe Benennung der Gegner – abgefasst war. Es war eine Gabe gewesen, mit der er um die Freundschaft des Kreises um Luther geworben hatte, zu dessen erbittertstem Gegner er wenig später werden sollte. An der Elbe fiel sein Geschenk auf fruchtbaren Boden. Die hiesigen Theologen – neben Luther vor allem auch sein Fakultätskollege Andreas Karlstadt (gest. 1541) – entdeckten die Möglichkeit, die Disputation dazu einzusetzen, den eigenen Neuerungsanspruch wirkungsvoll in Szene zu setzen. So kam es zu jener schroffen Ausrichtung der Disputation gegen die scholastische Theologie, die zunächst Augustin gegen seine Angreifer in Schutz nehmen sollte, dann aber zur Abrechnung Luthers mit dem vor allem in der Via moderna vermuteten Pelagianismus wurde: einer nach Pelagius (gest. 420), dem antiken Gegner Augustins, benannten Haltung, die dem Menschen zu viel Möglichkeit zur Erlangung des eigenen Heils zumaß. Ihn zu kritisieren, war im Mittelalter Gemeingut. Luther gab der Kritik die Schlagseite, dass jede Bejahung eines freien Willens des Menschen unter das Verdikt des Pelagianismus fiel. In einer Reihe scharfer Sätze rechnete er so mit der Anthropologie, Sündenlehre und Gnadenlehre seiner eigenen, der Via moderna entstammenden Lehrer ab. Die moderne Forschung hat herausgearbeitet, dass es tatsächlich allein diese eine Richtung der spätmittelalterlichen Theologie war, die getroffen wurde, nicht die Scholastik insgesamt. Insbesondere der vielfach geschmähte Gabriel Biel stand im Fokus der Kritik. Dass aber die Rhetorik der Thesen den Eindruck erwecken konnte, dass mehr, ja, die gesamte Scholastik kritisiert wurde, war Teil der Inszenierung, die Luther hier vornahm. Die Wittenberger Theologie wurde als prägnantes Alternativmodell zum bislang gängigen Wissenschaftsbetrieb dargestellt. In einem kühnen Schritt nutzte Luther die Möglichkeiten der Disputationstechnik, um innerhalb der Gemengelage spätmittelalterlicher Theologie die eigene Variante nicht als eine von vielen Möglichkeiten zu inszenieren, sondern als die der Gesamtheit der anderen gegenüberstehende Erfüllung des Vermächtnisses Augustins. Damit war beileibe noch kein Bruch mit der Scholastik vollzogen, schon gar nicht mit dem Mittelalter, aber es zeichnete sich doch innerhalb der Wittenberger Reformbemühungen eine Radikalität der Selbstdeutung ab, die dazu beitrug, dass der Riss bald sichtbarer und tiefer wurde. Hierzu trug allerdings auch bei, dass die schon im nächsten Monat folgenden Ablassthesen, welche wohl nie tatsächlich einer universitären Disputation zugrunde lagen, sondern von vorneherein zu einer überregionalen Debatte aufrufen sollten, die Bekanntheit der Wittenberger, zumal Luthers bald rasant erhöhten. Der Professor und Theologiereformer wurde zu einer Person des öffentlichen Interesses und bis zu einem gewissen Grade wohl von diesen Ereignissen auch überrollt. Freilich entdeckte er in diesem Zuge auch mehr und mehr die Möglichkeiten der Publizistik: Im Frühjahr 1518 brachte er seinen „Sermon von Ablass und Gnade“ heraus – die heikle Thematik hatte nun endgültig den akademischen Raum verlassen, und Luther selbst trug dazu bei. Es ging ihm zum einen darum, die Deutungshoheit über das Geschehen und die Diskussion zu behalten, aber Luther zielte offenkundig auch darauf, seine neuen Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zuteil werden zu lassen, und er erreichte sie: Bis zum Jahr 1520 gingen 22 Auflagen des kurzen Textes aus, der auch von dem Selbstbewusstsein des Autors zeugte: Er achte, so schrieb er am Ende, nicht sehr auf die, die ihn einen Ketzer nennten, denn dies seien nur „ettlich finster gehyrne, die die Biblien nie gerochen, die Christenliche lerer nie geleßen, yhr eigen lerer nie verstanden“ hätten (WA 1, S. 246, Z. 33f.). Damit war für jedermann, der lesen konnte, erkennbar: Hier tobte eine Konfrontation, in der es nicht um besser oder schlechter ging, sondern um wahr oder falsch. Der Hintergrund für die kühne Formulierung lag nicht zufällig in der Frage der Ketzerei – diese hatte nicht Luther selbst gestellt, sondern sie war durch die Gegner aufgeworfen worden: Seit der Jahreswende 1517/18 gab es Bestrebungen, einen Häresieprozess gegen Luther zu führen. Dass die Vielfalt des späten Mittelalters in ein konfrontatives Gegenüber einander am Ende ausschließender Gegensätze mündete, lag nicht allein am Drängen Luthers, auch nicht allein an der Zuspitzung durch das Medium der Disputation, sondern es lag auch an der Weise, wie Luthers Anliegen aufgenommen oder eben gerade nicht aufgenommen wurden. Zu den Versuchen, die sich anbahnende Konfrontation zu beschwichtigen, gehörte auch ein Verfahren, in dem der Orden Luthers versuchte, die Dinge im eigenen Verband zu klären und so auch zu vermeiden, dass der ganze Orden durch einen Ketzerprozess belastet würde: Die Luthersache sollte auf einem Kapitel der Reformkongregation der Augustinereremiten, der Luther angehörte, verhandelt werden. Statt zur Beruhigung führte allerdings Luthers Auftreten eher zu einer Intensivierung und Ausweitung der Angelegenheit. Er disputierte nicht über den Ablass, sondern setzte in der Heidelberger Disputation am 25. oder 26. April 1518 jene schon bewährte Technik der alternativen Zuspitzung fort. Inhaltlich zentral war wiederum die Anthropologie. Mit aller Vehemenz schärfte Luther die Unfähigkeit des Menschen etwas Gutes zu tun ein und erklärte sogar, den freien Willen gebe es nur dem Namen nach (These 13). Im Blick auf die Rechtfertigung führte Luther nun verschiedene Stränge seines Denkens zusammen: Die mystischen Konzeptionen der Notwendigkeit massiver Selbstdemütigung (humilitas) und des Wirkens Gottes im Menschen verband er mit der klaren, auf Röm 1,17 gestützten Aussage, dass nicht die Werke des Menschen, sondern allein eingegossene Gnade und eingegossener Glaube das Heil des Menschen bewirken (Erläuterung zu These 25), freilich in der Weise mystischer Einigung (Erläuterung zu These 26). Mit diesem Ineinander von traditionellen Vorstellungen und der in der Zukunft prägenden paulinischen Begrifflichkeit von Glauben und Gerechtigkeit markiert die Heidelberger Disputation eine wichtige Schaltstelle auf dem Weg zu der Rechtfertigungslehre Martin Luthers und seiner Anhänger, die in der Folgezeit den Unterschied zwischen altem und neuem Glauben markieren sollte.
Stichwort
Rechtfertigungslehre
Für die von Karl Holl (1866–1926) geprägte Forschung des 20. Jahrhunderts markierte die Rechtfertigungslehre den entscheidenden Bruch zwischen reformatorischer Bewegung und altem Glauben. Heute wird man den historischen Ablösungsprozess komplexer beschreiben müssen. Wirkungsgeschichtlich aber wurde die Rechtfertigungslehre zu dem entscheidenden, profilgebenden theologischen Merkmal evangelischer Religiosität. Dies betrifft einerseits die inhaltliche Bestimmung, nach der allein Christus (solus Christus) das Heil des Menschen bewirkt und es diesem allein aus Gottes Gnade (sola gratia) und allein durch den Glauben (sola fide) ohne jegliches menschliche Verdienst zuteil wird. Anderseits liegt die Besonderheit auch in der systematischen Stellung der Rechtfertigungslehre. Für das evangelische Bekenntnis ist es charakteristisch, dass in ihm die Rechtfertigungslehre die Zentralstellung einnimmt und von ihr her die anderen Lehren zu bestimmen sind.
Heidelberger Disputation
Diese für die spätere Konfessionsgeschichte so bedeutsame Entwicklung vollzog sich schrittweise in einem allmählichen Ablösungsprozess. Aber schon in Heidelberg steigerte Luther die Wirkung der Disputation durch eine markante zweifache Alternative: In der 21. These brachte er die berühmt gewordene Gegenüberstellung von theologus crucis und theologus gloriae, dem Theologen des Kreuzes und dem der Herrlichkeit vor. Ersterer wolle Gott allein durch das Leiden Christi und das Kreuz hindurch erkennen – damit transformierte Luther unverkennbar Anliegen seiner eigenen monastischen Sozialisation. Der theologus gloriae hingegen bemühe sich, Gott anhand der geschöpflichen Dinge zu erkennen – die Anspielung auf die mittelalterliche Scholastik und ihre Gottesbeweise war damit unverkennbar. Luther griff also in gewisser Weise die Anliegen der Disputation gegen die scholastische Theologie neu auf. Er gab ihnen aber nun durch eine zweite Alternative eine rezeptionsgeschichtlich bedeutsame Zuspitzung, indem er in den zwölf Thesen zur Philosophie, die in der Ankündigung der Disputation den Zuhörern gemeinsam mit den 28 Thesen aus der Theologie vorlagen, den Aristotelismus scharf attackierte und den Platonismus in Schutz nahm. Damit zielte er an der humanistisch geprägten Universität Heidelberg, in deren Räumlichkeiten die Disputation stattfand, offenkundig auf die Sympathien des Publikums.
Stichwort
Aristotelismus und Platonismus
Schon im Frühmittelalter war das theologische Denken von der Logik des Aristoteles geprägt. Dies verstärkte sich mit der Wiederentdeckung des gesamten Corpus seiner Schriften im 12. und 13. Jahrhundert. Studenten an der artes-Fakultät wurden mit seinen Schriften oder Kommentaren hierzu befasst. Dem stand, vor allem seit im Zusammenhang des Konzils von Ferrara und Florenz die Begegnung mit griechischen Autoren möglich geworden war, eine auf Plato ausgerichtete Haltung der Humanisten entgegen, die vor allem in Italien vertreten, aber auch nördlich der Alpen aufgegriffen wurde.
Quelle
Die Heidelberger Disputation, These 1921 aus: KThGQ 3, S. 41 19.
Nicht der wird Theologe genannt, der das unsichtbare Wesen Gottes an den geschaffenen Dingen anschaut, 20. sondern der, der das unsichtbare Wesen Gottes und seine dem Menschen zugewandte Seite, wie sie durch die Leiden und das Kreuz geschaut wird, versteht. 21. Der Theologe der Herrlichkeit nennt das Böse gut und das Gute böse, der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge beim Namen.
Die auf monastischer Grundlage entwickelte Scholastikkritik Luthers konnte, das zeichnete sich hier ab, eine Allianz mit dem Humanismus eingehen, der sich ebenfalls als Alternative zur Scholastik verstand. Dies galt umso mehr, als Luther selbst auch in seiner Erfurter Zeit humanistische Einflüsse aufgenommen hatte und die Wittenberger Universität vielfach von humanistischen Anregungen geprägt war – prominentester Ausdruck für das Miteinander dieser geistigen Strömungen wurde Philipp Melanchthon (1497–1560). Der Tübinger Magister und ehemalige Heidelberger Student wurde noch 1518 nach Wittenberg berufen. Am 28. August hielt er dort seine Antrittsrede. Zeit seines Lebens stand er für die Verbindung von reformatorischer und humanistischer Bewegung. In Heidelberg allerdings waren es andere, die von den klaren Alternativen Luthers angezogen waren: Martin Bucer (1491–1551), der spätere Reformator Straßburgs gehörte ebenso zu den Zuhörern wie Johannes Brenz (1499–1570) und Erhard Schnepf (1495–1558), die zu wichtigen Gestalten der Württemberger Reformation werden sollten. Das Charisma des Wittenberger Mönchs und Professors hatte nun also durch einen beeindruckenden Auftritt, von dem noch ein Bericht Bucers Zeugnis ablegt, auch den Südwesten erreicht und für sich eingenommen.
Luthers Wirken war aber immer weniger auf persönliche Begegnungen begrenzt. Er wusste zunehmend mit der öffentlichen Rolle umzugehen, die ihm durch den Ablassstreit zugewachsen war. Während er die Heidelberger Disputation, abgesehen von der Ankündigung, nicht veröffentlichte, hat er wenige Tage, nachdem er am 12. Oktober in Augsburg von dem päpstlichen Legaten Kardinal Cajetan (1469–1534) verhört worden war, Akten dieses Gesprächs herausgebracht: So wollte er die Deutungshoheit über das Geschehen behalten. Wandte er sich hiermit, in lateinischer Sprache, noch an die Gelehrten, so trat immer mehr die deutschsprachige Öffentlichkeit, das heißt die in den Städten konzentrierte lesefähige Bevölkerung, in seinen Blick. Seine Schriften waren dabei in der Regel nicht agitatorisch und nahmen nur in Einzelfällen – etwa den Sermonen über den Ablass von 1517 und 1518 – direkt auf strittige Fragen Bezug. Vielmehr stand im Mittelpunkt seiner Veröffentlichungen die geistliche Erbauung der Gläubigen. Er schrieb eine Beichtanleitung, eine Auslegung des Vaterunsers, passionstheologische Betrachtungen oder auch ein Büchlein von der Bereitung zum Sterben, das die im Spätmittelalter beliebte Gattung der Sterbekunst, der ars moriendi, in einer stark christologisch zentrierten Weise transformierte. Erneut bestätigte sich das schon bei den Ablassthesen zu beobachtende Phänomen, dass die Mischung aus Vertrautem und Neuem die Wirkung ausmachte. Mit der „normativen Zentrierung“ (Berndt Hamm) traditioneller Themen auf Grundlage seiner sich zusehends klärenden Rechtfertigungslehre wurde Luther zu einem Erfolgsautor, den zudem der Geruch des Oppositionellen und von päpstlichen Behörden Verfolgten umwehte. Ohne dass man schon klare Fronten hätte unterscheiden können, formierte sich in den Städten eine Bewegung, die in den Anstößen aus Wittenberg eigene Anliegen aufgegriffen und entfaltet sah. Als charakteristisch für die sich vollziehende Orientierung an Luther kann man ansehen, dass im Laufe des Jahres 1518 vorwiegend unter dem Einfluss von Luthers Ordensbruder und Freund Wenzeslaus Linck (1483–1547) die dort bestehende sodalitas Staupitziana in eine sodalitas Martiniana umgewandelt wurde. Der Wittenberger Mönch war zum Helden und Orientierungspunkt geworden. Diese Entwicklung gewann an Kraft, als deutlich wurde, dass die verschiedenen schroffen Alternativen, die er aufmachte, nicht allein bestimmte Frömmigkeitsformen oder das akademische Leben betrafen, sondern die bestehende Kirche insgesamt.
Leipziger Disputation
Dies öffentlich zu machen, hat Luther selbst nicht offensiv angestrebt, sondern er wurde hierzu von eben jenem Johannes Eck getrieben, der 1517 noch seine Freundschaft gesucht hatte, durch den Ablassstreit aber zu seinem erbitterten Gegner geworden war. Nach einem längeren Vorlauf kam es vom 27. Juni bis zum 15. Juli 1519 in Leipzig, also auf einigermaßen neutralem, albertinisch-sächsischem Boden, zu einer Disputation zwischen Eck auf der einen und dem mittlerweile auch für die Reformation gewonnen Andreas Karlstadt sowie Martin Luther auf der anderen Seite. Vor einer gespannten Zuhörerschaft, zu der nicht nur Universitätsangehörige, sondern auch der Hof, ja zeitweise sogar Herzog Georg der Bärtige selbst (1500–1539), gehörten, bildete die Konfrontation zwischen Eck und Luther vom 4. bis 13. Juli das eigentliche Herzstück der Veranstaltung. Die treibende Kraft war der für seine Disputationskunst überregional berühmte Ingolstädter Professor. Ihm gelang es, Luther zu Aussagen zu bringen, die dieser so und in diesem Rahmen nicht treffen wollte. Aus der Debatte über das Haupt der Kirche heraus wies Eck seinem Kontrahenten nach, dass er Sätze behaupte, die Jan Hus gelehrt und das Konzil von Konstanz verurteilt habe. Schon dies erregte die Gemüter des sächsischen Hofs, an dem die mit den Hussiten im 15. Jahrhundert geführten Kriege noch sehr bewusst waren. Erst recht aber sprengte Luther den akzeptablen Bereich, als er erklärte, dass Konzilien auch in Sachen des Glaubens irren konnten: „Also gibt man uns ins Maul, dass wir, wir wollen oder wollen nit, sagen müssen: Das Concilium hat geirret“ (WA.B 1, S. 471, Z. 218f. [Nr. 192]), schrieb Luther dazu später seinem Landesvater Kurfürst Friedrich dem Weisen (1485–1525). Tatsächlich hatte Luther mit dieser Aussage die schon früher von ihm aus der kanonistischen Diskussion des späten Mittelalters aufgegriffene Überzeugung, dass Päpste und Konzilien irren könnten (WA 1, S. 656, Z. 32–37), zugespitzt und auf einen konkreten Fall angewandt. So recht wurde ihm erst jetzt deutlich, dass das seinerzeit noch aufrechterhaltene Vertrauen in ein repräsentatives Konzil nicht mehr gelten konnte: Keine kirchliche Instanz war mehr in der Lage, die Wahrheit einer Glaubensaussage zu gewährleisten. Was übrig blieb, war allein die Heilige Schrift. So wurde nun, im Sommer 1519, nach Solus Christus, Sola gratia und Sola fide auch die vierte Ausschließlichkeitsformel der Reformation, das Sola Scriptura, der Sache nach zu einem Grundsatz der reformatorischen Bewegung. Philipp Melanchthon zog diese Konsequenz als Erster mit der nötigen Deutlichkeit am 9. September in seinen Bakkalaureatsthesen: „Für einen Katholiken ist es nicht notwendig, über die Dinge hinaus, die ihm durch die Schrift bezeugt werden, noch weitere zu glauben“ (Melanchthons Werke, hg. v. Robert Stupperich. Bd. 1: Reformatorische Schriften, Gütersloh 1951, S. 24, Z. 29f.). Damit hatte die Reformation ein Formalprinzip an der Hand, das es ihr ermöglichte, die Kritik an der hergebrachten Kirche methodisch konsequent durchzuführen und zu begründen. Die Linie der Alternativen, die die bisherige Disputationspraxis durchzog, war nun, mit der Hebammenhilfe Johannes Ecks, in die Ekklesiologie (Kirchenlehre) gewendet. Die Schrift allein, das hieß: die Kirche nicht ohne die Schrift. Wer sich ohne Schriftbeleg auf die Tradition, die Väter, auch den 1517 noch von Luther so vehement in Schutz genommenen und weiterhin hochgehaltenen Augustin stützen wollte, wer sich auf eine Konzilsentscheidung oder gar nur ein päpstliches Dekret berufen wollte, konnte in reformatorischer Perspektive keine Geltung beanspruchen. Damit war aus einer akademischen Reformbewegung die reformatorische Bewegung geworden, welche das bislang gültige Autoritätengefüge im Grundsatz infrage stellte. Diese Zuspitzung folgt aber nicht allein einer inneren Logik des reformatorischen Denkens; dieses holte an manchen Stellen, wie das Beispiel des Sola Scriptura zeigt, seine Konsequenzen erst allmählich denkerisch ein. Sie verdankte sich vielmehr auch dem Umstand, dass die Gegner Luthers schon früh die auf die Frömmigkeitspraxis und ihre theologische Begründung ausgerichtete Frage Luthers im Blick auf ihre ekklesiologischen Konsequenzen bedacht und behandelt hatten.