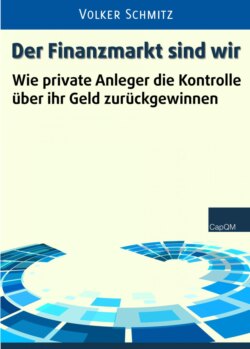Читать книгу Der Finanzmarkt sind wir - Volker Schmitz - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеWer interessiert sich schon für den Finanzmarkt? Eine abstrakte, trockene Materie mit viel Mathematik. Wir haben Besseres zu tun. Aber auch, wenn wir uns nicht für ihn interessieren: der Finanzmarkt interessiert sich für uns. Genau genommen, die Finanzunternehmen, die Vermittler auf dem Finanzmarkt. Sie interessieren sich zwar nicht für uns als Person, aber für unser Geld, unsere Ersparnisse. Unser Desinteresse lassen sie sich teuer bezahlen.
Dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson wird der Satz zugeschrieben, der Preis der Freiheit sei ewige Wachsamkeit. Auf dem Finanzmarkt hat unser Mangel an Wachsamkeit dazu geführt, dass wir Rechte an unserem Geld verlieren. Unternehmen und Menschen, die wir nicht kennen, können unser Geld für Zwecke verwenden, die uns schaden, und wir bezahlen sie auch noch dafür. Alles um den Preis des unverbindlichen Versprechens, uns eine gute Rendite zu erwirtschaften. Nachdem wir uns Jahrzehnte nicht richtig um unser Geld gekümmert haben, hat die jüngste Finanzkrise gezeigt, welchen Preis wir wirklich dafür zahlen müssen.
Wie konnte es dazu kommen? Zwar hatte der Finanzmarkt immer eine öffentliche Bedeutung, nur war sie der breiten Öffentlichkeit nie bewusst. Nach der Finanzkrise war sie allen klar. In den vergangenen Jahren hat sich eine Flut von Meinungen, Artikeln, Büchern und öffentlichen Reports über alle Medien verbreitet, die kaum einen Aspekt der Finanzkrise unbearbeitet gelassen hat. Journalisten, die vor kurzem noch die Märkte hatten hochleben lassen, durften nun kritische Artikel schreiben. Banker wurden ein beliebtes Ziel öffentlicher Kritik, insbesondere wegen ihrer Gehaltsexzesse. In hastig einberufenen Gremien saßen ehemalige Banker, Zentralbanker und Aufsichtsbeamte mit gegenwärtigen Bankern, Zentralbankern und Aufsichtsbeamten zusammen. Sie verfassten gründliche Analysen, wie nach ihrer fachkundigen Ansicht zukünftig Banker, Zentralbanker und Aufsichtsbeamte eine solche Krise verhindern könnten – wenn sie denn so wiederkäme.
Warum dann noch ein Buch über den Finanzmarkt? In der bisherigen Diskussion über den Finanzmarkt und seine Reform ist ein Beteiligter völlig unterschätzt worden: der private Anleger. Das mag erstaunlich erscheinen, da sein Schutz schließlich in jeder politischen Diskussion und bei jeder Gesetzesänderung als wichtiges Ziel genannt wird. Faktisch passiert wenig, um seine Position zu stärken. Die Gesetzesänderungen zielen meist darauf ab, den staatlichen Kontrolleuren mehr Rechte gegenüber den Finanzunternehmen einzuräumen. Dass die Finanzunternehmen dank der Kontrolle stabiler werden, soll auch dem privaten Anleger nutzen. Während die Finanzaufsicht mehr Kontrollrechte bekommen hat, muss sich der private Anleger statt mit mehr Rechten mit mehr Informationen zufrieden geben. Dadurch soll er besser in der Lage sein, auf Augenhöhe mit den Finanzunternehmen zu verhandeln. Faktisch kann er nichts verhandeln, sondern nur ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Da diese durch die neuen Vorschriften noch ausführlicher geworden sind, verhandelt er nicht auf Augenhöhe, sondern unterschreibt irgendwann blind. Bei den meisten privaten Anlegern ist nach der Finanzkrise nicht das Gefühl entstanden, dass sich ihre Stellung auf dem Finanzmarkt verbessert hat. Sie sehen sich einem politisch-finanziellen Komplex gegenüber, der manchmal für sie, vor allem aber über sie und ihre Köpfe hinweg entscheidet. An diesem Punkt beginnt das Buch.
Da alles Anlagekapital vom privaten Anleger ausgeht, muss unsere Position im Kapitalmarkt gestärkt werden. Auf dieser Idee basiert das Buch. Sein Ziel ist es, die unterschiedlichen Interessen der Akteure auf dem Kapitalmarkt zu verdeutlichen und so uns private Anleger dabei zu unterstützen, unsere eigenen Interessen wahrzunehmen – damit uns unsere Kapitalanlage insgesamt mehr nützt. Das Buch liefert Ansatzpunkte für eigenverantwortliches Handeln, beschreibt, welche Bedingungen dafür notwendig sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Gleichzeitig weist es auf rechtliche Hindernisse hin und damit auf den gesellschaftlichen Handlungsbedarf, um unsere Position als Anleger zu verbessern. Im Mittelpunkt des Buchs steht die langfristige Kapitalanlage im Aktienmarkt.
Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass Risiko und Rendite nicht die Bestimmungsfaktoren einer Kapitalanlage sind, sondern ihr mehr oder minder zufälliges Ergebnis. Die gängigen Anlagetheorien haben versucht, ein umfassendes wissenschaftliches Denkgebäude auf der Vorausschätzung von Risiken und Renditen aufzubauen. Darauf basiert die alte aktive Kapitalanlage. Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Fondsindustrie haben seit über 50 Jahren davon profitiert. Doch das Fundament ist nicht tragfähig. Risiko- und Renditeschätzungen sind zu unsicher, um als alleinige Leitlinie für unsere Anlageentscheidungen nützlich zu sein. Institutionelle und private Anleger wenden sich in Scharen der passiven Anlage zu. Diese leistet preisgünstig eine breite Risikostreuung ohne Renditeprognose. Es ist davon auszugehen, dass die passive Kapitalanlage ihr Wachstum noch einige Zeit fortsetzen wird. Zu vieles spricht für sie: ihre Transparenz, ihre geringen Kosten und die positiven Erfahrungen über immer längere Zeiträume. Sie belegen, dass der durchschnittliche Anleger mit der passiven Kapitalanlage nachweisbar bessere Renditen nach Abzug der Kosten erzielt als mit der alten aktiven Kapitalanlage.
Das Buch betrachtet Kapitalanlage vor allem als gesellschaftliche Tätigkeit. Auch passive Kapitalanlage ist nur eine neue gesellschaftliche Praxis und keine endgültige Wahrheit. Wie jede gesellschaftliche Praxis wird sie gesteuert von Ideologien, gesichert von Normen und unterstützt von Institutionen und Organisationen. Die Frage ist, ob die bestehenden gesellschaftlichen Voraussetzungen zu den Anforderungen der neuen Kapitalanlage passen. Und welche Änderungen nötig sind, damit die Anleger die Vorteile der neuen Anlage besser nutzen können. Jede gesellschaftliche Entwicklung bringt nicht nur Vorteile, sondern wirft auch neue Fragen auf, bringt Probleme und Nachteile. Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Welche Änderungen ergeben sich daraus für die Akteure im Finanzmarkt?