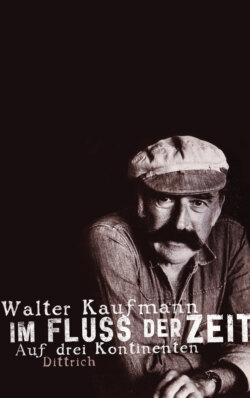Читать книгу Im Fluss der Zeit - Walter Kaufmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеAn jenem Sonntagmorgen des Dezembers 2008 hatte ich in den Berliner Kammerspielen gerade noch einen Platz in den oberen Rängen gefunden – das Theater war zu klein gewesen für die Veranstaltung mit der nunmehr fünfundachtzigjährigen Inge Keller. Anlässlich ihres Geburtstages hatte die Jubilarin Gregor Gysi in einem seiner Zwiegespräche mit Zeitgenossen Rede und Antwort gestanden. Auf ihre eigene, unnachahmliche Weise hatte sie Zeichen und Pausen gesetzt, sie den verstorbenen Theatermännern Barlog, Langhoff, Heinz und Busch Handküsse ins Jenseits zugeworfen und ihren heutigen Geburtstag ein gnadenvolles und zugleich schweres Datum genannt. Gegen Ende dann war es der Schauspielerin ein Anliegen gewesen, Volker Brauns Verse vorzutragen, die seit der Wende im Osten ein weites Echo gefunden hatten: »Da bin ich noch, mein Land ging in den Westen, KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE DEN PALÄSTEN. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. Es wirft sich weg und seine magre Zierde. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. Und ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und unverständlich wird mein ganzer Text. Was ich niemals besaß; wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. Wann sag ich wieder mein und meine alle.«
Von weit oben im Rang auf Inge Keller hinunterblickend, kommen mir Bilder ihrer Aufführungen in den Sinn, eindringlich ihre Frau Alving in Ibsens Gespenster, und unvergesslich auch noch nach so vielen Jahren ihre Iphigenie … und unversehens war ich in eine Nacht jenes jugoslawischen Sommers 1968 zurückversetzt, als sie Etta Cameron und mich nicht aus dem Blick gelassen hatte. Die Nacht war lau, im Himmel glänzten die Sterne, die Wellen der Adria schlugen sanft gegen die Felsen, und Inge Keller, allein an einem Tisch auf der Hotelveranda von Cavtat, hatte zugesehen, wie wir uns der Musik anpassten, wir eins wurden in der Bewegung, ein Mann und eine Frau aufs engste verbunden – dabei hatte dies unser letzter Tanz vor dem endgültigen Abschied sein sollen. Als die Band zu spielen aufhörte, waren Etta und ich zu den Klippen gegangen, schweigend hatten wir übers Meer geblickt, hin zu den fernen Inseln, über die sich das Abendlicht senkte, und wir sprachen auch nicht, als wir zurück zur Ortschaft gingen, wo, weitab von den Unterkünften der Filmcrew, zu der Etta gehörte, in einem Haus ein Zimmer für uns bereitstand. Doch als wir dort miteinander schliefen, ein letztes Mal, wie wir glaubten, war es für uns beide inniger denn je, und zugleich auch schmerzerfüllt. Und noch in den Morgenstunden widerrief ich die Absicht der Trennung, beteuerte, dass ich sie liebe und immer lieben würde. Sie hatte gelächelt, mich geküsst, mir war, als glaubte sie jedes meiner Worte. Innerlich erleichtert und zugleich auch wieder von den Konflikten bedrängt, denen ich hatte entgehen wollen, war ich abgereist. »Meine Wohnung in Berlin wird unsere Wohnung bleiben«, hatte ich ihr versichert, »Du kommst zu mir zurück, wenn deine Dreharbeiten hier getan sind.« Dem hatte sie mit einem leisem »Yes« zugestimmt und ich – war erleichtert gewesen.
Mitte der sechziger Jahre, nach der Veröffentlichung meines Reportagebandes Begegnung mit Amerika – heute, hatte es etliche Einladungen zu Lesungen in größerem und kleinerem Kreis gegeben. Auch zu einer der Soireen bei der Malerin Waluscha, einer gastlichen, mütterlichen Frau, die von dem Erlös ihrer Bilder einen Haushalt bestritt, zu dem auch eine Katzenfamilie gehörte. Die geräumige Wohnung am Berliner Prenzlauer Berg eignete sich gut für Geselligkeiten mit Wein und Gesang und stets fanden die Goulaschsuppen Anklang, die Waluscha aus enormen Töpfen schöpfte. Dabei waren es nie bloß Geselligkeiten, Lyrik wurde vorgetragen, Autoren lasen aus Manuskripten oder stellten eine Neuerscheinung vor. Zur Einführung meiner Amerika-Reportage hatte die Malerin auch eine schwarze Sängerin aus Boston eingeladen, die zurzeit in Berlin gastierte und die allein schon wegen meiner Harlem- und Südstaaten-Schilderungen das Gespräch mit mir suchte. Nachdem sie die in meinem Buch zitierten Gefängnisaufzeichnungen einer jungen weißen Bürgerrechtskämpferin aus Atlanta mit dem Blues Sometimes I feel like a motherless child untermalt hatte, war sie auf mich zugegangen. »How would you translate destined into German?«, hatte sie mich gefragt, und das waren die ersten Worte, die Etta Cameron an mich richtete.
Nie gekannte Gefühle bewegten mich, als ich zusammengekauert auf dem Zementfußboden hockte, um nicht verletzt zu werden. Ich zitterte am ganzen Körper, und trotzdem fürchtete ich mich im Grunde nicht. Ich wusste, sie konnten mit mir machen, was sie wollten, ich würde es ertragen. Der Fußboden war kalt, ich war ganz steif und fühlte mich sehr schlecht, und ich konnte nichts sehen, weil ich den Kopf in den Armen vergraben hatte. Ich war vollkommen allein und von nacktem Hass umgeben, aber meine Überzeugung verlieh mir genügend Kraft, alles furchtlos zu ertragen. Gewiss, ich fürchtete mich vor körperlichen Schmerzen, aber ich hatte keine Angst, dass ich in meiner Überzeugung wankend werden könnte. Lautlos sang ich Lieder wie We Shall Overcome, Down The Road und We Shall Not Be Moved. Und ich dachte im Stillen: Es sind nicht nur bloße Worte, sie haben eine tiefe Bedeutung. Ich hätte mich zutiefst gedemütigt fühlen müssen durch das, was der Mann über mich gesagt hatte, und durch die Art, wie ich dort kauerte, aber ich empfand im Gegenteil ein Gefühl des Stolzes. Ich wusste, man konnte mich nicht mehr demütigen als jeden Schwarzen, der in Amerika lebt und all dem ausgesetzt ist, was ich in dieser Zelle erdulden musste. Und ich erkannte, dass ich nicht nur um das Recht kämpfte, mit meinen Freunden in einem öffentlichen Restaurant zu sitzen und zu essen – ich kämpfte um das Ansehen und die Würde des Menschen. Wenn man meine Freunde nicht achtet, dann achtet man auch mich nicht, das ist meine feste Überzeugung. Alle diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich zitternd in der Zelle kauerte. Gewiss, mir kamen auch Zweifel, ob ich mir wirklich im Klaren war, wofür ich kämpfte; doch das dauerte nur einen Augenblick. Ich wusste, man konnte mich furchtbar schlagen und misshandeln, weil ich mich der Freiheitsbewegung der Schwarzen angeschlossen und mich dazu bekannt hatte, und ich wusste, dass ich stark bleiben und nicht schwach werden würde. Gott hat mir so viel gegeben – nicht weil ich es verdiene, sondern weil meine Haut zufällig weiß ist. Wenn ich vielleicht mehr wert bin als mancher andere, dann doch nur um meiner menschlichen Eigenschaften willen und nicht auf Grund eines physischen Merkmals, für das ich gar nichts kann. Ich sehe Hass und Ignoranz und Vorurteile und weiß nicht, mit welchen Mitteln ich dagegen kämpfen kann – es scheint so aussichtslos – aber ich muss den Mut haben und es versuchen. Und ich werde nicht aufgeben.4
Destined, vorbestimmt – wenig später hatte ich Angela, meine Frau, angerufen, um ihr zu sagen, es sei bei Waluscha noch recht gesellig und dass ich vorhabe, in Berlin zu übernachten. Sie zeigte sich nicht erstaunt, obwohl ich seit der Amerikareise meine Stadtwohnung nicht mehr genutzt hatte. »Bleib nur«, hatte sie gesagt, »ruf mich später noch mal an.« Dazu schwieg ich, zögerte und eben dieses Zögern ließ sie hinzufügen: »Musst du auch nicht – bis dahin schlafe ich sicher längst.« »Eben«, sagte ich, »bis morgen also. Schlaf gut.« »Du auch«, hörte ich sie antworten, dann legte sie auf. Einen kurzen Augenblick noch war ich am Telefon geblieben, hatte sogar erwogen, noch einmal anzurufen, es dann aber sein lassen und war zur Geselligkeit zurückgekehrt. Etta war umringt, ich sah sie schlank und grazil zwischen den Gästen, ihr schwarzes Haar glänzte im Kerzenlicht, an ihren Armen und Händen schimmerte Schmuck, ihr Lachen füllte den Raum. Ich hielt mich abseits, schenkte mir Whisky ein und sah aus den Augenwinkeln, wie sie sich von der Gruppe löste und dorthin zurückkehrte, wo wir gesessen hatten. Ich folgte ihr, und es stellte sich dieses Gefühl harmonischer Übereinstimmung ein. Wir hielten uns abseits und irgendwann bot ich ihr an, sie zum Hotel zu fahren. Sie schien erfreut darüber und bedankte sich. »Es liegt auf dem Weg«, sagte ich ihr. »You live in Berlin?«, fragte sie. »Only partially«, erwiderte ich, und beschrieb meine Anderthalbzimmer-Zweitwohnung. »Your retreat?« Ich nickte. Und lieferte ihr auch dafür das deutsche Wort: Zufluchtsort.
Ich hatte sie – längst nannten wir uns wie in Amerika üblich beim Vornamen – bis zur Hoteleinfahrt gefahren und dort verabschiedet. Durch das Seitenfenster sah ich, wie sie an der Rezeption den Schlüssel entgegennahm, das Foyer durchquerte und einen der Fahrstühle betrat. Die Tür glitt hinter ihr zu und sie war fort. Ich atmete tief – das war’s!, dachte ich und – blieb, als sei es so verabredet. Gut eine Viertelstunde später erst ließ ich den Motor an, fuhr jedoch selbst dann nicht los, weil ich sie aus einem der Fahrstühle hatte kommen sehen, in Jeans und Pullover, eine Stola über der Schulter und eine Tasche am Arm. Sie ging schnell dem Ausgang zu, und aus einer Art böser Neugier, einem Anflug irrationaler Eifersucht, schaltete ich den Motor wieder aus. Mit wem traf sie sich? Ich blickte die geparkten Autos entlang. Und da stand sie schon neben meinem. Ein wenig atemlos stand sie da. Wortlos öffnete ich den Wagenschlag und sie stieg ein. »If you had driven off«, hörte ich sie sagen, »it would have been forever.« Nicht gleich, doch später umso heftiger, prägte sich mir ein, was sie gesagt hatte – wärst du abgefahren, es wäre für immer gewesen … Und am nächsten Morgen, als sie in meinen Armen erwachte, lang nach der Dämmerung war es, wohl um die neunte Morgenstunde, beugte sie sich über mich und legte ihre vollen schönen Lippen auf meinen Mund. Und vorbestimmt war, dass wir nicht ein zweites Mal miteinander schliefen, wir ausklingen ließen, was die Nacht uns gegeben hatte. Sie blickte zum Schreibtisch, wo neben dem gerahmten Foto von Angela das Telefon stand: »Call your wife, darling«, sagte sie, »she’s waiting.«
Das offenbarte mir ihr Wesen, machte mir verständlich, dass sie sich als junges Mädchen für den Beruf einer Krankenschwester entschieden hatte, und sie sich davon nicht lösen wollte, als sie geheiratet und ihr Mann darauf bestanden hatte, dass sie ihn und nur ihn versorge. Ans Haus gebunden zu sein, entsprach ihr nicht, und schon bald kam es zu Auseinandersetzungen, die immer heftiger wurden, bis sie sich auflehnte und zu ihrem Beruf zurückkehrte. Fortan fehlte sie weit öfter, als er zu dulden bereit war, auch nachts. Er begann, sie zu beschimpfen, wollte wissen, wo sie sich herumtrieb, und als er sie eines Abends schlug, floh sie ins Schlafzimmer, schloss sich dort ein, nahm trotzig ein Kleid aus dem Schrank, ihr bestes, streifte es über und entkam durchs Fenster auf die Straße. Niemand folgte ihr. Sie lief um die Ecke und tauchte in einer kleinen Bar unter, wo leise eine Band spielte. Hier bedrängte sie keiner, niemand erhob Anspruch auf sie, sie fühlte sich befreit, und gab sich der Musik hin. Als der Bandleader an ihren Tisch trat, um ein paar Worte mit ihr zu wechseln, sagte sie ihm, sie könne freiheraus das Lied singen, das eben verklungen war – yes, here and now. Lächelnd hatte er ihr das Mikrophon gereicht, die Band schlug die Melodie wieder an, und sie, die nie zuvor öffentlich aufgetreten war, begann von dem irischen Mädchen zu singen, das auf die Wiederkehr seines Geliebten hoffte und die Sehnsucht jenes Mädchens empfand sie wie ihre eigene. Sie war eins geworden mit der jungen Irin, und als sie geendet hatte, war sie von Staunen erfüllt – was war geschehen? Wie nur hatte sie die Gefühle dieser jungen Frau so nachempfinden können? Nur langsam verebbte der Beifall, doch als der Bandleader sie bat, ein weiteres Lied zu singen, hatte sie abgelehnt. Der Anfang aber war gemacht, ihr Weg bestimmt …
Wie hatte es geschehen können, dass ich ohne Absprache vor dem Hotel auf sie gewartet und sie ihrerseits das Hotel für mich verlassen hatte? Wortlos hatte ich sie in meiner Wohnung in die Arme genommen, sie war zu Boden geglitten, hatte mich berührt, mich geküsst. Ich hatte sie entkleidet, und als ich sie zum Bett trug, sie sich an mich schmiegte, waren wir noch lange nach ihrem Aufschrei und meinem befreiten Lachen vereint geblieben. Und dass sie am Morgen darauf bestand, ich möge meine Frau anrufen, empfand ich wie eine Gabe. Mit Angela reden zu können, erleichterte mich derart, dass es mich für Etta befreite …
In den Wochen, die folgten, musste ich Angela nie verleugnen, Etta bewunderte ihre Schönheit, ihre Lebensart, fragte, wie sie mit ihren Berufen als Schauspielerin und Malerin, dem Haushalt und der Tochter zurechtkam, und als sie eines Tages – wie hatte sie so lange darüber schweigen können! – von ihren eigenen Kindern sprach, einem Mädchen und einem Jungen, die sie nach der Trennung von ihrem Mann in der Obhut ihrer Mutter in Boston hatte lassen müssen, war das wohl auch für sie eine Art Befreiung. Fortan aber, wohl fürchtend, dass mich der Gedanke an ihre Verpflichtungen entfremden könnte, schwieg sie darüber, zeigte sich lebensfroh und scheinbar sorglos, ungebunden und jederzeit zu reisen bereit und ich – reiste ihr nach, wenn es sich einrichten und irgendwie rechtfertigen ließ. Was nicht von Dauer sein konnte. In den Nachtklubs, bei den Jazzkonzerten, in den Kirchen, wo sie Spirituals sang, kam ich mir fehl am Platz vor, und ich gelangte erst in Einklang mit mir selbst, wenn ich sie für mich allein hatte. Das waren unsere Hochzeiten. Und emotionaler Tiefstand drohte, wenn ich dem Schreiben zu lange fernblieb. So kehrte ich also weiterhin zu Angela in unser Haus am Stadtrand zurück. Die Zweitwohnung mied ich allein schon, weil ich fürchtete, Ettas Anrufe aus Hotels in Cottbus, Magdeburg, Erfurt, Leipzig, Dresden könnten mich aus der Bahn werfen. Darling, I miss you so. I love you, love you, love you … und nahm hin, dass unsere Hochzeiten immer wieder auch zu einem Tief führten, und aus einem dieser Tiefs erlöste mich der Auftrag für ein weiteres Buch …
»Die Mittel sind genehmigt«, hatte ich zu Angela gesagt. »Eine zweite Amerikareise steht in Aussicht.« Sie schwieg dazu. »Ich würde vier Wochen fort sein, sechs allerhöchstens«, sagte ich ihr. Erst da reagierte sie, wandte sich mir zu. »Fährst du mit ihr oder zu ihr?« Die Worte trafen tief, und mit verräterischer Heiserkeit fragte ich: »Was soll das, Angela. Worüber redest du?« Ihre Augen schimmerten, sie kämpfte mit den Tränen und sagte leise: »Als ob es sich in diesem kleinen Land nicht herumspräche, wenn ein Schriftsteller einer bekannten Sängerin von Stadt zu Stadt nachreist.« Und in mein Schweigen hinein fuhr sie fort: »Ich begreife dich nicht, ich begreife dich einfach nicht. Hätte ich es von dir erfahren, ehrlich und offen – aber so …« Sie hob abwehrend die Hand, als ich sie besänftigen wollte. »Fährst du nun mit ihr oder zu ihr – mehr will ich nicht wissen.« »Weder noch«, versicherte ich ihr. »Ich fahre weg von ihr.« »Eine Flucht also, das Ganze eine Flucht.« »Nichts davon – der Verlag wird sich nicht zu beklagen haben. Weil ich nämlich arbeiten werde. Nur das. Und Etta vergessen!« »Das wird erst sein, wenn es ausgelebt ist. Vielleicht nicht einmal dann«, sagte Angela. Es war, als dränge sie mich zu Etta hin. Und ich griff danach wie ein Ertrinkender nach dem Floß. Wo war sie gerade, wo gastierte sie jetzt? Gänzlich unerwartet stand mir offen zu ihr zu fahren – vor der Amerikareise noch einmal eine Hochzeit … Aber ich sagte: »Es ist, wie es ist – ich muss Abstand gewinnen.« Angela sah mich an. »Armer Mann«, sagte sie, »armer, zerrissener Mann.«
Aus Hotelhallen, Restaurants und Bars und New Yorker U-Bahnstationen; aus einer Eisengießerei in Peoria, einer Gefängniszelle in Louisville, einem Pastorenhaus in Washington; aus der wilden, hemmungslosen Peppermint-Lounge in Chikago und aus dem Schwarzenghetto dieser Stadt; aus zahllosen Rasthäusern an zahllosen Autostraßen in Kentucky und Tennessee; aus dem Saal einer Kirche in Indianapolis und einem Friseurladen in Memphis hallen mir Stimmen entgegen. Sie hallen mir entgegen aus den Wolkenkratzerschluchten der Städte, vom Himmel herunter und aus den weiten Ebenen des Landes. Ich höre die Stimme eines Taxichauffeurs und eines Kernphysikers, einer Flugstewardess und einer Millionärstochter, jetzt Geliebte eines Schwarzen; ich höre einen Kommunisten reden und einen Industriemanager. Eine Million schwarzer Stimmen finden ein einstimmiges Echo, die einsame weiße Stimme verhallt ungehört, wird übertönt vom Lärm des Verkehrs. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner, keinen Mann auf der Straße, nur Widersprüche: ein radikaler Schwarzer will nichts mit mir zu tun haben, weil ich ihm nicht radikal genug bin; ein Universitätsprofessor gewährt mir nur deshalb ein Interview, weil ich aus einem sozialistischen Land komme; ein schwarzer Boxer beschimpft schwarze Frauen, weil sie sich weißen Männern hingeben, und nicht weit von ihm verführt ein schwarzes Mädchen einen weißen Mann und lockt ihn auf ihr Motelzimmer; ein weißer Gewerkschaftsführer rühmt die kämpferische Einheit schwarzer Arbeiter, und ein schwarzer Intellektueller beklagt den Mangel an Aktionseinheit, durch den 23 Millionen Schwarze zersplittert und einander feindlich sind. Zwei junge Studenten liegen bewusstlos auf dem Fußboden, taub gegen den entnervenden Jazzlärm eines Plattenspielers, berauscht von LSD; erst einen Tag zuvor waren beide aus der Haft entlassen worden, die sie der Widerstand gegen den Krieg in Vietnam gekostet hatte. Langhaarige Hippies von der love generation treten den Bajonetten der Nationalgarde mit Blumen entgegen, und unten im Hafen von New York verladen Schauerleute Waffen für Vietnam. USA – zerrissenes Land …5