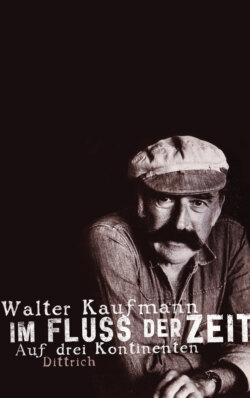Читать книгу Im Fluss der Zeit - Walter Kaufmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.
ОглавлениеZu den Klängen des 13. Klavierkonzerts von Mozart geht Barbara Kaufmann von uns, geht Barbara, das Bienchen, von mir, der sie lieb hatte und den sie mehr als sechzig Jahre lang still begleitete – in Australien bis hin nach Kleinmachnow. Wo wir sie heute bestatten. Das Andante hat uns auf sie eingestimmt, auf Barbaras Wesen und – ihre Seele. In ihrer Jugend spielte sie Klavier, sie malte, und gütig war sie, in der ihr eigenen zurückhaltenden Art den Menschen zugetan. Sie lebte ihre Ideale als Mitarbeiterin einer weltweiten Zeitschrift für Frauenrechte, wollte wenig für sich, viel für andere – und sie gab meinen Töchtern Rebekka und Deborah ihre Liebe. Zeitlebens, das weiß ich, betrauerte sie kinderlos geblieben zu sein. Ehe Barbara alterte und Pflege brauchte, war ihr Zuhause stets offen für meine Töchter und mich, wie unser Haus am Seeberg offen für sie war. Wir freuten uns auf Barbara und werden sie vermissen. Ruhe sanft. Du lebtest ein langes Leben, das bei allen Höhen und Tiefen ein erfülltes Leben war. Rest in Peace. Barbara.
Gedenkworte im November 2007
Barbara, meine erste Frau, starb im November des Jahres 2007 – wir trugen sie im Waldfriedhof von Kleinmachnow zu Grabe: Angela und die Töchter Rebekka und Deborah, die Enkeltöchter Lara und Rachel, auch Lissy kam – und zum Ende hin erschien auf dem langen nassen Weg vom Friedhofstor zur Kapelle Schwester Birgit, eine der Pflegerinnen des Heims Sonnenschein, in dem Barbara ihre letzten Lebensjahre verbracht hatte und dabei viel Zuneigung erfahren und zurückgegeben hatte. Sie brachte Blumen und, für sich allein in der letzten Reihe der Kapelle, hielt sie bis zum Ende der Gedenkfeier an den Blumen fest. … Die Klänge des Mozart’schen Andantes gingen ihr zu Herzen, gingen uns allen zu Herzen, und meine Lippen bebten, als ich meine Abschiedsworte sprach. Es brauchte viel Selbstbeherrschung für dieses letzte farewell, doch im kalten Nieselregen auf dem Weg zu Barbaras Grab war es mit der Beherrschung vorbei. Zu beiden Seiten schienen mich die Grabsteine zu bedrängen, fast versagten meine Beine, ich konnte mich der Emotionen nicht erwehren. Meine Töchter, auch Angela, wollten mich trösten, auch Lissy versuchte es und ließ es dann … es gab in diesen Augenblicken keinen Trost …
Barbara und ich begegneten uns im Krieg, im australischen Tocumwal, einer Kleinstadt mit Rangiergeleisen, an denen damals unsere Einheit für Verladearbeiten von Kriegsgütern eingesetzt war. Warum es sie dorthin verschlagen hatte, erfuhr ich nie, ich weiß nur, dass ich mich fragte, wie sie mich so bedenkenlos in ihre Nähe hatte lassen können – sie chiffrierte im militärischen Nachrichtendienst. Allein schon deswegen gab sie sich zurückhaltend, sprach fast nie über ihre Tätigkeit, zeigte sich aber an meiner Vergangenheit in Deutschland und meinem Leben danach interessiert – wer bist du, woher kommst du, wie und warum gelangtest du nach Australien? Sie wirkte gepflegt in ihrer Uniform mit den Rangabzeichen eines Sergeants, Rock und Jacke makellos geplättet, die braunen Lederschuhe spiegelblank, und unter dem breitkrempigen Hut hatte sie ihr Haar, das dunkel war wie ihre Augen, sorgfältig aufgesteckt. In den kurzen Stunden, die uns in Tocumwal beschieden waren, hatte sie nicht wenig über mich erfahren – Elternhaus, Flucht aus Nazideutschland, Internierung, Zukunftswünsche … Wie sonst hätte sie in ihren auf hauchdünnem Luftpostpapier geschriebenen Briefen, die mich bald aus diversen Gegenden Australiens erreichten, derart auf mich eingehen können. Selbst die Schilderungen ihres jeweiligen Umfelds bei Maroochydore in Queensland oder am Barrier Reef bis hoch nach Cairns waren durchwoben mit Fragen nach allem, was mich anging. Mit der Zeit wurden ihre Briefe zu Liebesbriefen, sie beschworen Sehnsüchte, die auch ich bald teilte, so dass ich eines Tages unseren Kompaniechef Leutnant Murray um Urlaub in den Norden bat …
Allein vier der acht Urlaubstage, die mir gewährt wurden, gingen mit Busfahrten über schier endlose Landstraßen dahin, mit Seereisen per Postschiff von Kap Byron zur Gold Coast … letztendlich blieben Barbara und mir nur vier Tage und drei Nächte in einem kleinen Gasthaus im Queensländischen Surfers Paradise, wo wir ein Zimmer mit Meerblick fanden, von dessen weitläufiger Veranda wir morgens die Sonne aufgehen und abends im Meer versinken sahen. Unter uns erstreckte sich die Sichel eines goldenen Strandes, der sich spät am Tag rot verfärbte, ständig wehten Winde, und immer begleitete uns das Rauschen des Meeres, der Schlag der Brecher. Wir liefen Hand in Hand den menschenleeren Strand entlang, und wenn die Sonne zu arg brannte, blieben wir im Schatten des Gasthausdaches und genossen den Blick von dort. In den Nächten, in der Umarmung, schwand alles Fremdsein, doch wenn ich Barbara morgens in ihrem blauen Sommerkleid mit den schmalen Trägern vor dem Spiegel stehen, oder mit dem Strohhut auf dem Schoß auf dem Bettrand sitzen sah, wirkte sie wieder wie ein Wesen aus einer anderen Welt – fremd, seltsam entrückt. Wie ich auf sie wirkte in meinen Jeans, Sandalen, mit Schiffermütze, vermag ich nicht zu sagen, sicher aber fühlten wir uns beide losgelöst von der Armee und – füreinander bestimmt. Das blieb so bis zur Stunde des Abschieds, der unser Gastwirt die Wehmut nahm, indem er uns zur Gitarre fröhliche Lieder singend den Strandweg entlang zur Bushaltestelle begleitete, von wo aus Barbara zurück in den ferneren Norden fuhr und ich in den Süden …
Ihr Brief, der mich bald darauf im Armeelager von Tocumwal erreichte, zeugte von Betroffenheit wie auch Empörung: Der Krieg hatte uns eingeholt, und nur von Leutnant Murray konnte ich zu dem, was sie schrieb, Rat erhoffen. Ich bat um eine Aussprache, die mir prompt gewährt wurde – nie schob der Kompaniechef Dinge auf die lange Bank, noch ließ er einen im Ungewissen. »Werde mich da nicht einmischen«, sagte er geradeheraus, »so eine Entscheidung muss von ganz oben gekommen sein – High Command.« Das leuchtete mir ein, trotzdem ersuchte ich ihn zu Protokoll zu geben, wie er die Männer aus unserer Einheit einschätzte. Schließlich waren wir alle erst nach Überprüfung in die Armee aufgenommen worden. »Geschenkt«, sagte Leutnant Murray, »dass ihr samt und sonders Nazigegner seid, wird auch dem High Command bekannt sein, was nicht ausschließt, dass für die da oben jeder aus dieser Einheit einen Risikofaktor darstellt. Cypher Codes unterliegen strengster Geheimhaltung. Offenbar war Ihre Bekannte für den Command nicht länger tragbar.« Es half nicht, dass ich einwarf, nie je irgendetwas über ihre Tätigkeit erfahren zu haben. »Auch das sei geschenkt«, sagte Leutnant Murray. »Und selbst wenn es anders wäre – ich weiß Sie einzuschätzen. Im Command aber kennt Sie keiner.« Er hielt inne, fuhr dann gelassener fort: »Außer vier Tagen Sonderurlaub kann ich nichts weiter für Sie tun. Beraten Sie sich mit der Frau.« Und damit entließ er mich.
Vier Tage. Barbara war vom hohen Norden in Melbourne eingetroffen. Und einen Tag später gelangte auch ich dorthin. Sie hatte im Wentworth ein Hotelzimmer belegt, das freudlos war, mit Blick auf einen Hinterhof der Flinders Lane. Und freudlos war auch unsere Stimmung, wir fühlten uns zwanghaft zusammengeworfen, abrupt vor Entscheidungen gestellt – was tun, wie weiter? Barbara rang sich ein Lächeln ab. Es sei gut, dass ich kommen konnte, sie sei froh darüber, ihre Entlassung aus der Armee aber hätte allein sie zu verantworten und die dürfe nicht mich belasten – und überhaupt, sie bereue nichts. »Surfers Paradise nimmt uns keiner.« Ich fühlte mich schuldlos schuldig. Da war sie nun, von einem Tag zum anderen ausgegrenzt und auf sich gestellt worden, wohnungslos, arbeitslos und ohne jegliche Unterstützung. »Ich werde schon nicht untergehen«, versicherte sie mir, »komme aus einer Familie, die zusammenhält, nur …« Sie hielt inne, woraus ich schloss, dass ihre Angehörigen über die Art ihres Ausscheidens aus der Armee wenig erfreut sein würden. »Vermutlich nicht«, gab sie zu, »aber entzweien wird uns das nicht.« Warum, fragte ich mich, hatte sie da nicht gleich um Entlassung nach Tasmanien, ihren Heimatstaat, gebeten. »Weil ich alles allein durchstehen will – ich will’s hier versuchen, in Melbourne, wo mich keiner kennt.« »Wir«, sagte ich. »Das geht uns beide an.« »Natürlich«, entgegnete sie, »nur musst du das nicht verantworten.« »Sind wir zusammen oder sind wir es nicht?« Sie antwortete: »Ja doch. Nur – hier herrscht Alltag. Und der ist grau.« Surfers Paradise, so erkannte ich, war für sie eine Art island in the sun gewesen, und unsere Begegnung in Tocumwal nur ein brief encounter, eine flüchtige Begegnung. Ich sah mich um. Und begriff sie vollends – grau die Wände, grau das Tageslicht, das vom Hinterhof ins Hotelzimmer drang. »Lass uns weg von hier«, sagte ich. Sie sah mich an. »Als wir noch in Melbourne stationiert waren«, erzählte ich ihr, »hatte ich in Parkville ein geräumiges Zimmer mit Aussicht ins Grüne – vielleicht ist das wieder zu haben.« Sie bezweifelte es. »Und falls doch, wird deine Wirtin nicht wissen wollen, mit wem du da plötzlich auftauchst?« »Mrs. O’Shamus«, sagte ich, »ist eine verständnisvolle Frau.«
Mit wem war ich da mit knapp zwanzig Jahren mein Leben zu teilen bereit – einer mütterlichen Freundin, einer liebevollen Gefährtin, einer erfahrenen Frau, die mir Geborgenheit bot? Jedenfalls kehrte ich zur Einheit mit dem Entschluss zurück, Barbara zu heiraten. Sie hatte in kürzester Zeit aus dem Zimmer in Parkville ein wohnliches Zuhause gemacht, indem sie die Möbel neu verteilte, Tisch und Stühle dorthin, den Sessel ans französische Fenster, sie das Deckenlicht zugunsten einer Stehlampe wegnahm und den Teppich so über die Dielen legte, dass deren schadhafte Stellen verdeckt waren. Gemeinsam hatten wir das alte Eisenbett eine halbe Treppe tiefer in eine Stube getragen, die gerade zum Schlafen reichte – und hatten so, mit Mrs. O’Shamus’ Zustimmung, zwei Räume zur Verfügung, wobei der größere jetzt wie ein Wohnzimmer wirkte – und vorstellbar war, dass Bilder, Bücher und das eine oder andere Erinnerungsstück dem Zimmer eine noch persönlichere Note geben würden. »Du wirst sehen«, sagte Barbara, »beim nächsten Urlaub …« Wie verwandelt war sie, seit wir hier eingezogen waren – ihre Entlassung aus der Armee schien sie kaum noch zu tangieren. »Alles fügt sich«, sagte sie, »und ja, Mrs. O’Shamus könnte nicht zuvorkommender sein, doch dürfen wir das nicht ausnutzen.« Vergeblich versuchte ich Barbara klarzumachen, dass Mrs. O’Shamus nichts so sehr wünschte, wie uns nützlich zu sein. Doch gerade das verweigerte Barbara ihr – und als Mrs. O’Shamus am Abend eines meiner Wochenendurlaube anklopfte, um nachzufragen, ob wir irgendwelche Wünsche hätten, bekam sie freundlich zu hören: »Nein, danke, Mrs. O’Shamus, uns fehlt nichts« – worauf sie sich nicht wieder meldete …
Barbara schrieb mir weit häufiger als ich ihr. Kaum eine Postverteilung verging, ohne einen Brief von ihr – die Wohnung mache sich gut, über die Küchenbenutzung sei sie mit Mrs. O’Shamus im Einvernehmen, ohnehin ginge sie ja jetzt früh zur Arbeit und käme spät wieder. Mir schien, als hätte sie die Stelle bei Robertson & Mullens, Melbournes größter Buchhandlung, nur mir zuliebe angetreten – von nun an, schrieb sie, könne sie mir günstig Bücher schicken, Romane, Erzählungen, Stücke, »was immer du dir wünschst«. Schon damals sah sie mich als Schriftsteller: »Du hast so viel erlebt, kannst gut erzählen – do it in writing.« Und als ich tatsächlich mit der Erzählung The Simple Things den begehrten Literaturpreis des Melbourner New Theatre gewann, fühlte sie sich bestätigt. »Wie mein Herz pochte, als ich in der Zeitung deinen Namen las. Ich war so stolz auf dich – und wollte mehr denn je deine Frau werden. Willst du mich wirklich immer noch heiraten? Bedenke, ich bin um Jahre älter als du.« Ja doch, beeilte ich mich, ihr zu versichern, nach wie vor wolle ich sie heiraten, die Vorbereitungen hätten sich nur verzögert, weil unsere Einheit verlegt werden sollte. Was dann aber nicht passierte – so sei also der letzte Samstag des kommenden Monats für die Trauung in Tocumwal festgesetzt. Einen Sonderurlaub würde mir Leutnant Murray kein zweites Mal gewähren, sicher aber ein freies Wochenende … Und so traten Barbara und ich an jenem sonnigen Samstag im Herbst 1944 vor den Altar der kleinen presbyterianischen Kirche.
November 1938, Stadt Duisburg im Rheinland:
Unser Haus mit der steinernen Treppe vor der Eingangstür – das Schloss gesprengt, die Tür eingeschlagen, sie hängt lose in den Angeln; neben der Tür die elektrische Klingel – aus der Wand gerissen, an zwei Drähten baumelnd. Käte ist nicht mehr bei uns – das Gesetz verbot uns eine Hausangestellte. Die schwingenden Glastüren im Flur – in Scherben, die Glassplitter auf den Teppichen knirschen unter den Füßen. Vaters Arbeitszimmer und die Bibliothek – ein wüstes Durcheinander von zerstörten Möbeln; die Bücherregale mit den Glasscheiben umgekippt, juristische Werke und Romane auf den Boden geworfen. »Der Zauberberg«, »Krieg und Frieden«, die »Deutsche Justiz« mit zerrissenen Einbänden in die Ecke geschleudert. Mutters Biedermeierzimmer – überall das gleiche Bild: alles in Trümmern, die Porzellansammlung ein Scherbenhaufen, die Landschaftsaquarelle mit Messern zerschnitten. Unten im Garten, in einem Blumenbeet, lag der Flügel wie eine große, hilflose Schildkröte auf dem Rücken. Die breiten Fenster waren eingeschlagen, die Rahmen herausgerissen.
Ich schreibe dies nieder wie einen bösen Traum, doch ohne Erregung jetzt, berichte von den Schrecken, die über uns kamen, plötzlich, auf Befehl, und mit einer so blinden Wut, dass es die ganze Zeit unwirklich schien. Viel Hass war in jenen Jahren gesät worden, sehr viel Hass, der an diesem Tage ungehindert tobte. Und dennoch habe ich Hoffnung.
Sturmabteilungen brechen mit Gewalt in ein Haus ein, trampeln alles nieder, demolieren, was ihnen in den Weg kommt, schlagen alles in Stücke, verhaften – das war eine Ordnung, die wir zerstören. Ja, wir zerstören sie: in unserem Herzen, in unserem Geist, jeder Einzelne von uns, zerstören sie durch unsere Art, zu leben, zu denken und zu handeln.
Vielleicht wurde meine Hoffnung an diesem Tag geboren, an diesem Novembertag in jenem Jahr. Ich habe die Hoffnung genährt, und sie ist größer geworden.
Es war ein langer Tag. Es war ein furchtbarer, ein grausamer Tag. Unser Volk, das jüdische Volk, wurde erniedrigt, verwundet und versprengt. Es dauerte lange, bis der Abend kam. Bei uns zu Haus gab es keine Tränen. Wir waren wie versteinert, vielleicht waren wir auch zu stolz für Tränen. Unsere Gedanken weilten beim Vater, der am Morgen verhaftet worden war, und wir beteten für ihn.
Dann, in der Nacht, kam ein Mann in unser Haus. Er ging durch die verwüsteten Zimmer, er sah alles und er war eine lange Zeit stumm. Er legte mir die Hand auf die Schultern und sagte: »Das währt nicht ewig.«
Zu Mutter sagte er: »Ich finde keine Worte für diese Schande.«
Er nahm einen zerbrochenen Tisch und einen Stuhl, trug beides hinaus und lud es auf einen Handwagen, mit dem er ins Dunkel der Nacht verschwand.
Der Mann war Tischler. Und Georgs Vater.6
In meiner Erinnerung sind die Vorbereitungen zur Trauung nur teilweise aufgehoben – wie war ich damals mit dem Pfarrer über die Trauung übereingekommen, wie kam es, dass er unseren Altersunterschied nie angesprochen hatte, wer war es, der sich neben meinem Freund Albert als zweiter Trauzeuge angeboten hatte, und wo in diesem Tocumwal, das eigentlich nur ein Eisenbahnknotenpunkt war, waren Barbara und ich zwei Nächte lang untergekommen? Sie selbst aber sehe ich deutlich vor mir – schlichtvornehm im hellgrauen Kostüm und mit einer Feder im Hütchen. Und wie sie nachsichtig über meine Ungeschicklichkeit, als ich ihr den Ehering überstreifte, lächelte, und natürlich bleibt mir der festlich gedeckte Tisch im großen Zelt der Armeeeinheit vor Augen, sehe ich unseren Koch, Sergeant Schmolka aus Wien, mit einladender Geste Suppe und Hammelbraten auftischen, und wie er nach dem Gelage Barbara half, die riesige Torte zu zerteilen. Von den Festreden und Trinksprüchen erinnere ich nur, dass sie sämtlich rau, aber herzlich waren, während alldieweil Bier und Wein floss. Von irgendwoher im Zelt rief jemand, »You’ll be sorry!«, Das wirst du bereuen – und da das in Australien bei fast jeder Hochzeit anklingt, rieb ich mich nicht daran, wohl aber dass uns irgendeiner nur zehn Ehejahre voraussagen wollte, weil ich da ja erst dreißig werden würde. – »Und wie alt ist dann die Braut?« Taktlos, der Kerl! Zum Teufel mit ihm. Ich liebte Barbara, glaubte an unsere Liebe, und war ihr dankbar, dass sie für mich da war. Und dann begannen sie alle aus voller Kehle »For they are jolly good fellows« zu singen, und froh gestimmt wurde noch einmal rundum mit uns angestoßen. Barbara strahlte …