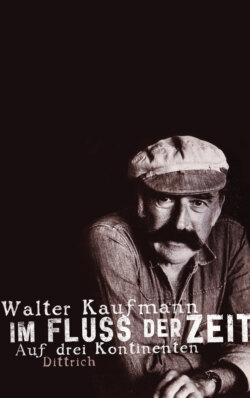Читать книгу Im Fluss der Zeit - Walter Kaufmann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеAm Morgen dieses Sonntags im November 2008 hatte ich zum siebzigsten Jahrestag der Nazi-Pogrome auf einer Straßenkundgebung in Moabit einer großen Schar von Zuhörern die Zerstörung meines Duisburger Elternhauses und die Verhaftung meines Vaters geschildert, und wie mich noch kurz vor Kriegsende die Nachricht erreichte, dass beide Eltern nach Theresienstadt verschleppt worden waren – in die Vorhölle von Auschwitz, wo sie ermordet wurden. Am Abend dieses Tages hatte ich mich im stillgelegten Flughafengebäude von Tempelhof eingefunden, wo bei einer Benefizveranstaltung der – wie die öffentliche Erklärung lautete – Reichskristallnacht gedacht werden sollte. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Tu was! und man hatte Hélène Grimaud, Menahem Pressler, Thomas Quasthoff und weitere namhafte Künstler dafür gewinnen können. Mir war ein Ehrenplatz zugedacht worden und gleich anfangs bewegte mich das von Hélène Grimaud gestaltete Bach’sche Chaconne – es hätte mir als abendfüllend ausgereicht – natürlich blieb ich, und so erlebte ich neben vielem, wie der greise israelische Pianist Menachem Pressler im Anschluss an seine Beethoven-Interpretationen die deutsche Sprache und die deutschen Tonschöpfer zu loben begann, was ihm, zumal ihm kein Wort der Anklage über die Lippen kam, viel guten Willen einbrachte. Als nach nahezu zwei Stunden die Feierlichkeit zu Ende ging, drängte sich aus den vorderen Reihen die geladene Prominenz die Treppe hoch zu einem kulinarischen Gelage, das geradezu geschaffen war, den Anlass des Abends vergessen zu lassen …
Nachdenklich verließ ich spätnachts das Flughafengebäude und erlebte in der U-Bahn, dass sich aus einer Schar von Glatzköpfigen einer löste, der sich laut über die Zeitung mokierte, die ich unterm Arm trug – die Jüdische Zeitung, auf deren Seite 18 ein Beitrag über mich und meine Bücher zu lesen stand. Ehe ich in Stadtmitte die U-Bahn wechselte, schob ich die Zeitung in meine Manteltasche … wobei mir urplötzlich die Erinnerung kam, dass ich als Zwölfjähriger so vorsichtig nicht gewesen war, als ich zwei SS-Offizieren als Erstes kundgetan hatte, dass ich jüdisch sei – ich war von der zum Halt ausrollenden Straßenbahn gestürzt und hatte mir das Knie verletzt und sie hatten ihren Mercedes angehalten, um mich zu verarzten und sich davon nicht abbringen lassen. »Pflicht ist Pflicht!«, hatten sie mir erklärt und nach geleisteter Hilfe darauf bestanden, mich nach Hause zu fahren. Den entsetzten Ausdruck meiner Mutter sollte ich mein Lebtag nicht vergessen – ihr Sohn in einem schwarzen Mercedes mit SS-Standarte … »Heil Hitler – hier haben Sie Ihren Bengel wieder!« Unter Tränen hatte sie gefragt, was ich denn angestellt hätte, worauf sie ihr geantwortet hatten: »Merken Sie sich eins – Deutsche können zwar hart sein, aber immer gerecht.« Dann waren sie weggefahren, und Mutter und ich hatten uns in den Armen gelegen – so wie ein Jahr später, als ich längst den harten Wind der Zeit zu spüren bekommen hatte. Schilder mit Juden unerwünscht! prangten da schon überall in der Stadt – vor Kaufhäusern, vor den Kinos, am Stadttheater, vor den Eingängen zum Fußballstadion und zur Rennbahn in Raffelberg. Selbst Parkbänke waren uns verboten. Zwar war ich auch weiterhin Sonntag morgens zu Naturfilmen im Mercator Palast gegangen, hatte es sogar gewagt, Karten für die Wagner-Opern Lohengrin und Meistersinger zu kaufen, die ich dann weit oben im vierten Rang erlebte, und ich war auch nach Köln zum Zirkus Sarasani gereist, um dort die Wassernixen im Riesenaquarium zu bewundern. Und doch, wirkungslos waren die Verbotsschilder nicht geblieben, und schon gar nicht die Zeitungskästen des Stürmer mit all den Fratzen und der in jeder Ausgabe wiederholten Behauptung Die Juden sind unser Unglück. All das hatte mich zunehmend aufsässiger gemacht, sogar gegen die eigene Mutter. Und als ich dann bei meiner Bar-Mizwa in der Synagoge aufgerufen wurde, einen Abschnitt aus der Thora vorzutragen, den ich mir mühsam Wort für Wort auf Hebräisch hatte einprägen müssen, ich anschließend in der feierlichen Stille zur Kanzel hochstieg, um den Segen zu empfangen und den Rabbiner raunen hörte: »Sei lieb zu deiner Mutter, mein Sohn«, beschämte mich das derart, dass ich mich abrupt abwandte und quer durch die Synagoge zur Treppe lief, die nach oben zu den Frauen führte. Die Orgel hatte zu spielen begonnen, doch das hörte ich nur noch wie von weiter Ferne, während ich der Mutter wieder und wieder versicherte, dass ich nie, nie … den Rest meiner Worte erstickte sie in der Umarmung.
Die Karten für das Tempelhofer Benefizkonzert waren teuer gewesen – bis zu 140 Euro hatten die vorderen Plätze gekostet. Der Erlös sollte der Freya von Moltke-Stiftung für die gegenseitige Verständigung junger Menschen zugesprochen werden. Beim Anblick der Zuhörer, alles wohlsituierte Leute mittleren Alters, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, unter all den Gästen einer der wenigen zu sein, der persönliche Erfahrungen mit den Nazis hatte – das Grauen, das mich beim Anblick der brennenden Synagoge packte, das Entsetzen, als die Flammen auf das Nebengebäude übergriffen, auf meine Schule, und die Erkenntnis, dass die Feuerwehr nur die anliegenden Gebäude vor den Flammen zu bewahren suchte. Vor der Synagoge in der Düsseldorfer Kasernenstraße hatte sich eine stumm gaffende Menschenmenge versammelt, bald aber war schadenfrohes Gejohle laut geworden – endlich büßten die Juden für den Mord in Paris. Ich wusste, was damit gemeint war – wer wusste in jenen Tagen nicht, dass in Paris ein deutscher Botschaftsmitarbeiter von einem jungen polnischen Juden erschossen worden war. Nur weg von hier, dachte ich, nur weg! Ich sah die Kuppel der Synagoge in die Flammen stürzen, die Flammen aus den zerborstenen Fenstern lodern, sah die Schule lichterloh brennen, ehe ich zur Straßenbahnhaltestelle rannte, von wo aus mich die Linie D von Düsseldorf nach Duisburg bringen würde. Mein Elternhaus erreichte ich in dem Augenblick, als zwei Männer in Regenmänteln und mit breitkrempigen Hüten den Vater die Steintreppe hinunter zur Straße führten. Vaters Blick war nach innen gerichtet – er schien mich nicht wahrzunehmen. Ich wollte etwas sagen, doch als sie ihn in den Mercedes stießen, brachte ich kein Wort hervor. Die Männer zwängten sich neben ihn, einer auf jeder Seite, die Türen wurden zugeschlagen – und dann war Vater fort. Ich lief ins Haus und suchte die Mutter. Nicht lange später hörten wir das Stampfen von Stiefeln auf der Steintreppe, krachend wurde die Haustür aufgebrochen, wir flohen in den Keller, hörten das Poltern über uns, hörten wie in den Zimmern unserer Wohnung die Möbel zertrümmert wurden, laute Stimmen drangen zu uns in den Keller, wieder stampften Stiefel über die Steintreppe, die SS-Männer schienen abzuziehen, ohne nach uns zu suchen – da beruhigte ich mich und ich schwor mir, dass ich eines Tages, eines Tages …
Ich dachte weiter an den Vater, immerzu dachte ich an ihn – wohin hatten sie ihn gebracht, was würde mit ihm geschehen? Es half wenig, dass ich versuchte, mich und die Mutter damit zu beruhigen, er sei doch ein bekannter Rechtsanwalt und früher Offizier im Krieg gewesen, mit Eisernem Kreuz, und Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde … das würde ihn sicher schützen. Sie schwieg dazu, und wohl da schon hatte sie den Entschluss gefasst, am folgenden Morgen im Polizeipräsidium nachzufragen, wo er zu finden sei. Nie vergesse ich, wie wir beide durch die langen Gänge irrten, wo unsere Schritte von den Wänden widerhallten, wir von Tür zu Tür liefen und die Mutter an mehrere anklopfte, ohne auch nur einen Hinweis über Vaters Verbleib zu bekommen, bis endlich ein Beamter in einem der Zimmer den Ort Dachau nannte, was die Mutter erbleichen ließ, und dann standen wir wieder vor dem roten Backsteingebäude und warteten auf die Straßenbahn, die uns zur Mühlheimerstraße bringen würde, von wo es nur ein paar Schritte zu unserem Haus waren … was es mit dem Ort Dachau auf sich hatte, begann ich erst zu ahnen, als nach drei Wochen mein Vater in das verwüstete Haus zurückkam, abgemagert und mit geschorenem Kopf. Er erklärte nichts, sagte nichts, und es brauchte auch keine Worte …
Schreib das auf, schreib es! Aber nicht nur über Vaters Heimkehr und den Tag seiner Festnahme, sondern auch von der guten Zeit würde ich schreiben, die mit meinem Wechsel zur jüdischen Schule in Düsseldorf begann, dem Neuanfang, der lange Straßenbahnfahrten und einen beträchtlichen Fußweg nötig machte – was ich gern auf mich nahm. Denn die neue Schule gab mir Einblicke in jüdisches Leben, jüdische Geschichte und – erstaunlich! – auch in deutsches Kulturgut, von dem ich im Realgymnasium wenig erfahren hatte. Herr Rothstein, mein neuer Deutschlehrer, regte zum Lesen von Dramen an, die ich auf der Bühne nur bei Umgehung von Verboten hätte erleben können – Goethe, Schiller, Kleist, Lessing. Er war mehr als nur ein Kenner, schätzte die deutsche Dramatik sehr, und auch Chaim Stern tat das, mit dem ich die Schulbank teilte. Stets hatte er ein zerfleddertes Reclam-Heft von Goethes Faust bei sich, aus dem er vorlas. Sie beide, Herr Rothstein und Chaim, regten mich zum Nachdenken über den tieferen Sinn jener Dramen an. Wegen seiner Besonnenheit und seines Wissens wirkte Chaim beträchtlich älter als ich, hatte mir aber nur wenige Wochen voraus. Er kam in Bundschuhen daher, kurzen Lederhosen – zünftig, wie ich fand – und in allem wollte ich es ihm nachtun. Und nur weil er aus Deutschland zu fliehen plante, über die Grenze nach Holland, und dann weiter bis nach Palästina, blieb ich zurückhaltend. Denn, früher oder später, würde ich ihn verlieren! Nächstes Jahr in Jerusalem, hatte er mir versichert. Mochte er dabei auch die Achseln gezuckt und beschwichtigend gelächelt haben, mir war klar, er meinte es ernst. Und als er dann eines Tages fehlte, mir ungeheuer fehlte, quälte mich die Befürchtung, seine Flucht könnte misslingen – und ich atmete erst auf, als mich endlich eine Bildpostkarte aus Eindhoven erreichte: Chasak, Schalom, Dein Chaim. Hatte er es bis nach Holland geschafft, würde er es auch bis Jerusalem schaffen – Chaim war auf dem Weg, seinem Weg, und das erleichterte mich sehr, besonders als mir nur wenige Wochen später klar wurde, dass er durch die Flucht seiner Verschleppung entgangen war. Denn wo waren sie plötzlich alle: Heinz Bialik, Itzig Perlson, Manne Spaski, Channele Bernstein und die anderen? Es fehlten an jenem Oktobermorgen sieben Schüler meiner Klasse, und alle waren sie polnischer Herkunft. Und so sehr bangte ich um Miriam Bronski und ihre Eltern, dass ich mich sofort vom Unterricht befreien ließ und nach Duisburg zurückfuhr. Die Tür zur Wohnung der Bronskis hing in den Angeln, kein Glöckchen läutete, als ich eintrat, und in der Schusterwerkstatt beim Fenster stand leer der Schemel. Das Werkzeug lag aufgereiht, und abholbereit auf den Regalen das geflickte Schuhwerk. In der Wohnung war der Tisch geräumt, der Boden gefegt, der siebenarmige Leuchter auf dem Schrank abgestellt … da war ich mir auch über das Schicksal der Bronskis klar. In Miriams Schlafstube fand ich eines ihrer Kleider ausgebreitet überm Bett, doch nirgends eine Nachricht für mich. Mir war, als hätte es uns zwei nie gegeben, nie unsere Ausflüge an die Ufer des Rheins, wo wir den Schleppern nachgeblickt hatten, die auf dem Weg nach Holland waren … Und als ich die Wohnung verließ und die Haustür wieder in die Angeln zu heben versuchte, schlug leise wie zum Abschied das Glöckchen an.
Es war drei Uhr morgens, als Dr. Ruben das Haus verließ. Die Prinz-Albrecht-Straße war still und dunkel, Regen fiel, und der Wind pfiff durch die herbstkahlen Bäume. Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße sah er ein parkendes Taxi, und er lief schneller, um es zu erreichen. Der Taxifahrer nickte müde, nachdem er das Ziel vernommen hatte. Der Mann fror, war übernächtigt und warf Dr. Ruben kaum einen Blick zu. Als sie am Hauptbahnhof ankamen, versperrten ihnen Polizisten den Weg. Der Fahrer schraubte das Fenster herunter und fragte: »Was ist denn hier los?«
»Geht Sie nichts an. Bis sechs bleibt die Auffahrt gesperrt!«
Dr. Ruben zahlte und stieg aus. Das Taxi wendete sofort und fuhr rasch weg. Der junge Polizist konnte mit Dr. Rubens Papieren nichts anfangen und gab sie an einen Vorgesetzten weiter. Der prüfte den Inhalt und ließ ihn passieren, dann wandte er sich um und sagte achselzuckend: »Weit kommt der nicht damit, das wird er schon merken!«
Vor der Bahnhofshalle parkten Wagen der SS und mehrere Militärfahrzeuge und eine Reihe Einsatzwagen der Polizei, von deren Dächern Scheinwerfer eine dichte Menge sich drängender Männer, Frauen und Kinder aus dem Dunkel rissen. Reisende, die verstohlen durch die rechte Glastür ein und aus gingen, wagten es kaum, den Kopf zu wenden und sahen zu, dass sie eilig verschwanden.
Zur Befriedigung Oberinspektor Runstedts schien die tags zuvor durch Himmler angeordnete Festnahme aller in Duisburg erreichbaren polnischen Juden reibungslos verlaufen zu sein. Er hatte Wehklagen und Gezeter erwartet, keineswegs diese meist stille Resignation der aus allen Ecken der Stadt auf Lastwagen und Bussen hergeschafften Menschen. Unnötig, dass die SS so herumschrie. Das konnte den Ablauf nur stören. Die Juden wehrten sich ja nicht, waren lediglich bemüht, sich mit ihren Bündeln, Koffern und Schachteln nicht gegenseitig zu behindern, und schienen sich mit ihrem Schicksal abzufinden.
Bald war die Bahnhofshalle vollgepfercht, der Zustrom brach ab. Die linken Eingänge wurden geschlossen, und die SS-Posten zogen Seile, um die Juden von den Schranken und Schalterfenstern zu trennen. Die Befehle verstummten. Dafür begannen Gestapobeamte sich mit Polizeioffizieren zu streiten, die ihrerseits den Bahnhofsvorsteher und andere Bahnangestellte zur Rede stellten. Allgemeine Verwirrung machte sich breit. Offensichtlich stand der Sonderzug nach Polen noch nicht auf dem vorgesehenen Gleis. Ein SS-Führer fauchte etwas von Schlamperei, ja sogar Sabotage.
Inzwischen war es vier Uhr geworden. Die Menschen hinter den Trennungsseilen froren, einige hatten sich Decken um die Schultern gelegt, Koffer waren an die Wand gestellt worden, damit die Alten sich setzen konnten. Man hatte auch versucht, den Kindern notdürftige Schlafstellen zu bereiten. Aus hellwachen, angstvollen Augen blickten sie um sich, nur wenige von ihnen, übermüdet und beruhigt durch den Zuspruch ihrer Eltern, schliefen ein.
Eine kleine Gruppe hatte sich zur Morgenandacht zusammengefunden. Ihr leiser Gesang drang hin zu ihren Bewachern. Die SS-Posten lachten, als sie sahen, dass die Männer die Arme entblößt und Gebetriemen angelegt hatten. Doch die Juden hatten die Gesichter gegen Osten gewandt und blieben im Gebet versunken.
Bei den Glastüren waren viele der jüngeren Juden um einen hochgewachsenen dunkelhaarigen Mann geschart. Mit beherrschter Stimme gab er Rat: »Zusammenhalten, helfen, wo Hilfe nötig ist. Schlome, du wirst Frau Seligs Koffer tragen, Miriam, du kümmerst dich um die kleine Ruth, sie schafft es nicht, ihr Brüderchen allein zu versorgen. Und du, Naomi …«
Nachdem alle ihre Aufgaben hatten, forderte er sie auf, die Hatikwa zu singen, und stimmte das Lied selbst an. Die anderen fielen ein, und mit der Melodie schienen auch wieder die Hoffnungen zu keimen.
»Ruhe in der Judenschule!«, brüllte ein SS-Mann.
Das Lied verstummte. Sie reichten einander die Hände. »Chasak«, sagte der dunkelhaarige Jude. »Seid stark!« Dann zerstreute sich die Gruppe. Bis Dr. Ruben von Oberinspektor Runstedt für sich und eine jüdische Krankenschwester die Zustimmung erwirkt hatte, durch die strenge Absperrung in die Bahnhofshalle zu gelangen, dämmerte es schon. Im grellen Scheinwerferlicht, das seine Schatten auf die Steinfliesen warf, gingen sie durch die Glastüren. Beim Anblick der gedrängten Menge fragte sich Dr. Ruben, was ihm hier noch zu tun übrig blieb. Die Anordnungen der Reichsregierung waren brutal, doch nichts dagegen auszurichten. Er konnte nur versuchen, die Not dieser Menschen lindern zu helfen. Die Krankenschwester bekam rasch viel zu tun, ihn aber trafen vorwurfsvolle, ja fast feindliche Blicke. Nachdem er den Schuhmacher Isidor Stern gefunden und ihn gebeten hatte, den Leuten mitzuteilen, dass er als Rechtsanwalt etwas für sie tun wollte, wandten sich einige mit Fragen an ihn. Er notierte die Anschriften von Verwandten in Chicago, Cape Town, Tel Aviv, Sydney und Buenos Aires, denen er Nachrichten zukommen lassen sollte.
»Mein Sohn Herschel in New York«, sagte ein alter Mann, »bitten Sie ihn, dass er jemand findet, der ein Affidavit schickt!« Er hielt besorgt inne. »Aber wohin soll man es schicken?«, fragte er dann.
»Ja, wohin?«, fielen andere ein.
»Zunächst an mich«, erklärte Dr. Ruben. »Sobald ich weiß, wohin man Sie gebracht hat, gebe ich alles weiter. Ich werde für Unterstützung aus dem Ausland sorgen und alles Nötige veranlassen, darauf haben Sie mein Wort!«
»Meine Tochter Chanele in Ramat Hadar«, unterbrach ihn eine Frau, »hier ist ihr Foto, bitte versuchen Sie, sie zu erreichen. Chanele ist meine Hoffnung, sie ist alles, was ich habe auf der Welt!«
Dr. Ruben schrieb sich die Adresse auf, nahm sogar Postgebühren entgegen, weil das die Bittenden beruhigte, versprach, sich um verlassene Wohnungen, Geschäfte und Eigentumsansprüche zu kümmern. Ein Mann drängte sich zu ihm und gab ihm vierzig Mark.
»Ich heiße Nathan Seligsohn, und das ist für die Miete, die ich noch schulde. Doch, doch, Sie müssen es ihr geben, sie ist eine gute Frau.« Er blickte auf die SS-Posten. »Nicht eine wie die hier. Sie wohnt …«
Dr. Ruben konnte gerade noch hören, wo die Wirtin wohnte, als eine Stimme gellte: »Achtung!« Vom Tunnel her kamen durch die Sperren Polizisten, Bahnangestellte und Gestapobeamte auf eine Gruppe höherer SS-Männer zu, zwischen denen Oberinspektor Runstedt zu erkennen war. »Achtung!«, gellte die Stimme wieder. »Fertigmachen und zur Kontrolle vortreten, dann ab zum Bahnsteig vierzehn, Gleis B.«
Nathan Seligsohn kehrte Dr. Ruben den Rücken und eilte zu seinem Gepäck. Die Menschen waren von ihren Bündeln und Koffern aufgesprungen und hatten sich den Sperren zugewandt, wo Polizisten mit Listen standen.
»Dem Alphabet nach!«, brüllte die Stimme.
Die Polizisten sprangen vor und riefen Namen auf: »Aaronsohn, Jakob, Aaronsohn, Ester, Abramowicz, Leib, Abramowicz, Sarah, Abramowicz, Rachel …«
Leib und Sarah Abramowicz traten zusammen vor, die Frau stützte sich schwer auf den Arm ihres Mannes und trug nur ein Bündel, er schleppte einen Koffer.
»Wo ist die andere, Rachel Abramowicz?«, fragte der Mann.
»Sie ist krank und liegt in einem Altersheim«, erklärte Leib Abramowicz.
Der Polizist sagte »Warten!« und eilte zu Oberinspektor Runstedt, der nach einem kurzen Blick auf die Bahnhofsuhr nur ein Wort erwiderte: »Herholen!« Der Beamte leitete den Befehl weiter, und Augenblicke später sprang vor dem Bahnhof ein Motor an, ein Einsatzwagen wendete, das Licht der Scheinwerfer strich über die Glastüren.
»Also vorwärts, meine Herrschaften!« Der Polizist hakte die Namen von Leib und Sarah Abramowicz ab.
»Sie wird sterben«, rief die Frau, »bitte können Sie nicht –«
»Ich kann gar nichts!«, unterbrach er sie, ohne von der Liste aufzublicken. »Aschkenasy, Joachim, Ascher, Moses, Ascher, Naomi, Ascher, Lea …«
Um fünf Uhr siebenunddreißig war die Halle geräumt. Polizei, SS-Posten und Gestapo waren im Tunnel verschwunden. Vor dem Bahnhof erloschen die Scheinwerfer. Grau und trist lag jetzt die Halle da. Ein paar Reisende bewegten sich beklommen auf die Schalter zu. Hinter den gespannten Seilen hatten Putzfrauen schon begonnen, den Boden zu fegen. Eine hob ein Gebetbuch auf, dann eine Puppe, einen Gürtel, einen Kinderschuh.
Punkt fünf Uhr achtundvierzig setzte sich auf Bahnsteig vierzehn ein zum Teil aus geschlossenen Viehwagen bestehender Sonderzug in Richtung Polen in Bewegung.
Vom Tunnel her kamen Dr. Ruben und die Krankenschwester zurück, gingen an den Schaltern und den Plakaten vorbei, die zu erholsamem Urlaub in Großdeutschland einluden, und traten ins Freie. Die Auffahrt war inzwischen von den Fahrzeugen geräumt, und nur noch die verspätete Ankunft eines Einsatzwagens mit der verstört dreinstarrenden Rachel Abramowicz erinnerte daran, dass dieser Tag nicht so gewöhnlich wie sonst begonnen hatte. Dr. Ruben ging auf das Auto zu, wies sich aus und bat, sich der Frau annehmen zu dürfen.
»Sie haben uns gerade noch gefehlt!«, wurde ihm entgegnet. Der Motor heulte auf, und der Wagen fuhr davon.
Kein Fahrzeug versperrte mehr die Eingänge. Alles sah so friedlich aus wie sonst an einem Wochentag vor dem Berufsverkehr.3