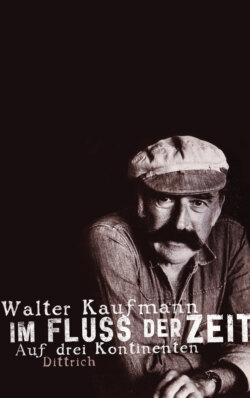Читать книгу Im Fluss der Zeit - Walter Kaufmann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.
ОглавлениеVon fern schon hatte ich das Bündel auf der Bank beim Märkischen Ufer wahrgenommen. Das war an einem Sonntagmorgen zu Jahresanfang, der kalt und frostig war, mit einem Himmel hoch und blau überm Fernsehturm und dem Roten Rathaus. Züge donnerten über die Geleise der Jannowitzbrücke, ich schritt schnell aus zum Bahnhof hin, dann aber stockten meine Schritte, als ich erkannte, das Bündel regte sich: Ein Obdachloser lag eingeigelt in seinem Schlafsack. Unter der Bank hatte er seine Stiefel abgestellt – dass man ihm die nicht stiehlt, hoffte ich. Ein Schuldgefühl überkam mich – der arme Kerl … in dieser Kälte. Ein Bote der Zeit, wie mir schien, Vorbote des Jahr 2009 – Bankenkrise, Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, zunehmende Armut …
Fast auf den Tag genau, siebzig Jahre zurück, lag auch ich eingeigelt – nicht im Freien zwar, und nicht in einem Schlafsack, sondern unterm Wintermantel auf der Pritsche eines Schlafsaals für Obdachlose im Osten von London, lag wach in der Nacht bis in den Morgen, angstvoll besorgt um meinen Koffer, meine Stiefel, die zehn deutsche Reichsmark in der Innentasche meiner Jacke. Immer wieder hustete, immer wieder keuchte einer, sprach einer im Schlaf, wälzte sich einer um, stöhnte einer, spuckte einer. Sie hatten mich seltsam gemustert, als ich eingeliefert wurde, und geradezu argwöhnisch, sobald sie mich sprechen hörten – was will der, was sagt der, woher kommt der?
Am 19. Januar 1939, dem Tag meines fünfzehnten Geburtstags, war ich dem Dover-London-Express in der Liverpool Street Station entstiegen, um mich herum jüdische Flüchtlingskinder von überall her in Deutschland, und alle hatten sie Leute, die nach ihnen suchten, sie empfingen, englische Ehepaare, die sich als Pflegeltern erboten hatten. Schnell leerte sich der Bahnsteig und keiner kam, um mich zu holen. Kein Onkel Hugo. Dabei hatten mir die Eltern in Duisburg versichert, dass ein Halbbruder des Vaters, ein reicher Reeder mit Namen Hugo Daniels, mich abholen würde. Zeit verstrich, der Nachmittag ging zur Neige, es wurde Abend, und noch immer kam niemand. Panik stieg in mir hoch, Verzweiflung. Wie lange noch sollte ich hier ausharren in der nebligen Kälte? Ich hielt Ausschau, hielt weiter Ausschau, bis endlich ein Mann von der Bahnhofsmission, der für die Betreuung der Kindertransporte zuständig war, sich meiner annahm, mich zu einer Telefonzelle führte, von wo aus er Mr. Hugo Daniels zu erreichen versuchte – vergeblich! In dessen Wohnung meldete sich niemand, so blieb dem Mann nur, mich ins Asyl zu bringen. Ein roter Doppeldeckerbus brachte uns dorthin, der schaukelnd von Haltestelle zu Haltestelle fuhr, bis er vor einer Schar Demonstranten zu halten gezwungen wurde. Ich las Losungen, hörte Sprechchöre und begriff nicht, was da gefordert wurde: We demand arms for Spain. Schließlich fuhr der Fahrer den Bus Meter für Meter durch die Menge, und dann, nicht lange später, waren wir am Ziel, war ich eingeliefert, eingewiesen, hatte ich im Schlafsaal eine Pritsche für die Nacht …
Bis in den Morgen hinein hütete ich meinen Koffer, bis von der Saaltür her etwas gerufen wurde, das wie mein Name klang. Da sprang ich auf, rannte zur Tür, wo mich ein hochgewachsener, grauhaariger Mann in einem dunklen, durchgeknöpften Überzieher und mit steifem Hut empfing. »Good morning, my boy. Better late than never.« Das verstand ich erst, als er mir in eigentümlichem Deutsch klarmachte, er habe mich erst heute erwartet, weshalb er gestern auch nicht am Bahnhof hatte sein können – »you understand«. Ich verstand ihn, doch ich verzieh ihm nicht und führte mich so störrisch auf, dass ich mir jegliche Anteilnahme verscherzte. Kaum waren wir in seiner schwarzen Limousine zu seiner Wohnung am Hyde Park gelangt, hörte ich ihn telefonieren. Ich ahnte, es ging um mich. Und wirklich, nicht lange nach dem Frühstück, das angerichtet war – Pampelmusensaft und Tee, Haferbrei, Schinken und Ei, und geräucherter Fisch –, wurde ich verabschiedet und fand ich mich nach kurzer Taxifahrt in einem Personenzug wieder, mitsamt meinem Koffer, fünf Schilling Bargeld und der Zeitschrift World Wide Magazine, die zu lesen mein Englisch nicht reichte. An die Zeitschrift war ein Stück Pappe geheftet, auf dem groß mein Ziel geschrieben stand: Faversham. Dort, so war mir eingeprägt worden, sollte ich aussteigen, und es setzte mir auch weiterhin zu, wie brüsk ich abgeschoben worden war – ein Frühstück, fünf Schillinge, eine Zeitschrift, und keine Frage nach den Eltern oder nach mir. Noch immer wollte ich nicht glauben, dass meine Ankunft in England falsch gemeldet gewesen war – und weit entfernt davon, meinem Wohltäter dankbar zu sein, verübelte ich ihm die Hast …
Auf dem Bahnsteig in Faversham kam eilig ein junger Mann mit den Worten auf mich zu: »You must be the newcomer.« Ich nickte, er klopfte mir auf die Schulter und, ins Schwäbische wechselnd, sagte er, er sei Fritz, der Gärtner vom Internat, griff sich meinen Koffer und trug ihn zu seinem Motorrad mit Beiwagen, das er vor dem Bahnhof geparkt hatte, schnallte den Koffer auf den Gepäckträger und schwang sich in den Sattel. Kaum war ich zugestiegen, gab er Gas. Ich fror im Zugwind, es war feuchtkalt, Januar in England, und nach der Fahrt war ich froh, dass im Kamin des Herrenhauses, das Bunce Court hieß und zum Internat gehörte, ein Holzfeuer loderte. Die Direktorin, eine füllige Frau mit schriller Stimme, musterte mich durch Brillengläser, dick wie Flaschenglas, und nur wegen meines spärlichen Englisch ließ sie sich aufs Deutsche ein: »Dieses eine Mal noch, später aber …« Sie duldete T. A. genannt zu werden, was für Tante Anna stand, und als ich sie am nächsten Tag durch ein Fenster schrill in den Park rufen hörte: »English, Walter Kaufmann, please!«, war es mir eine Lehre. Sie konnte mich durch ihre dicke Brille nicht erkannt haben, wer aber Gabi Adler, dem Boys-House-Ältesten, auf Deutsch geantwortet hatte, war ihrem feinen Gehör nicht entgangen. »English, please!« Es war, als würde ein Nichtschwimmer in einen Pool gestoßen: Ab sofort versuchte ich, nicht unterzugehen. Und weil dies eine deutsch-englische Schule vorwiegend für Emigrantenkinder war, kam ich täglich besser zurecht. Das dankte ich nicht bloß Gabi Adler, sondern auch Baruch Bamberger, der wie ich im Boys House wohnte. Er war der Sohn eines Bankdirektors, und hatte sich vorgenommen, in kürzester Zeit Englisch so fließend zu sprechen wie die Engländer. »Learn along with me«, forderte er mich auf – und so begann auch ich die Wörter zu pauken, die er aus dem Oxford Dictionary abgeschrieben und an der Wand über dem Tisch in seiner Stube befestigt hatte. Day, day-boarder, day-book, daybreak, daylight … Ja, ich paukte – an die zehn neue Vokabeln täglich. Dem eigentlichen Schulunterricht aber blieb ich fern, denn ich hatte mitbekommen, dass Freiwilligkeit herrschte – freiwillig der Unterricht, die Gartenarbeit, das Sauberhalten des Boys Houses, der Küchendienst. Das alles empfand ich als paradiesisch. Hier ließ es sich leben – und, weiß Gott, ich lebte. Bis Gabi Adler mir ins Gewissen redete. »So geht das nicht, old chum, du drückst das Niveau – reiß dich zusammen.« Und fortan fügte ich mich, bis im Park die Knospen sprossen und die Narzissen blühten …
Und hätte mich auch weiterhin gefügt, wäre ich nicht in einen Strudel von Gefühlen gerissen worden – Nadja Bernstein. Sie war schlank, von südlicher Sonne braun, war schön und sportlich, ihre krausen Locken fielen wirr und sie blickte forsch in die Welt. So blickte sie auch mich an. »Hab ein Zelt im Park«, sagte sie, »besuch mich mal.« Das war eine Versuchung, die mich aus der Bahn warf, mein Pflichtgefühl aushöhlte, und wieder strapazierte ich die Freiwilligkeit, vernachlässigte ich den Unterricht immer öfter, um Nadja in ihrem Zelt aufzusuchen. Es war eine selige Zeit. Nadja gefiel sich in der Eroberung. »Wieder mal Mathe geschwänzt«, stellte sie fest, und lachte. Das Zelt war eng und wir lagen eng. Die Sonne schien, der Mond schien, wir trafen uns zur Tages- und Nachtzeit, und wegen ihres überlegenen Lächelns wagte ich kaum sie zu berühren. Es war schon viel, dass ich ihre schlanken Beine an meinen spüren durfte, ihre Brüste auf meiner Haut. Wir flüsterten über dies und das – ich stellte mir ihre Vergangenheit vor, ihr Leben in Lemberg, wo sie herkam, und fand gut, dass auch ihr Vater Anwalt war. »Wirklich?«, rief sie und ließ sich derart spöttisch über den Beruf aus, dass ich den eigenen Vater nicht mehr erwähnte. Auch nicht mein Elternhaus – das schien mir ohnehin weit entrückt. Nadja war nah, und die Musik betörend, die sie nachts ihrem Kofferradio entlockte, sanfte ballroom music von Ambrose und seinem Orchester. »Toll, Nadja, hört sich gut an.« Und immer noch hatte ich sie nicht geküsst. Miriam Bronski, Ruth Tomasi – beide hatte ich geküsst. Und Nadja? Keinen Augenblick ging sie mir aus dem Sinn, ihr Lächeln aber, ihre Blicke aus den Augenwinkeln, ihre scharfzüngigen Antworten hielten mich in Schach. Allein sie aufsuchen zu dürfen war eine Gunst, und die wollte ich mir nicht verscherzen, nichts falsch machen – und tat das Falscheste. Ich weiß nicht wirklich, ob Genek Dambrowski mit Nadja schlief. Er hatte mir zwei Jahre voraus, war siebzehn, sportlich wie Nadja, ein gewandter Boxer, und obendrein gescheit, aber dass er sie in jener Nacht packte und küsste, verriet das Schattenspiel in der Zeltplane – und ich hörte Genek, hörte Nadja, und wusste, ich hatte sie verloren …
Ins seelische Gleichgewicht brachte mich erst Laszlo Déry wieder, unser Mathematiklehrer, und auch Miss Selby, die auf ihre Art so mütterliche Näherin mit dem dunklen weichen Haar, die ich Kathy nennen durfte, und die mir eines Tages vom argen Liebeskummer erzählte, der sie als junges Mädchen befallen hatte – »Ich war erst fünfzehn damals, so wie du jetzt«. Da ging mir auf, sie wusste, wie es um mich stand, und dass sie Anteil nahm. Natürlich entging mir nicht, wie sehr sie Mr. Wormleighton, unserem Englischlehrer, zugetan war – sie liebte ihn! Und ich hielt große Stücke darauf, dass sie mich einbezog, wenn er bei ihr auftauchte – »mein kleiner und mein großer Freund«, sagte sie und legte die Arme um uns beide. Was Mr. Wormleighton dazu brachte, mir zu gestatten ihn privat beim Vornamen zu nennen. Das durfte ich später auch bei Mr. Déry – was seine Autorität nicht schmälerte. Von Freund zu Freund riet er mir, stets Haltung zu bewahren – »was immer dich auch bedrücken mag«. Ich brauchte Nadja Bernstein nicht zu erwähnen, auch er schien Bescheid zu wissen. »Passierte uns allen mal«, versicherte er mir, »ist wie ein Fieber, und klingt ab.« In die Hand versprach ich ihm, wieder regelmäßig zum Unterricht zu kommen. Doch selbst als ich Nadja Bernstein überwunden hatte, blieb ich in Mathematik eine Niete. Enttäuscht, ja geradezu traurig sah mich Mr. Déry aus seinen warmherzigen braunen Augen an. »Manche lernen es nie, andere noch später«, sagte er, fügte dann aber lächelnd hinzu: »Seltsam, wo du doch in anderen Dingen ganz schön weit bist …«
Die Tage im Internat, »Bunce Courter Tage«, wie Gabi Adler sie nannte, begannen mit Waldläufen, Frühgymnastik, kalten Duschen, und dem gemeinsamen Frühstück am großen ovalen Tisch im Herrenhaus, ein Fest mit porridge und kipper … Haferschleim und Räucherfisch, Tee, Milch und Toast, bacon und eggs, gefolgt vom Unterricht in schöngeistigen und wissenschaftlichen Fächern. Wobei mir Mathematik und Physik ein Gräuel blieben, Englisch und Deutsch eine Lust. Fritz Berendt leitete uns im Garten und in der Tischlerei an, teilte uns ein für Dienste in der Küche, dem Boys House und den Waschräumen. Das alles ließ noch Zeit für Freizeitbeschäftigung. Allmählich brauchte ich Baruch Bambergers Hilfe immer weniger, mir gelang es, meinen Wortschatz ohne ihn zu bereichern, mit Oliver Twist, A Tale of Two Cities von Charles Dickens und Romanen von George Eliot und den Brontë-Schwestern. Immer fließender drückte ich mich in der fremden Sprache aus, T. A. brauchte nicht mehr durch den Park zu rufen, denn mein Englisch war nahezu impeccable, untadelig, geworden, wie Baruch Bamberger versicherte, und nach einer Reihe von Ferienwochen unter Engländern, in London, im Lake District und zuletzt auf Guernsey, war es tatsächlich so, dass mich die Arbeiterjungen aus den Londoner Slums, in deren Zeltlager ich einquartiert war, wegen meiner Ausdrucksweise scheel ansahen – ich hatte zu tun dem Image eines Eton Boys entgegenzuwirken. Sehr wohl hätte ich mich inzwischen im Umfeld des Hugo Daniels behaupten können – doch der … hielt sich fern. Nur ein einziges Mal besuchte er mich, und als ich bei der Gelegenheit für meine Eltern um Hilfe bat, nickte er nur abwesend und legte sich nicht fest. Was jegliche Dankbarkeit, die sich allmählich in mir aufgebaut hatte, schwinden ließ. Wieder sperrte ich mich gegen ihn und nach kürzester Zeit fuhr er in seiner chauffeur-gesteuerten schwarzen Limousine davon – und aus meinem Leben …