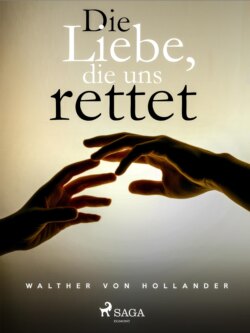Читать книгу Die Liebe, die uns rettet - Walther von Hollander - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеTante Anna Schreiner geborene Löpel von Löffelholz sitzt mit ihrer Nichte in der Veranda. Sie trinken nach einem schlechten Vorfestessen einen guten Mokka. Frau Schreiner raucht kleine parfümierte Zigaretten, die sie einer Emailledose entnimmt. Eine Zigarette nach der andern. Tante Anna, der „Familienrichter“, hat ihr Urteil über Alfred Meimberg abgegeben. Jung, angenehm, nicht bedeutend genug für eine Schreiner und nicht reich genug, um das Manko an Bedeutung auszugleichen. Also eine ausgesprochene Liebesheirat. Weshalb hat Barbara unter tausend jungen Männern, die alle gleich hübsch, gleich tüchtig und gleich angenehm sind, gerade diesen einen Alfred Meimberg ausgesucht?
Jeden andern Menschen, der diese Frage stellte, würde Barbara auslachen. Aber Tante Anna ist mit ihrem gesunden Menschenverstand und ihrem harten Witz die Autorität ihrer Kindertage. Ihr versucht sie es zu erklären. Dass sie nach einem schweren Arbeitsleben unter lauter Kranken einen gesunden einfachen und hellen Menschen brauchte. Dass sie nach einer Liebesenttäuschung mit einem bedeutenden, aber unübersichtlichen Mann diesen zuverlässigen Menschen haben wollte. Sie glaubt ausserdem nicht, dass Alfred Meimberg in seiner Art unbedeutend ist. Aber es kommt ihr auch nicht darauf an. Er ist auf alle Fälle ein echter Mann mit allen guten und ganz wenigen schlechten Eigenschaften der Männer.
„Er ist reizend“, sagt Frau Schreiner, „gepflegt, hübsch und exakt. Aber du bist ein aussergewöhnliches Mädchen.“ Barbara schüttelt den Kopf. Sie will nicht aussergewöhnlich sein.
„Wer gewöhnlich sein will“, nickt die geborene Löpel, „der ist es nicht. Die alte Exzellenz, der Staatsminister Löpel, setzte sich zu den Bierkutschern. Behauptete, dass er sich nur in der Kutscherkneipe wohl fühlte. War eben ein ungewöhnlicher Mensch mit der Sehnsucht nach dem Gewöhnlichen, und das ist besser als der gewöhnliche Mensch mit der Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen. Und reich werdet ihr auch nicht sein? Aber das macht wohl nichts. Ihr jungen Leute versteht ja sowieso nichts mit Reichtum anzufangen. Aber wie ist es mit seinen Beziehungen zur Regierung? Normal? Also keine?“
„Du rätst mir also entschieden ab“, lächelt Barbara.
„Nein“, sagt Frau Schreiner, „ich will dir nur klarmachen, wie das Leben wirklich ist, ausserhalb der sanften Luft eurer Krankenzimmer und der rosa Atmosphäre einer Verlobungszeit. Ich will dir die Riesenenttäuschungen ersparen, die jede Frau im Anfang ihrer Ehe hat.“
Sie berichtet ausführlich, was sie in den ersten Jahren ihrer Ehe ausgestanden hat. Wenn sie damals gewusst hätte, was sie jetzt weiss ... Nun ja, sie hätte schliesslich ihren Otto, den dicken Schreiner, auch geheiratet, aber sie hätte nicht Dinge bei ihm gesucht, die unmöglich zu finden waren. Es ist also zum ersten entscheidend, mit welchen Erwartungen man eine Ehe anfängt. Zum zweiten muss man wissen, wer in der Ehe führen soll. Nach aussen natürlich führt der Mann. Immer. Wenigstens, wenn die Frau Takt und Würde hat. Aber in Wirklichkeit muss die Frau oft führen. Das darf der Mann allerdings nie merken. Er bestimmt. Aber was er bestimmt, das bestimmt die Frau. Klar? Nein? Barbara schüttelt den Kopf. Sie hat die letzten Aphorismen nicht mehr gehört. Sie denkt über etwas sehr Merkwürdiges nach.
„Etwas sehr Merkwürdiges?“ fragt die Tante, ärgerlich, dass sie ihre gescheiten Aphorismen so unnütz wie Zigarettenrauch in die Sommerluft geblasen hat. „Etwas Merkwürdiges? Da bin ich ja gespannt.“
„Ich habe heute meine erste Liebe getroffen“, sagt Barbara und nimmt sich eine der parfümierten Zigaretten. Die Tante wartet, aber Barbara spricht nicht weiter. „Du erzähltest vor Jahren davon“, nickt die Löpel. „Natürlich in Schreinerscher Manier. Ein Kaufmann aus China war’s oder so. Hattest sogar ein Bild von ihm. Hager, verkniffen, gescheit und reich ... Das war er doch ...?“
„Ich war heute mit ihm in einem Café“, fährt Barbara fort.
„Verabredet?“ fragt die Tante streng. „Am Tage vor der Hochzeit verabredet?“
Barbara schüttelt den Kopf. „Nein, zufällig getroffen!“ Die Tante schlägt die Hände erregt zusammen. „Getroffen ... zufällig getroffen! Allah ist gross, und Berlin ist klein. Kaum zu glauben.“
„Hätte ich ihn nicht heute getroffen“, sagt Barbara, „so hätte er morgen angerufen. Gekommen wäre er doch.“
„Nun und ...?“ drängt Tante Anna.
„... und“, sagt Barbara, „nichts und. Aus. Schluss. Ich habe ihm gesagt, ich reise fort. Ich reise nicht allein fort. Da ist die Sache doch erledigt. Nicht wahr?“
„Möglich“, antwortet Anna Schreiner, „wenn er ein ehrlicher, gewissenhafter, ordentlicher Mensch ist, dann ist es erledigt. Wenn er aber der Mann von damals ist, der sich mit Chinesen und Japanern, mit Mongolen und Russen herumgeschlagen hat, dann ist das nicht so klar.“
„Es ist trotzdem einfach“, meint Barbara, „morgen abend sind wir weg. Schluss. Und wenn bis dahin irgend etwas passiert ... Du hast ganz recht, unmöglich ist es nicht ... Denn wenn etwas unmöglich ist, dann fängt es an ihn zu reizen ... Also dann muss eben Alfred mit ihm sprechen. Ganz einfach. Nicht wahr?“
„Alfred mit ihm sprechen?“ fragt Tante Anna leise. „Weiss er es denn schon? Nein? Na, Gott sei Dank! Ist es deine Sache oder seine? Wie? Willst du ihn gleich mit deinen nicht fertiggemachten Geschichten plagen? Das rührt den Mann anfangs, sage ich dir, aber später erbittert es ihn. Bist du ein Mädchen aus Grossmutters Zeiten oder eine selbständige junge Frau von heute? Um Himmels willen, lass Alfred aus dem Spiel. Du kommst in eine ganz fatale Lage. Du siehst wie schuldig aus. Zufällig Herrn Rauthammer getroffen? Schön. So etwas kommt vor. Aber hast du auch zufällig mit ihm in einem Café gesessen? Wie? Und hast du früher mit deinem Alfred über Rauthammer gesprochen? Nein! Natürlich nicht. Die Schreiners sprechen nicht über Herzensangelegenheiten. Also in allem Ernst: Du kannst hinterdrein in einem guten Augenblick die Geschichte ausführlich erzählen, aber jetzt in der Hetze unmöglich.“ Barbara ist aufgestanden. Sie hat sich über die Brüstung der Veranda gelehnt. Sie sieht in den Frieden des sommerlichen Gartens, in die Sonne, die rosenrot durch den Blutahorn auf den Rasen scheint. Sie sieht dem Geschwätz und Gezänk eines Spatzenpaares zu, dem Wind, der sanft durch die Pappeln des Nachbargartens geht. Es ist alles ganz einfach. Warum soll dieses eigentlich nicht einfach sein? „Ich wollte es Alfred schon auf dem Bahnhof sagen“, sagt sie leise, „aber der Zug kam eine Minute zu früh, und er kam zwei Minuten zu spät. Da ging es nicht.“
„Das war Schicksal“, unterbricht Frau Schreiner. „Ihr Schreiners glaubt doch alle an das Schicksal. Na also.“
Es kommt nicht zu einer Entscheidung. Denn die Brettwitz fährt dazwischen und hat viel zu fragen und zu berichten. Pakete, Päckchen, Telegramme sind gekommen, Blumen mit Briefen dran, Klivia und Azalee, Rosenstöcke und ein Fliederbäumchen. Die Wohnung wird allmählich in einen Blumenladen verwandelt.
Es ist drei Uhr. Barbara packt schnell ihren ersten Koffer. Sie legt die medizinischen Zeitschriften unten hinein. Dann kommt das Bild der Mutter, das zarte Pastellbild einer schmalen Frau, von der Barbara die breiten Backenknochen hat, den sehr grossen Mund mit den federdünnen Lippen (aber die hellen, ins Grünliche schimmernden Augen hat sie vom Vater), sie nimmt von ihren Büchern zwei medizinische Fachbücher mit und zwei Liebesromane, weil sie sich denkt, es muss ganz komisch sein, die wirkliche und die beschriebene Liebe nebeneinander zu erleben. Und dann kommen Schuhe und Kleider und Wäsche.
Vier Uhr. Sie muss schnell auf einen Sprung zur Schwiegermutter, Frau Generalmajor Meimberg, und dann hinüber zu Sophie Mahnke, zum Freundinnenabschiedskaffee. Die Brettwitz ist entsetzt. Jetzt vor dem Polterabend kann doch Barbara nicht mehr wegfahren. Aber Barbara muss diese Besuche erledigen. Sie hinterlässt die Telephonnummer von Sophie Wahnke und fährt los.
Eigentlich ist es doch Unsinn. Frau Meimberg schickt sie gleich weiter, nachdem sie ihr einmal in die Augen gesehen und feierlich genickt hat, und mit der Freundin Sophie kann sie nicht reden. Denn die drei anderen Freundinnen sind junge Ehefrauen, kichern und gackern und fühlen sich der Braut geheimnisvoll überlegen. Sie sind durch eine Wand ehelicher Erlebnisse von den „beiden Mädchen“ getrennt. Sie sagen immerfort: „Mein Mann“. Sie sagen: „Wenn er nach Hause kommt und die Suppe steht noch nicht auf dem Tisch“ oder „Ein paar Mark vom Wirtschaftsgeld muss man übersparen, wovon soll man sonst Strümpfe und einen Lippenstift kriegen“, oder „eigentlich soll ich ja nicht mehr ohne ihn ausgehen ...“ Oder „hier meine Kleine, goldig. Und neulich sagte sie schon ...“ Und dann flüstern sie wieder untereinander und tun, als wenn Barbara durch das Heiraten in eine ganz ungewisse, ganz unerhörte, noch von niemandem ausser ihnen erlebte Sache hineinkäme. Bis Sophie Wahnke böse wird und ihnen ihre Meinung sagt. Dass sie noch nichts verstanden haben, weder als Frauen noch als Mütter. Dass sie sich nichts darauf einbilden sollen, dass sie zufällig einen Mann gekriegt haben. Dass sie alle drei schöne Mädchen gewesen sind und sich nun mal in dem Spiegel sehen sollen. Sehen doch alt und verbraucht aus neben Sophie und Barbara, und man könnte meinen, dass die Ehe eine Folterkammer ist und eine Altersanstalt. Denn auch die Männer, die man auf den Bildern bewundern durfte, sind, um die Wahrheit zu sagen, nicht schöner geworden, sondern beleidigte Dickbäuche, hochnäsige Gockel, sauerlächelnde Väter. Sie, Sophie, dankt für sowas. Und Barbara sagt dasselbe in ihrer Art, zarter also und klarer: wenn man sich ansieht, wie die Menschen durch Ehe, Liebe und Kinderkriegen werden, kriegt man wirklich Angst. Aber die Frage ist: Muss man so werden? Sie sagt: nein, nein. Man muss auch schön und schöner werden können. Wie ihre Mutter immer schöner wurde, leuchtender, herzlicher und trotz aller wilden, turbulenten Ausbrüche eine harmonische herrliche Frau. Die drei Frauen, die eigentlich gekommen sind, um aus ihren recht jämmerlichen Erfahrungen einiges mitzuteilen, nicken. Aber sie begreifen nichts. Es wird sehr ungemütlich. Man tauscht Erinnerungen aus. Anderes hat man nicht auszutauschen. Es ist wie eine Erlösung, dass Barbara am Telephon verlangt wird. „Ja“, sagt Barbara unwillig, „ich bin hier.“
Sophie Wahnke sieht, dass sie einen grossen Schreck bekommen hat.
„Nein“, sagt sie jetzt, „nein, nein, ganz unmöglich. Unmöglich. Ich heirate doch. Ich sagte es Ihnen ja. Jawohl, ich heirate morgen.“
Sophie schiebt die Freundinnen aus dem Zimmer. Man muss Barbara allein lassen. „Nein, ich will ganz und gar nicht. Niemals ...“ Das ist das Letzte, was die andern zu hören kriegen.
Barbara steht allein im Zimmer. Sie sagt nichts mehr. Aber drüben Rauthammer spricht. „Warum haben Sie es mir nicht gleich gesagt, dass Sie heiraten“, flüstert er, „warum waren Sie so geheimnisvoll? Warum sagen Sie es jetzt plötzlich? Sind Sie noch da? So sprechen Sie doch ein Wort! Ich bitte Sie. Also wenn Sie nicht sprechen, so hören Sie wenigstens. Ich muss Sie sprechen. Haben Sie verstanden? Ich wusste nicht, wie wichtig es für mich ist. Ich dachte auch, man hat Zeit. Aber da sieht man es wieder. Nie hat man Zeit. Nie. Man muss immer gleich zupacken. Es ist natürlich meine Schuld. Das gebe ich zu. Aber Sie können mich jetzt nicht einfach hier sitzenlassen ...“
„Ich will nun abhängen“, sagt Barbara, „ich will nichts mehr hören. Es ist doch alles ganz einerlei. Nicht wahr ... ganz einerlei ...“
„Ich muss Sie sprechen“, sagt Rauthammer ganz böse, „haben Sie mich verstanden? Ich muss Sie sprechen. Also werde ich Sie sprechen ... das ist doch ...“
Weiter hört Barbara nicht. Denn sie hat den Hörer aufgelegt. „... ganz klar“, fährt Rauthammer in seinem Hotelzimmer fort. „Erst wenn ich Ihnen gesagt habe, was ich sagen muss, können Sie mich wegschicken. Nein, so einfach kann man die Sache nun doch nicht beenden. Man muss schon soviel Mut aufbringen ...“
Da merkt er, dass er in den toten Apparat hineinspricht. Er legt schnell auf. Er ruft nochmals an. Er wartet. Drüben stehen Sophie Wahnke und Barbara Schreiner vor dem klingelnden Telephon. Barbara hat die Hand der Freundin auf ihr klopfendes Herz gelegt.
„Ist das alles so schlimm?“ fragt Sophie.
Barbara nickt. „Ja ... doch ... es ist schlimm. Ich habe gar nicht mehr an Rauthammer gedacht. Und nun merke ich eben ...“
„Was merkst du ...“, drängt Sophie.
„Nun merke ich, die Sache hat doch immer weitergelebt. Das ist doch verrückt: man denkt, es ist ganz und gar aus ...“
„Und da ... jetzt“, sagt Sophie und zeigt auf den klingelnden Apparat, „da, jetzt hört man: es ist doch nicht aus. Klingelt und klingelt.“
„In Wirklichkeit“, antwortet Barbara, „ist es noch verwirrter. Ich liebe nämlich ganz allein Alfred. Das ist die Wahrheit. Das schwöre ich dir.“
Der Apparat klingelt immer noch. Bricht ab. Beginnt von neuem zu klingeln. Denn Rauthammer hat abgehängt und aufs neue angerufen.
„Wir werden einfach nicht hinhören“, sagt Sophie, „der Mann kann uns doch schliesslich nicht zwingen zuzuhören.“
Die drei andern, die jungen Frauen, kommen wieder herein. Sie umstehen zu fünfen den klingelnden Apparat wie ein ungezogenes Baby. Sie lachen, sie schieben ein Stück Papier in die Klingel. Sie bewundern die Hartnäckigkeit des Klinglers und bewundern Barbaras Nerven, die das Klingeln aushält, ohne abzuheben. Sie können schliesslich nicht das Ende der ganzen Sache abwarten. Unter grossem Gelächter und bei gleichbleibendem Läuten verabschieden sich alle und gehen.
Sie kommen aus dem Haus, vier lachende, gut angezogene, nette Frauen. Die Sonne scheint noch immer. Es ist sehr heiss. Von einer Spätlinde kommt ein betäubender Duft. Adieu, adieu! Sie umarmen sich. Alles Gute!
Ach, man braucht Barbara gar nicht „alles Gute“ zu wünschen. Sie funkelt ja förmlich vor Glück. Ihre Augen leuchten, und sie hat Farben ... herrlich ...
„Mach, dass du nach Hause kommst“, sagt die eine.
Und die andere: „Er läutet immer noch. Hört mal!“
Wirklich: man hört den Apparat bis auf die Strasse schrillen. Dann hört man Sophie sprechen. Was sie sagt, ist nicht zu verstehen. Sie horchen. Sie lachen. Barbara winkt den andern und fährt im Autobus ab. Oben aber sagt Sophie in den Apparat: „Barbara ist fort, Herr Rauthammer. Es wird auch alles umsonst sein, was Sie anstellen. Glauben Sie mir. Sie machen höchstens sich und ihr das Leben schwer. Mehr kann nicht herauskommen.“
„Sehr freundlich“, antwortet Rauthammer, „sehr nett von Ihnen, mir einen Rat zu geben. Vielleicht können wir die ganze Sache noch einmal miteinander bereden. Ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Wie meinen Sie? Ach jetzt haben Sie keine Zeit? Nachher auch nicht? Morgen, wie bitte, morgen ... da muss sich doch irgendeine Zeit finden lassen. Oder doch besser jetzt gleich? Nein? Also wir werden sehen? Ja, wir werden sehen. Vielen Dank.“
Er geht endlich von seinem Apparat weg, aus seinem Zimmer. Er fährt im Fahrstuhl herunter, geht eilig aus dem Hotel. Es scheint, er hat sehr wichtige Dinge zu erledigen.