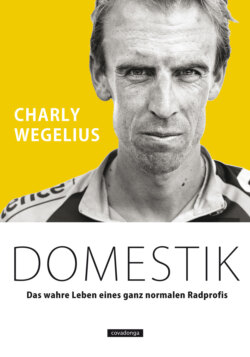Читать книгу Domestik - Wegelius Charly - Страница 10
ОглавлениеKAPITEL 2
VON EHRGEIZ GETRIEBEN
Als ich Ende 1998 nach Großbritannien zurückkehrte, wusste ich, dass ich mir ein paar Gedanken machen müsste. Ich zog wieder bei meiner Mutter in York ein und führte zahllose Telefonate, um zu erkunden, welche Möglichkeiten mir in der Saison 1999 offenstanden. Ich hatte soeben dem renommiertesten Amateurteam in Frankreich den Rücken gekehrt und war dementsprechend nicht scharf darauf, mit einer anderen französischen Mannschaft dem gleichen System erhalten zu bleiben. Ich hatte einen mutigen Schritt gewagt und ein Umfeld verlassen, das für mich nicht funktionierte. Nun galt es herauszufinden, was funktionieren würde.
Dann erhielt ich einen Anruf, mit dem sich eine ganz neue Richtung auftat.
»Charly, ich bin’s, Ken. Wie stehen die Aktien?«
Ken war mein Trainer und rief normalerweise an, um das Training zu besprechen, also setzte ich ihn kurz über meine körperliche Verfassung ins Bild: »Ehrlich gesagt bin ich immer noch ziemlich müde, Ken. Keine Krankheiten oder so, aber du weißt ja, wie das ist, wenn man auf der Suche nach einem Team ist.«
»Eigentlich rufe ich dich genau deswegen an. Wie wär’s, wenn du zum Velodrom in Manchester kämst, um mit John und mir über das neue World-Class-Programm zu sprechen? Ich glaube, das könnte was für dich sein.«
Ken Matheson war mein Coach, seitdem ich 16 war. Wegen der Entfernung und weil ich mich an das vom Team verordnete Trainingsprogramm halten musste, war unsere berufliche Beziehung während meiner Zeit in Frankreich zum Erliegen gekommen, trotzdem standen wir uns immer noch nah. Neben Mike Taylor, den ich so oft es ging angerufen hatte (ohne zu viel Geld für Telefonkarten auszugeben), gehörte Ken zu den wenigen Leuten, derentwegen ich in Frankreich eine Telefonzelle aufsuchte, wenn ich einen Rat brauchte. Ken war vor kurzem zum Leiter des neuen Förderprogramms der U23 ernannt worden und sah darin die perfekte Gelegenheit, unsere gemeinsame Arbeit wieder aufzunehmen.
Im Vorjahr war ich bei den U23-Straßenweltmeisterschaften im holländischen Valkenburg für Großbritannien an den Start gegangen. Schon damals hatte es Pläne gegeben, ein Förderprogramm für ambitionierte britische Fahrer einzurichten, aber ich hatte keinen Gedanken daran verschwendet, dass es etwas für mich sein könnte. Bis dahin hatte es für britische Fahrer im Ausland keinerlei Unterstützung finanzieller oder sonstiger Natur seitens des Verbandes gegeben. Ich hatte lediglich ein kleines Stipendium vom Dave Rayner Fund bekommen, einer Stiftung, die in Gedenken an den gleichnamigen britischen Fahrer eingerichtet worden war, der unter tragischen Umständen zu Tode gekommen war. Die Stiftung unterstützte jährlich eine Handvoll britischer Fahrer, aber für den nationalen Verband war die Welt des professionellen Radsports ein Mysterium, so wie auch für die meisten britischen Fahrer.
Es war nicht nur eine Frage fehlender Mittel. Es fehlte an der Kompetenz, den richtigen Kontakten und dem Verständnis für das Profigeschäft. Auf nationaler Ebene war der Radsport in Großbritannien damals so miserabel organisiert, dass Generationen von Fahrern praktisch gezwungen waren, ihr Glück in der unberechenbaren Welt des Amateurradsports auf dem europäischen Festland zu versuchen. Doch ohne, dass ich es mitbekommen hatte, hatte sich in letzter Zeit offenbar einiges getan, und dank des World Class Performance Plans, kurz WCPP, würde sich auch für mich vieles verändern.
Ein paar Tage später fand ich mich im fensterlosen, kühlen Büro des WCPP in den Katakomben des Manchester Velodrome ein. Mir gegenüber saßen Ken Matheson und John Herety, der Teamchef der Nationalmannschaft. Ich kannte Ken so gut, dass ich mich angesichts des formellen Rahmens und Tonfalls des Gesprächs ein wenig unbehaglich fühlte.
Es war John, der als Erster das Wort ergriff: »Ich weiß, dass du dir ungefähr denken kannst, worum es hier geht. Im Wesentlichen sieht es so aus, dass wir für die Finanzierung grünes Licht bekommen haben und Peter Keen die Idee eines Förderprogramms für British Cycling entwickelt hat. Unser Ziel ist es, ein System auf die Beine zu stellen, das junge Fahrer finanziell unterstützt und ihnen die Ausrüstung und die notwendigen Trainingsmöglichkeiten bereitstellt, damit sie die Chance haben, bei Welt- und Europameisterschaften konkurrenzfähig zu sein.
Du bist als einer der Fahrer ausgemacht worden, die das Talent mitbringen, bei großen Meisterschaften um die Medaillen mitzufahren, und wir möchten dir für das Jahr 1999 einen Platz im Programm anbieten … und wenn du in diesen Rennen für uns an den Start gehst, bedeutet das für dich natürlich auch die Chance, dich für einen Platz in einem Profiteam zu empfehlen.«
Sie erläuterten mir die Einzelheiten des Deals. Ich würde ein Gehalt von 12.000 Pfund bekommen und in Großbritannien stationiert sein, von wo aus ich mit der Nationalmannschaft zu Rennen in ganz Europa reisen würde. John und Ken wussten natürlich ganz genau, dass mich vor allem eines interessierte: Mehr als Geld und Medaillen wollte ich einen Profivertrag. Alles andere diente nur dazu, mich dorthin zu bringen.
Obwohl es verlockend klang, wollte ich nichts überstürzen. Ken und John gaben sich alle Mühe, mir sämtliche Vorzüge des neuen Programms vor Augen zu führen. Zwar stimmte es, dass dem WCPP ein beachtliches Budget zur Verfügung stand, trotzdem hatte ich nach wie vor das Gefühl, dass sie eigentlich nicht wussten, was sie taten. Es gab ein neues Logo und einen neuen Briefkopf und Leute, die Wettkampfprogramme herumfaxten, aber letztlich war es immer noch der britische Radsportverband und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass es möglich sein sollte, bei einem Profiteam auf dem Festland unterzukommen, solange man in Großbritannien ansässig war. Insgeheim war ich nach wie vor überzeugt, dass Radprofis auf eine ganze bestimmte Weise geschmiedet wurden; auf dem europäischen Festland zu leben und zu fahren, war bis dahin ganz einfach die einzige Möglichkeit gewesen, es zu schaffen. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht.
»Kann ich noch ein bisschen Bedenkzeit haben?«
Ken und John wirkten beide ein wenig perplex. Sie hatten mir soeben ein Angebot gemacht, um das sich viele britische Fahrer gerissen hätten, und ich zierte mich.
In den folgenden Tagen grübelte ich über einer Entscheidung. Das Problem war, dass der Weg ins Profigeschäft aus meiner Sicht grundsätzlich über das Ausland führte. Mannschaften wie Vendée U in Frankreich und vergleichbare Amateurteams in Italien und Spanien brachten jedes Jahr zwei oder drei Profis hervor. Soweit ich wusste, hatte es in der Geschichte nur ein einziger britischer Fahrer zu den Profis geschafft, ohne den Umweg über das europäische Amateursystem zu machen, und das war Chris Boardman. Er war aber die Ausnahme von der Regel; als absoluter Zeitfahrspezialist hatte er es außerdem vermieden, jemals ein echter Teil der europäischen Radsportszene zu werden.
Mir war klar, dass der WCPP die Geschichte nicht auf seiner Seite hatte, aber andererseits würde er mir die Gelegenheit geben, wieder mit Ken zusammenzuarbeiten. Ken hatte mich seit meinem ersten Rennen bei den Junioren betreut. Er wusste besser als jeder andere, wie mein Körper reagierte, und seine Trainingskonzepte passten perfekt zu meinen physischen Möglichkeiten. Sich wieder mit ihm zusammenzutun, war ein gutes Argument. Das andere große Plus war, dass sich das Programm ausschließlich an junge Fahrer richtete und mir ermöglichen würde, U23-Weltcuprennen zu bestreiten. Nach zwei Jahren, in denen ich als Amateur gefahren und bei vielen Rennen gegen Profis angetreten war, mochte das auf den ersten Blick wie ein Rückschritt zu den Junioren aussehen. Aber nun, im U23-Weltcup, würde ich mich mit den weltweit besten Fahrern meines Alters messen. Ich würde mich für die Profiteams ins Schaufenster stellen.
Eine gewisse Skrupellosigkeit meinerseits gab letztlich den Ausschlag darüber, sich dem Programm anzuschließen, statt auf das europäische Festland zurückzukehren. Ich kannte so ungefähr das Niveau der anderen Fahrer, die für den WCPP in Frage kamen, und wusste, dass ich auf der Straße der einzig aussichtsreiche Kandidat war. Somit würde das gesamte Programm auf meine Bedürfnisse maßgeschneidert werden müssen. Damit der WCPP erfolgreich wäre, müsste ich erfolgreich sein. Das Programm war darauf angelegt, mir die besten Bedingungen zu ermöglichen. Sie brauchten mich, und ich brauchte sie.
Zwar war die Konkurrenz wesentlich überschaubarer, aber auch das U23-System hatte seine Tücken. Die Altersbegrenzung gaukelte den Fahrern eine Art Verfallsdatum vor, was mir schon in Frankreich im Hinterkopf herumgespukt war. Als ich darüber nachdachte, in der U23 an den Start zu gehen, rückten solche Überlegungen jetzt wieder in den Vordergrund. Unter uns jungen Fahrern herrschte die Vorstellung, dass der Zug quasi abgefahren wäre, hatte man die 23 erst einmal überschritten. Im Nachhinein wurde mir klar, dass das Blödsinn war. Junge Fahrer brauchen unterschiedlich lange, um sich zu entwickeln, und es gibt keine Altersgrenze dafür, wann man Profi werden kann. Wie jeder andere auch hatte ich es einfach sehr eilig gehabt. Schon bevor ich für den WCPP zusagte, war ich ein recht verbissener junger Mann gewesen. Aber nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, bei dem Programm mitzumachen, war es erst recht so, als würde die Uhr ticken. Wir schrieben das Jahr 1999, mir blieben noch zwei Jahre in der U23, aber innerlich dachte ich, dass es in diesem Jahr passieren müsste.
Doch bei diesem Unterfangen hätte ich kaum einen schlechteren Start erwischen können.
* * *
Ich wachte nachts mehrmals unter Schmerzen auf, in diesen gestärkten, weißen Laken, an denen man ein Krankenhausbett sofort erkennt. Ich war kein einziges Mal wach genug, um einen klaren Gedanken zu fassen, aber ich konnte Stimmen hören. Ganz in der Nähe vernahm ich zwei mit unverkennbar irischem Akzent.
»… als junge Kerle so im Wald herumzuturnen …«
»Tja, wenn er nicht durchkommt … ich hoffe nur, er macht mal hin, ich würde echt gerne nach Hause.«
Am nächsten Tag erwachte ich mit großen Schmerzen und mir fiel wieder ein, was geschehen war. Es war November, und ich hatte mich einverstanden erklärt, für den WCPP zu fahren, aber bevor ich ins Training für die Saison 1999 einstieg, reiste ich nach Irland, um Aidan zu besuchen. Gleich am Morgen nach meiner Ankunft hatten wir uns das Quad seines Nachbarn Killian (»Killer« für seine Freunde) geborgt, um im Wald die Sau rauszulassen. Es war ein Riesenspaß, aber weil wir ungestüme, mit Testosteron aufgeladene junge Burschen waren, wurden wir natürlich übermütig, und es kam, wie es kommen musste. Aidan saß am Steuer und ich auf dem Soziussitz, als wir mit Vollgas in eine Kurve gingen, die sich als enger herausstellte, als wir dachten. Das Quad richtete sich auf und warf Aidan einfach ab, aber ich blieb irgendwie drauf und geriet darunter, so dass das ganze Gewicht des Fahrzeugs auf mir lastete, als es sich überschlug. Ich hatte schon eine Menge Stürze auf dem Rennrad hinter mir, aber als ich aufstand, war sofort klar, dass es mich übel erwischt hatte. »Huch, ich lebe noch«, dachte ich erschrocken, bevor ich allmählich wieder klar wurde und die Lage checkte. Entsetzt stellte ich fest, dass mein Fuß vollkommen verdreht war und in die falsche Richtung zeigte.
Mein Verstand setzte aus. Aidan begriff, dass er handeln musste, und versuchte, einen Notarzt zu rufen. Aidan war damals einer der wenigen Menschen, die ich kannte, die ein Mobiltelefon besaßen, aber es war 1998 und wir befanden uns mitten in einem Wald in Irland – was den Handyempfang anging, hätten wir genauso gut mitten auf dem verfluchten Atlantik sein können. Unsere einzige Option war, das Quad wieder aufzurichten und zurückzufahren. Der Weg zurück zum Pritschenwagen, den wir für den Transport benutzt hatten, war die Hölle. Jede Wurzel und jede Bodenwelle jagte mir stechende Schmerzen durch den ganzen Körper. Als wir den Wagen erreichten, hatte Aidan endlich wieder Empfang und rief einen Krankenwagen, aber wir hatten keinen blassen Schimmer, wo genau wir waren. Aidan versuchte so gut es ging die Strecke zu beschreiben, die wir gekommen waren, sah jedoch bald ein, dass es keinen Zweck hatte. Ich hörte ihn sprechen, aber mir dämmerte allmählich, dass etwas ernsthaft nicht stimmte. Ich krümmte mich vor Bauchschmerzen und wagte nicht, meinen Fuß anzusehen, der am Ende meines Beins baumelte. Ich spürte, wie mich die Kräfte verließen.
Aidan befand, dass es nicht in Frage käme, auf den Krankenwagen zu warten, doch in all der Aufregung hatten wir auch noch unterwegs den Autoschlüssel verloren. Er schlug die Scheibe ein und schloss seinen eigenen Wagen kurz, bevor er mich auf den Beifahrersitz hievte und losfuhr. Ich verlor immer wieder das Bewusstsein. Um nicht ohnmächtig zu werden, versuchte ich, mich auf den entsetzlichen und nicht enden wollenden Schmerz zu konzentrieren, der mich durchfuhr. Als wir das Krankenhaus erreichten, konnte ich nicht mehr. Ich kritzelte meine Unterschrift unter die Einverständniserklärung, die man mir unter die Nase hielt, und dann bekam ich endlich eine Narkose.
Das ist alles, woran ich mich erinnern kann, ehe ich nachts wach wurde. Während ich weggetreten war, hatten die Ärzte meine Milz entfernt und meinen Knöchel gerichtet. Ich hatte innere Blutungen gehabt, und weil es so lange gedauert hatte, mich ins Krankenhaus zu bringen, hatte ich in echter Lebensgefahr geschwebt. Am Morgen war ich stabil, aber die Schmerzen waren immer noch grauenvoll. Mein Magen wurde von Klammern zusammengehalten, und aufgrund einer allergischen Reaktion gegen das Anästhetikum musste ich die ganze Zeit kotzen. Der Schmerz, den ich beim Aufwachen und beim ständigen trockenen Würgen verspürte, waren die schlimmsten Qualen, die ich jemals erlebt habe. Um die Schmerzen irgendwie zu ertragen, bettelte ich unablässig um Morphium. Ich verfiel in einen benommenen, semikomatösen Zustand und verlor immer wieder das Bewusstsein, während Celine Dion im Krankenhausradio scheinbar in einer Endlosschleife »That’s The Way It Is« sang. Noch heute jagen mir eiskalte Schauer über den Rücken, wenn ich dieses Lied höre.
Mein erster Besucher war Pat McQuaid. Er hatte von Mike Taylor von dem Unfall gehört und war sofort gekommen, um nach mir zu sehen. Pat war damals Organisator der Junior Tour of Ireland, und sein Besuch gab mir wirklich Auftrieb. Ich wurde in ein größeres Krankenhaus in Dublin verlegt, wo ich erneut operiert wurde, diesmal um meinen Knöchel mit zwei Metallstiften zu stabilisieren. Ich hatte ohnehin schon eine Heidenangst angesichts der Schwere des Unfalls gehabt, aber als nach der zweiten Operation der Chefarzt zur Visite kam, wurde es noch schlimmer.
»Tja, alles gut verlaufen. Sie werden Ihren Fuß wieder normal bewegen können … aber Gelbe Trikots werden Sie nicht mehr gewinnen.«
Diese Bemerkung ging mir durch Mark und Bein. Als er das Zimmer verließ, um seine Runde fortzusetzen, war ich gelähmt vor Entsetzen. Ich wiederholte laut seine Worte: »Gelbe Trikots werden Sie nicht mehr gewinnen.« Was hatte diese Bemerkung zu bedeuten? In meiner Panik wurde ich wütend. Hatte er das Gelbe Trikot nur erwähnt, um sich bei mir einzuschmeicheln? Oder wusste er, wovon er sprach und dass ich nicht mehr derselbe sein würde? Ich hätte nichts davon, mich nur »normal bewegen« zu können, schließlich wollte ich Profi werden, und zwar in einer der härtesten Sportarten der Welt. Was, wenn meine Radsportkarriere vorbei wäre, bevor sie richtig begonnen hatte? Ich war so sauer, dass ich den Arzt auf dem Flur zur Rede stellen und ihn fragen wollte, was zum Teufel er gemeint hatte, aber schon beim Gedanken daran, mich zu bewegen, jagten mir Schmerzen in Schockwellen durch den Körper.
Ich war zwei Wochen lang bewegungslos ans Bett gefesselt, bevor ich nach York zurückkehren konnte. Im Krankenhaus hatte ich über die sehr reale Möglichkeit nachgedacht, meine Träume von der Profikarriere begraben zu müssen. Das war mehr als nur ein bloßer Rückschlag, hier ging es ums Eingemachte: Nie wieder Rennen fahren zu können, würde bedeuten, nicht mehr das tun zu können, was ich liebte und was ich brauchte. Alles in meinem Leben war akribisch auf dieses Ziel ausgerichtet, und jetzt, nach einem Moment der Dummheit, war vielleicht alles vorbei. Meine Stimmung schlug von grimmiger Zuversicht in vollkommene Niedergeschlagenheit um. Die Ungewissheit war die schlimmste Strafe von allen. Als ich in Irland im Krankenhaus lag, entwickelte ich eine Abgebrühtheit, die mich durch die nächsten zwölf Monate brachte: eine Unbarmherzigkeit, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte. Aus Frankreich zurückzukehren, hatte ich als eine Art Niederlage empfunden, und nun würde mich dieser Unfall weitere wertvolle Zeit kosten. Wenn ich schon vorher das Gefühl gehabt hatte, dass mir die Zeit davonlief … tja, so blieb mir jetzt noch weniger, und ich war wild entschlossen, sie zu nutzen.
Weniger als einen Monat später humpelte ich auf Krücken zu meinem Rad, um zum ersten Mal wieder in den Sattel zu steigen (sehr zur Verwunderung meiner Nachbarn, die sich fragten, was zum Geier ich da trieb, als ich über die Einfahrt humpelte, um mich auf ein Rennrad zu setzen). Für mich war sonnenklar, dass ich wieder aufs Rad musste, sobald ich die nötige Beweglichkeit hatte. Ich musste Gewissheit haben. Solange ich mich auf mein Rad setzen und trainieren konnte, wäre es mir egal gewesen, das ganze nächste Jahr auf Krücken laufen zu müssen. Meine erste Ausfahrt dauerte etwas weniger als 45 Minuten. Ich war zufrieden, als ich nach Hause kam, denn ich war zum ersten Mal seit drei Wochen wieder gefahren. Gleichzeitig war ich frustriert, dass ich nicht aus dem Sattel gehen konnte. Ich hatte es versucht, in den Wiegetritt zu wechseln, war aber gleich wieder auf den Sattel geplumpst, weil mein Knöchel noch zu schwach war.
Davon abgesehen wusste ich aber, dass ich es schaffen könnte; ich müsste mich nur mehr reinhängen. Meine Entschlossenheit wurde dadurch nur gesteigert. Ich humpelte auf meinen Krücken ins Haus und schleppte mich die Treppe hinauf ins Bad. Ich zog das Radtrikot aus und nahm eine Schermaschine aus dem Regal. Ich wusste, der Moment war gekommen. Von nun an würde es nichts anderes mehr geben. Jede Kleinigkeit – selbst Haare kämmen und stylen – war eine unnötige Verschwendung von Zeit und Energie. Ich schaltete die Maschine ein und spürte die Vibrationen am Kopf, als ich mir den Schädel zu rasieren begann. Mein blondes Haar fiel in Büscheln zu Boden und klebte mir am schweißnassen Rücken und im Nacken. Als ich fertig war, fuhr ich mir mit der Hand über den borstigen weißen Skalp und betrachtete mich im Spiegel. Ich sah mein Gesicht, das ohne die weiche Umrahmung meiner Haare sehr viel härter wirkte. Ich bedachte mein Spiegelbild mit einem brutalen, sadistischen Grinsen. Nun sah ich auch äußerlich so pragmatisch und skrupellos aus, wie ich mich innerlich fühlte.
In den folgenden Monaten tat ich nichts anderes als Rad fahren. Um der kalten Witterung zu entkommen, mietete ich zusammen mit Ken Mathesons Sohn Tim, der ebenfalls Radamateur war, eine Wohnung in Spanien. Wir verkrochen uns in Benidorm in einer saisonbedingt verwaisten Unterkunft und hausten wie die Attentäter: Wir taten nichts als essen, schlafen und trainieren. Die einzigen anderen menschlichen Wesen, die im Januar an der Costa Blanca zu sehen waren, waren Rentner und andere Radfahrer. Es gab keinerlei Ablenkungen, und wir nahmen keine Rücksicht auf Fragen der Normalität. Es gab nur Radfahren. In meinem Kopf herrschte absolute Klarheit. Mir war klar: Wollte ich Profi werden, würde ich alles andere hintanstellen und einige Opfer bringen müssen. Ich blendete alles aus, was mich nicht weiterbrachte oder im Hinblick auf mein Ziel im Weg stehen könnte. Die Nachwirkungen meiner Knöchelverletzung tat ich mit einem Schulterzucken ab. Ich konnte in den Sattel steigen und die Pedale bewegen, alles andere war egal. Ich lebte an meinem Limit.
Mein Ehrgeiz hatte vollkommen Besitz von mir ergriffen. Als Radrennfahrer, und überhaupt als Sportler, hat man die Vorstellung, dass man abends nur dann seinen Seelenfrieden findet, wenn man sich im Training völlig verausgabt hat. Mein zwanghafter Drang, mich zu verbessern, beschränkte sich nicht auf das, was ich auf dem Rad tat. Ich brauchte das Gefühl, tagsüber absolut alles richtig gemacht zu haben, um das Beste aus mir und meinem Rad herauszuholen. Ich musste richtig trainiert, richtig gegessen, mich richtig aufgewärmt und richtig regeneriert haben. Das war eine Frage des Gewissens. Falls ich verlor, aber alles in meiner Macht Stehende getan hatte, konnte ich das akzeptieren. Aber falls ich scheiterte, weil ich eine Kleinigkeit außer Acht gelassen hatte, hätte ich mir das niemals verzeihen können.
Ich beschäftigte mich zwanghaft mit jedem noch so winzigen Aspekt meines Lebens. Es gab nichts, was ich nicht versuchte, um noch etwas mehr aus mir herauszuholen. Das Problem war, dass es damals keine echten Bezugsgrößen in Großbritannien gab und es eher ein osmotischer Prozess war, das Radsportmetier zu erlernen. Ratschläge wurden über eine Art stille Post weitergereicht. Die Leute traten mit den absurdesten Ideen an mich heran, aber sofern sie aus verlässlicher Quelle stammten, probierte ich es aus.
Ich befolgte gewissenhaft die absonderlichsten Ratschläge. Ratschläge, die ich mit ein bisschen gesundem Menschenverstand sofort hätte zurückweisen können. Aber was ich tat, hatte nichts mit Logik zu tun, es war pure Emotion in wissenschaftlichem Gewand. Ich erinnerte mich, gelesen zu haben, dass einige Fahrer während der Rennen Tee in den Trinkflaschen hatten (was auch stimmte), aber weil meine Mutter ihren Tee stets mit Milch getrunken hatte, füllte ich milchigen Tee in meine Flaschen und bescherte mir damit schlimme Bauchschmerzen. Weil ich Profis bei 30 Grad mit Mützen und Beinlingen hatte fahren sehen, radelte ich in einer Thermojacke durch Yorkshire, ohne auch nur den Hauch einer Idee zu haben, was der Schwachsinn sollte (vermutlich wussten es die Kollegen selbst nicht). Ich trank nie kalte Cola, weil man davon angeblich Durchfall bekam, und ich aß auch nicht die Mitte des Brotes, weil es hieß, davon würde sich der Magen aufblähen. Diese kleinen Aufgaben und Prüfungen, oder wie auch immer man es nennen möchte, wurden zu den Fixpunkten meines Lebens. Ich musste sie unbedingt bewältigen und ich durfte nichts und niemandem gestatten, mir dazwischenzufunken.
Ich tat alles, was in meiner Macht stand, und tatsächlich machte es sich bezahlt: Als die Rennsaison begann, war bald klar, dass ich meiner Konkurrenz weit überlegen war. Der größte Unterschied, der sich gleich bemerkbar machte, als ich für den WCPP an den Start ging, war das Wettkampfniveau. Gemessen an dem, was ich aus den vorigen Jahren gewohnt war, kamen mir die U23-Weltcuprennen ziemlich einfach vor. Jetzt zahlten sich all die Kilometer aus, die ich in Frankreich in aussichtsloser Position hinterhergehechelt war, denn verglichen mit der Trophée des Grimpeurs war der Espoir Triptyque des Monts et Châteaux geradezu ein Spaziergang. Nachdem ich zuvor reichlich Prügel eingesteckt hatte, war ich es jetzt, der austeilte. Von meinen WCPP-Kollegen erhielt ich wenig bis gar keine Unterstützung – sie waren entweder überfordert oder Spezialisten für die Bahn, die ein paar Straßenrennen als Training einstreuten –, aber meine Entschlossenheit, mich durchzusetzen, erhielt einigen Auftrieb durch die anfänglichen Erfolge, so dass sich die entsprechenden Ergebnisse fast zwangsläufig einstellten. Ich gewann zwei Etappen bei der Thüringen-Rundfahrt, einem U23-Weltcuprennen in Deutschland. Bei Lüttich–Bastogne–Lüttich wurde ich Dritter in meiner Altersklasse. Ich wurde britischer U23-Meister im Straßenrennen und Zweiter bei der Europameisterschaft im Einzelzeitfahren.
Mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, solche Rennen zu bestreiten und erfolgreich zu gestalten, und doch gestattete ich mir kaum zu feiern, als ich sie schließlich gewann. Siege waren, wie ich fand, nichts, worüber man sich groß freuen müsste. Sie waren nur die logische Folge meiner harten Arbeit. Siege bedeuteten eine gewisse Befriedigung, mehr aber auch nicht. Für andere Emotionen ließen meine Zielstrebigkeit und Entschlossenheit keinen Raum. Ich bewahrte keine Zeitungsausschnitte und auch keine Startnummern auf. Für Sentimentalität hatte ich keine Zeit. Ein gewonnenes Rennen war nur eins mehr von einer schier unendlichen Anzahl an Häkchen, die ich machen musste, um zufrieden zu sein.
Den ganzen Sommer über hielt meine Erfolgsserie an, aber in meinem nervösen Kopf spukte schon bald die Frage herum, wann der große Moment, auf den ich so hart hinarbeitete, denn nun endlich käme. Mittlerweile hatte ich eine ganze Latte an guten Ergebnissen vorzuweisen, aber bislang waren die Manager der großen Profirennställe noch nicht an mich herangetreten, um sich zu erkundigen, was ich im nächsten Jahr denn so vorhabe, oder auch nur das geringste Interesse an mir zu bekunden. Ich hatte so viel investiert, dass der Gedanke, keinen Vertrag zu bekommen, mich richtiggehend krank machte. Am ehesten schnupperte ich an der Chance auf meinen großen Durchbruch, als ich nach der Tour of Britain (die damals PruTour hieß) in einem Pub in Edinburgh saß und jemand mich Brian Holm vorstellte. Holm war damals sportlicher Leiter der dänischen AcceptCard-Mannschaft aus der zweiten Division. »Du willst also Profi werden?«, fragte mich Brian. »Yeah«, antwortete ich schüchtern. Und das war’s. Nach einer kurzen Pause zog er weiter, um sich mit jemand anderem zu unterhalten. Es war der letzte Abend der Rundfahrt und schon spät, so dass ich mir einredete, dass Brian bestimmt gegangen sei, weil ich mich dadurch, noch in der Kneipe abzuhängen, unprofessionell verhalten habe. Ich biss mir wochenlang in den Hintern dafür, so dumm gewesen zu sein. Ich war so jung und borniert, dass ich nicht begriff, dass Brian einfach nur einen entspannten Abend haben wollte und sich mit einem übermotivierten jungen Amateur über den Profiradsport zu unterhalten so ziemlich das Letzte war, wonach ihm der Sinn stand.
Im September, einen Monat vor dem Ende der Saison, machte ich endlich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Ich erhielt das Angebot, für das Team Linda McCartney als stagiaire beim Etappenrennen Trans Canada an den Start zu gehen. Das McCartney-Team war eine britische Profimannschaft aus der dritten Division. Sie hatten mir sehr überzeugend ihre Zukunftspläne dargelegt, trotzdem war es nicht die Art von Rennen, die ich eigentlich anstrebte oder die zu bestreiten ich aufgrund meiner Ergebnisse zu verdienen glaubte.
Aber Trans Canada stellte sich als harte Prüfung für mich heraus. Nicht nur, weil das Wetter so mies war – es goss die ganze Woche wie aus Kübeln –, sondern auch, weil sämtliche Etappen auf endlos langen, flachen kanadischen Straßen stattfanden und fast zwangsläufig mit einem Massensprint endeten, was mir überhaupt nicht lag. Was die Sache nicht einfacher machte, war der Umstand, dass mein Körper mit dem Jetlag nicht zurechtkam. Ich achtete sehr genau auf meinen Körper, aber ich war lange Wettkampfreisen nicht gewohnt und den Flug auf die andere Seite des Atlantiks steckte ich nicht einfach so weg. Alles schien durcheinanderzugeraten und ich wachte zu allen möglichen Zeiten im Hotelzimmer auf, lag lange wach und dämmerte endlich weg, wenn es fast schon wieder Zeit zum Aufstehen war. Das war ein Gefühl, an das ich mich in den nächsten Jahren gewöhnen sollte, aber damals war es noch so, als hätte man mich an den Knöcheln gepackt und auf den Kopf gestellt.
Zu allem Überfluss musste ich für die Dauer des Rennens auch noch zum Vegetarier ehrenhalber werden. Unser Teamsponsor verdiente sein Geld mit dem Vertrieb vegetarischer Fertigprodukte und wollte zeigen, dass man als Profi auch fleischfrei Leistung bringen konnte. Auf dem Papier war es bestimmt eine prima Idee, mit einem Radsportteam für vegetarische Ernährung zu werben (außer vielleicht auf dem europäischen Festland, wo man mit dieser Idee vor allem auf fassungslose Köche und mitleidiges Servicepersonal stieß), aber es war vollkommen bescheuert von mir, zu erwarten, meine Ernährung von jetzt auf gleich so drastisch umstellen und dennoch auf gleichem Niveau Leistung bringen zu können. Das war einfach mehr, als mein Körper verkraften konnte. Das Engagement für das Team Linda McCartney war mir anfangs wie ein Licht am Ende des Tunnels erschienen, doch gegen Ende des Rennens war davon nicht mehr als ein schwaches, hoffnungsvolles Flackern geblieben.
Aber dann, als ich vor dem abschließenden Zeitfahren in Richtung Start rollte, änderte sich meine Welt für immer. Die hoch aufgeschossene, wohlmeinende Gestalt von Serge Parsani stellte sich mir in den Weg und bat um meine Telefonnummer. Parsani war als Leiter der Mapei-Mannschaft beim Rennen, er war also genau wie ich seit zehn Tagen da, aber bis dahin hatte er kein einziges Wort mit mir geredet. Ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, warum jetzt plötzlich ein wichtiger Vertreter des erfolgreichsten Rennstalls der Welt an mich herantrat. Ich war ganz aus dem Häuschen. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht einmal hätte sagen können, ob ich Freude oder Erleichterung oder eine Mischung aus beidem verspürte. Ich wollte lachen und weinen und jemanden küssen und einen Fernseher aus meinem Hotelzimmer werfen! Mein Kopf schwebte irgendwo über den Wolken. Von dem Moment an, als das Gespräch mit Parsani endete, bis zu dem Tag drei Wochen später, als ich den Vertrag bei Mapei unterschrieb, hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht mehr den Boden zu berühren.
Nach meiner Rückkehr nach Hause hatte Mapei mich kontaktiert und zu Tests in die Teamzentrale bestellt. Bevor wir uns auf den Weg nach Italien machten, holte Ken einen dicken Ordner mit meinen Blutuntersuchungen hervor: »Nur für den Fall, dass sie es sehen wollen.« Ich war zunächst überrascht. Weil ich bis dahin nie mit EPO in Berührung gekommen war, lebte ich in einer ganz anderen Welt als die meisten italienischen Amateure, mit denen Mapei es sonst zu tun bekam. Mir war bis dahin nicht mal in den Sinn gekommen, dass ein Profiteam sich vielleicht erst mal meine Blutwerte ansehen wollte, bevor es mich unter Vertrag nahm, um nicht die Katze im Sack zu kaufen.
Mit meinen Blutwerten hatte ich mich erstmals beschäftigt, als ich noch bei den Junioren an den Start ging. Ken, der sich intensiv mit Sportwissenschaft beschäftigte, hatte mein Blut regelmäßig untersucht, um sicherzustellen, dass mich das Training, das er mich absolvieren ließ, nicht vollkommen ruinierte. Ich hatte schon damals extrem hohe Hämatokritwerte, lange bevor die UCI, der internationale Radsportverband, die 50-Prozent-Regel und das System der »Gesundheitskontrollen« einführte, mit denen Fahrer vorübergehend aus dem Rennen genommen werden konnten. Als ich meine ersten Tests absolvierte, kam dabei am Ende nicht mehr als ein Haufen Zahlen heraus, die mir absolut nichts sagten. Ich wollte nur wissen, ob mein Blut in Ordnung war oder nicht. Soweit es mich betraf, war ich zufrieden, solange »hohe« Werte bedeuteten, dass ich gesund war.
Nachdem ich die Tests hinter mich gebracht hatte und wir in der Mapei-Zentrale auf die Resultate warteten, wurde mir schlagartig die Tragweite des Ganzen bewusst und ich geriet ein wenig in Panik. Ich redete mir ein, sie würden die hohen Hämatokritwerte sehen und lieber die Finger von mir lassen, weil ich ein Risiko darstellte. Ich machte mir Vorwürfe, einem so wichtigen Aspekt nicht mehr Bedeutung beigemessen zu haben. Aber da ich keinerlei Berührung mit Doping gehabt hatte, hatte es für mich auch keinen Grund gegeben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als die Resultate vorlagen, ging mein Hämatokrit wie gewohnt durchs Dach, aber Ken, der offenbar gut vorbereitet war, erläuterte die Messwerte und versicherte Aldo Sassi, dass ich zu 100 Prozent sauber war. Zu unserer beider Überraschung war Sassi keineswegs beunruhigt: Er hatte den hohen Hämatokritwert zur Kenntnis genommen, aber ebenso gründlich die anderen Testergebnisse studiert und sagte: »Nein, das ist schon in Ordnung. Wir können das einschätzen.«
Wie sich herausstellte, war der Hämatokrit-Test die simpelste Form der Blutanalyse, aber bei Mapei war man schlau genug, sich nicht nur auf diese günstigste und einfachste Methode zu verlassen. Sie schauten sich auch andere Werte an, die wesentlich zuverlässigere Hinweise darauf lieferten, ob jemand EPO nahm oder nicht. Die Ärzte untersuchten die Retikulozytwerte, die angaben, wie viele junge rote Blutkörperchen im Körper produziert wurden. Fielen sie extrem hoch aus, war das ein sicheres Anzeichen dafür, dass manipuliert wurde. Solche Verfahren standen auch der UCI zur Verfügung, aber aus irgendeinem Grund gaben sie sich mit der einfachsten Testmethode zufrieden und legten einen beinahe willkürlichen Grenzwert fest, mit dem sie redliche Sportler um ihren Lebensunterhalt bringen konnten.
Ich war unglaublich erleichtert. Damals interessierte mich nur, ob Mapei mich weiterhin verpflichten wollte, aber es war klar, dass ich der Sache in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken müsste. Im Laufe meiner Karriere war mein Hämatokrit aber ohnehin ein Thema, bei dem ich gar nicht erst in Versuchung kam, es irgendwie vergessen zu können …
Nachdem ich die Tests hinter mich gebracht hatte, konnten wir die Vertragsunterzeichnung im Anschluss an die U23-WM in Verona im Teamhotel der britischen Mannschaft endlich unter Dach und Fach bringen. Als ich mit der Aussicht auf einen Profivertrag zu den Titelkämpfen anreiste, war ich der ganze Stolz des WCPP. Vor dem WM-Rennen auf der Straße, meinem wichtigsten Wettkampf des Jahres, stand ich, wie schon 1996 beim GP des Nations der Junioren, im Mittelpunkt des Interesses. Aber diesmal kümmerte sich nicht nur Jacques Duchain um mich und es stand nicht nur Bernaudeaus Ruf auf dem Spiel; nun schaute eine ganze Rad-Nationalmannschaft auf mich.
Der Druck war größer geworden – ich konnte spüren, wie er sich in mir aufbaute. 1996 hatte sich, wenige Tage vor dem GP des Nations, ein riesiger Fleck auf meiner Nasenspitze gebildet. Vielleicht war es der Stress, vielleicht aber auch nur Zufall, aber als jetzt direkt vor den Weltmeisterschaften ein kolossaler Pickel an genau der gleichen Stelle auftauchte, hielt ich das für ein gutes Omen. In meinem komischen Aberglauben wertete ich es als ein Zeichen meiner guten Form und dass ich etwas Besonderes vollbringen würde, weswegen ich mich auch weigerte, den Pickel auszudrücken, obwohl er auf meiner Nasenspitze nicht zu übersehen war. Ich ließ ihn einfach munter vor sich hineitern. Wie sich herausstellte, war der Pickel nichts weiter als ein Pickel und keineswegs ein Indiz meiner guten Form. Gleichwohl erlebte er – trotz meines schwachen Abschneidens im Rennen – seinen Moment des Ruhms, als er in seiner ganzen Pracht auf dem Cover der Cycling Weekly zu sehen war, nachdem die Neuigkeiten von meinem Profivertrag die Runde machten.
Das U23-Rennen hatte am Freitag stattgefunden. Am Samstag unterschrieb ich den Vertrag, anschließend wurde ich von Mapei eingeladen, mir die Entscheidung der Elite am letzten Tag der WM von ihrem gigantischen Teambus aus anzuschauen. Nach einem Tag im imposanten Bus, wo ich farbige Fliesen mit Mapei-Logo bestaunte und jeden Moment damit rechnete, von der Security rausgeschmissen zu werden, ging es zu den Fahrerunterkünften, die im nächsten Jahr auch mein Zuhause sein würden.
Der Tag im Mapei-Bus war schon ziemlich abgefahren, aber die teameigenen Apartments setzten dem Ganzen die Krone auf.
Als wir am Ufer des Lago di Comabbio entlang in Richtung der Anlage fuhren, hatte Patrick Lefevere, einer der sportlichen Leiter des Teams, der mich und die beiden Amerikaner Chann McRae und Fred Rodriguez mitnahm, in bescheidenem, beinahe verlegenem Tonfall von den Unterkünften gesprochen. Aber als er den Wagen durch das elektrische Eingangstor steuerte, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen.
Die »Zimmer« stellten sich als 110 Quadratmeter große Luxusapartments heraus, die sich direkt am Ufer des Sees befanden. Während Patrick verschwand, um beim Verwalter die Schlüssel für meine Wohnung abzuholen, sah ich mich um und entdeckte zu meiner Begeisterung, dass zur Anlage ein Swimmingpool sowie ein riesiger Garten mit herrlichem Blick auf den Monte Rosa gehörten. Es war beeindruckend, aber das Beste kam noch.
Patrick kam zurück, die Schlüssel in der Hand, und schaute sich nach dem Apartment um, das mir zugewiesen wurde. Sein Blick blieb schließlich an einer Wohnungstür haften, die die gleiche Nummer trug wie der Schlüsselbund.
»Ah, hier lang.«
Er führte mich über den Hof zu einem der Apartments, die dem See am nächsten waren, öffnete die Tür und bat mich herein. Dass die Räume nicht funkelten, war aber auch alles: Die Wohnung sah aus, als wäre sie soeben für eine Putzmittelwerbung verwendet worden. Die komplette Einrichtung war brandneu, es fehlte an nichts. Ich ging in die noch unberührte Küche und öffnete aus reiner Neugier eine der Schubladen. Sie war bis oben hin voll mit jeglichem Besteck, das ich brauchen würde, und dazu mit ein paar Geräten, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Es war ein bezugsfertiges Luxusapartment und es war für mich. Ich war platt.
Während ich staunend durch die Räume ging, stand Patrick in der Tür und glaubte offenbar immer noch, sich für die Wohnung entschuldigen zu müssen. »Es kann sein, dass du dir das Apartment zu Anfang mit einem anderen Fahrer teilen musst, bis sich alles eingespielt hat. Wäre das in Ordnung?«
Ich hätte beinahe gelacht. Zwei Jahre zuvor hatte ich in einer Hütte gehaust, die scheinbar nur noch vom Dreck zusammengehalten wurde, und auf einem Bett geschlafen, das auf Ziegelsteinen aufgebaut war. Patrick hätte mir mitteilen können, dass ich mir das Apartment mit fünf Fahrern teilen müsste, und ich wäre immer noch überzeugt gewesen, das große Los gezogen zu haben.
Ich übernachtete dort, bevor ich mich am nächsten Tag auf die Heimreise machte. Als ich zu Bett ging, drehte sich mir der Kopf. In den vergangenen drei Wochen waren meine Sinne mit so vielen neuen Eindrücken überladen worden, dass mir beinahe schwindlig wurde. Ich war zum ersten Mal in Italien, und es war alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte und sogar noch besser. Ich lag da und dachte bei mir, dass dies nun bald mein Zuhause wäre. Ich war nicht nur zu Besuch da, ich würde dort tatsächlich leben. Es war unglaublich – fast wie ein Traum, der plötzlich Realität geworden war. Es dauerte eine Weile, bis ich endlich einschlief. Als ich mitten in der Nacht aufwachte und pinkeln musste, machte ich im Bad das Licht an und sah mich um, überglücklich, dass noch alles da war.
Am nächsten Morgen wurde es noch besser. Ich suchte für ein paar Blutuntersuchungen das Büro auf, wo mir die Sekretärin mitteilte, dass für meinen Rückflug nach England nur noch ein Platz in der Business Class verfügbar sei. Ich hoffte, dass ich meinen freudigen Jauchzer tatsächlich nur innerlich ausgestoßen hatte, aber ich war inzwischen sowieso nicht mehr in der Lage, zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Mit meiner Billighose von Gap und einem T-Shirt der britischen Radnationalmannschaft bekleidet saß ich Champagner schlürfend in der Lounge des Flughafens Malpensa und versuchte, das alles irgendwie zu verarbeiten.
Nach meiner Landung in Manchester wurde ich von Mike Taylor am Flughafen abgeholt. In meiner Zeit in Frankreich und auch während meiner Saison beim WCPP hatte ich regelmäßig mit Mike telefoniert und weiter großen Wert auf seinen Rat gelegt. Wann immer ich in der Heimat war, war mir daran gelegen, ihm und seiner Frau Pat einen Besuch abzustatten. Die beiden waren wie eine Familie für mich geworden. Sie waren meine erste Anlaufstation, wenn ich Probleme hatte, und sie waren auch die Ersten, die von meinen Erfolgen zu hören bekamen. Zur Feier meines Profivertrags hatten sie in ihrem Haus in Chapel-en-le-Frith mir zu Ehren eine Party auf die Beine gestellt. Sie brachten 80 Gäste in ihrem Haus unter und kümmerten sich darum, dass jeder Einzelne von ihnen sich wohl fühlte und sich gut amüsierte. Es kam wahrlich selten genug vor, dass es ein britischer Fahrer zu den Profis schaffte, und es war, als hätten sich sämtliche Leute eingefunden, die ich vom Sport her kannte, wie eine große Familie, die durch den Radsport, und natürlich durch Mike und Pat, verbunden war. Auch Ken war natürlich da. Ebenso David Millar, der Mike bei der gleichen Tour of Ireland kennengelernt hatte wie ich, aber schon seit zwei Jahren als Profi fuhr und aus Frankreich gekommen war. Dazu Graham Jones, ebenfalls einer von Mikes »Jungs«, sowie eine Reihe von Fahrern aus der Gegend, mit denen ich im Laufe der Jahre gefahren war. Es war ein unglaubliches Gefühl, wie der Übergang von einer Welt in eine andere. Mike und Pat waren unheimlich großzügige Menschen, die den Radsport liebten und nie um eine Gegenleistung baten. Als Profi zu ihnen zurückzukehren und die aufrichtige Herzlichkeit bei dieser Feier zu verspüren, war ein ganz besonderes Gefühl.
Mir blieben noch ein paar Monate, um mich auf meine erste Saison als Profi vorzubereiten. Nach einer kurzen Pause war es bald an der Zeit, die Rückkehr aufs Rad ins Auge zu fassen. Im Dezember war ich so weit, das Training für meine Laufbahn als Profi aufzunehmen, aber so ganz fühlte ich mich noch nicht wie einer. Vor meiner Abreise aus Italien hatte ich von Mapei eine Tasche voller Kleidung bekommen, in der ich im Winter trainieren sollte. Nüchtern betrachtet war es schon irgendwie komisch: Mapei war ein Baustoffproduzent, der Kleber für Wand- und Bodenbeläge herstellte, was so ziemlich das Langweiligste war, was man sich vorstellen konnte. Aber um die Radsportkultur war es so bestellt, dass es bei jemandem wie mir, der ein Fan war und jede Woche die Cycling Weekly verschlang, eine fast groteske Begeisterung auslöste, die mit dem Firmenlogo zugepflasterten Klamotten in Händen zu halten. Ich betrachtete mir die Sachen in ihren Verpackungen, packte sie aus und probierte sie an, aber trotzdem dauerte es bis zum ersten Tag des neuen Jahres, dass ich mich der Kleidung als würdig empfand und erstmals im Mapei-Outfit trainierte. Solange ich nicht ganz offiziell ab dem 1. Januar 2000 auf der Gehaltsliste des Profirennstalls Mapei stand, fühlte ich mich noch ganz wie der Amateur, der ich bis dahin gewesen war. Es beschämte mich, diese Profiklamotten zu tragen. Es erschien mir falsch, sie vorher überzustreifen – so als wäre ich ein Hochstapler. Also trainierte ich den Winter über ganz in Schwarz. Anfang Januar aber erhielt ich ein Päckchen. Es waren meine neuen Visitenkarten von Mapei. Darauf stand: Charly Wegelius – Ciclista Professionista.