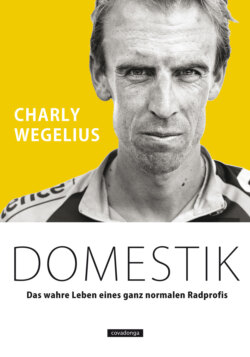Читать книгу Domestik - Wegelius Charly - Страница 8
ОглавлениеPROLOG
Ich lebe in ständiger Angst, und wahrscheinlich ist es das, was mich meistens dazu antreibt, mich ganz ordentlich aus der Affäre zu ziehen. Aber eigentlich mache ich mir die ganze Zeit in die Hose.
Als der Moment kam, in dem ich wusste, wirklich wusste, dass ich Radprofi werden würde, saß ich gerade auf der Rolle und machte mich für das WM-Rennen der U23 im Einzelzeitfahren warm, das im Oktober 1999 im Rahmen der Radweltmeisterschaften in Verona stattfand.
Bei solchen Titelkämpfen herrscht immer reger Betrieb, denn in dieser Altersklasse wimmelt es von jungen Fahrern, die unbedingt Profi werden wollen. Die WM bedeutet für viele dieser Burschen den Höhepunkt ihres bisherigen Lebens, und weil sie noch so jung sind, stehen sie emotional ziemlich unter Strom. Die Anspannung rund um das Rennen ist immens.
Um die begehrten Plätze im Profizirkus wird ein erbitterter Konkurrenzkampf geführt, und ein Einzelzeitfahren ist ein ganz anderes Paar Schuhe als ein Straßenrennen, bei dem man sich vor dem Start im Kreise der Kollegen verstecken kann. Vor dem Zeitfahren wärmen sich sämtliche Teilnehmer einzeln auf der Rolle auf, nur wenige Meter entfernt von Kerlen, gegen die man das ganze Jahr angetreten ist; Kerle, gegen die man, ohne sie zu kennen, bewusst oder unbewusst eine starke Abneigung entwickelt hat. Jeder ist eifersüchtig auf den anderen.
Mir persönlich war dieser ganze Rummel immer zuwider: die Presse, die Manager, die anderen Fahrer und der ganze Unfug, der mit hohen Erwartungen einherging. Aber an diesem Tag, als ich mich umringt von Betreuern und Beobachtern warmfuhr, sah ich zwei Männer durch das Gedränge auf mich zukommen, auf deren blauen Trainingsjacken das vielfarbige Logo von Mapei zu erkennen war, einem Unternehmen, das Radsportfans als Sponsor des gleichnamigen Rennstalls bekannt war, dem damals größten und namhaftesten Profiteam im Geschäft.
Alvaro Crespi und Serge Parsani, zwei der sportlichen Leiter der Mannschaft, waren gekommen, um mir hallo zu sagen. Angesichts der neidvollen und neugierigen Blicke der anderen Fahrer war ich stolz wie Oskar, dass sie extra meinetwegen aufgetaucht waren. Der dürre kleine Charly kriegt Besuch von zwei Mackern von Mapei, um zu plaudern. Ich freute mich wie ein Schneekönig.
Es ist gar nicht so einfach, während der Aufwärmroutine vor einem Zeitfahren vernünftig zu denken und zu reden, denn das Blut schießt einem in die Beine und all die Rollentrainer summen, dazu kommt das hektische Treiben der Betreuer und der dröhnende Rennkommentar aus den Lautsprechern, die rund um die Strecke verteilt sind. Aber als die beiden auf mich zukamen, rasten meine Gedanken vor Aufregung. Ich kannte Crespi und Parsani bereits von einem früheren Treffen, und in dem Moment fiel mir wieder das erste Mal ein, als sie an mich herangetreten waren – die Repräsentanten einer Mannschaft, für die zu fahren ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft hätte.
Diese erste Begegnung mit Mapei hatte sich vor dem Start eines anderen Zeitfahrens zugetragen. Es war beim Etappenrennen Trans Canada, einem winzigen Profirennen, das ein einziges Mal ausgetragen wurde und die Kanadier dazu animieren sollte, eine geeintere Nation zu werden. Als ich damals auf dem Weg zum Start war, sprach mich Parsani an: »Bist du …?«
Er sah sich meine Startnummer an und dann mich, und ich dachte, er wolle vielleicht wissen, ob ich vor seinem Schützling an der Reihe wäre. Er brach sich einen ab bei dem Versuch, Englisch zu sprechen, was er nicht konnte, also machte ich es ihm leichter und verriet ihm, dass ich Französisch sprach, woraufhin wir uns beide entspannten. Er fragte noch einmal, diesmal auf Französisch: »Bist du Charly Wegelius?« Ich bestätigte, dass ich in der Tat Wegelius sei, woraufhin er sich erkundigte: »Gut. Wir haben uns nämlich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, für unser Team zu fahren …«
Ich war vollkommen sprachlos. Ich dachte, dass er entweder den Falschen erwischt haben müsste oder vielleicht ein Amateurteam vertrat, mit dem er ebenfalls zu tun hatte. Das war aber nicht der Fall: Er war für Mapei da und er meinte mich.
Er bat um meine Telefonnummer, und dann machte ich mich auf den Weg und absolvierte das Zeitfahren wie in Trance. Ich hätte mich fast verfahren, weil ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Es hatte mich total umgehauen.
Das Problem war, dass mir die Festnetznummer meiner Wohnung nicht mehr eingefallen war, als Parsani mich darum gebeten hatte. Auch an meine Handynummer konnte ich mich nicht erinnern. Die einzige Nummer, die mir in dem Moment einfiel, war diejenige, die ich mir als Kind, mit zehn Pence für die Telefonzelle in der Tasche, für den Fall eingeprägt hatte, dass während einer meiner Radtouren etwas passieren sollte: Ich hatte Parsani die Nummer meiner Mutter in York gegeben.
Während ich so benommen über den Zeitfahrkurs eierte, dass ich fast gestürzt wäre, wurde mir klar, dass ich nach dem Rennen nach Hause fahren und so lange dort ausharren müsste, bis jemand von Mapei anrufen würde.
Das Angebot war so überraschend gekommen, dass ich plötzlich Panik hatte, der Manager könnte anrufen und mich nicht erreichen, weil ich mal eben mit dem Hund raus oder in den Laden gegangen war, um eine Tüte Weingummis zu kaufen. Ich fürchtete, dass ihr Interesse ebenso schnell wieder erlahmen könnte, wie es aufgekommen war.
Nachdem ich ein paar bange Tage lang neben dem Telefon gewartet hatte, kam endlich der Anruf. Alvaro Crespi rief an und lud mich zu einer Reihe von Tests nach Italien ein. Allein schon seinen fetten italienischen Akzent zu hören, versetzte mich in helle Aufregung. Ich war damals schon viel herumgekommen, aber in Italien war ich noch nie gewesen. Der Nordwesten von Frankreich, wo ich als Amateur gelebt hatte, war das eine. Jeder ging damals nach Frankreich. Es war fremd, aber nicht exotisch. Italien war etwas ganz anderes. Es war weiter weg, es war mediterran und verheißungsvoll und außerdem ein Ort, über den ich so gut wie nichts wusste.
Ich nahm Crespis Anruf am Erkerfenster entgegen, das von unseren Hunden vollgesabbert war, die dort den ganzen Tag hockten und Passanten ankläfften. Über unser blaues Plastiktelefon seinen fremdländischen Akzent zu hören, kam mir vor, als würde ich eine Botschaft aus einem fremden Universum empfangen. Es war völlig surreal. Eben noch hatte kein Hahn nach mir gekräht und sich nicht einmal kleine Teams für mich interessiert, jetzt plötzlich warb der größte Profirennstall des Planeten um meine Dienste. Fast hätte ich geschrien: »Sie haben den Falschen erwischt!«
Ich hätte ihn gerne gefragt: »Haben Sie sich das auch gut überlegt?«
Für Belgier und Franzosen war der Weg ins Profigeschäft wesentlich geradliniger: Der eigene Trainer schleppte sie zu irgendwelchen Rennen und machte sie mit den richtigen Leuten bekannt; irgendwann fingen sie an, gemeinsam mit Profis zu trainieren, und sie wussten praktisch von Anfang an genau, was sie zu tun hatten und wohin die Reise ging. In England aber war man als junger Radrennfahrer zu dieser Zeit vollkommen auf sich allein gestellt. Es gab keinen wirklichen Austausch mit den Leuten, die man bei den Rennen traf, und meine Kollegen, mit denen ich damals in der Nationalmannschaft fuhr, waren sogar noch grüner hinter den Ohren als ich.
Nach dem Anruf von Crespi reiste ich im Vorfeld der WM zu Tests nach Italien und wohnte mit meinem Trainer Ken Matheson (dem damaligen Cheftrainer des britischen Verbandes) am Ufer des Comer Sees. Dort eröffnete sich mir eine wahre Welt der Wunder; ich erlebte unzählige »Kneif mich«-Momente. Als ich zum ersten Mal das italienische Fernsehen einschaltete und auf Dutzende herrlich komischer Trash-Sender stieß, war ich außer mir vor Begeisterung. Es war auf die theatralische Weise exotisch, wie sie für Italien typisch ist, angefangen vom warmen Herbstlicht bis hin zum Spinner auf dem Shopping-Kanal, dem angesichts der sagenhaften Schnäppchen, die er ekstatisch anpries, beinahe die Luft wegblieb.
Ich fand mich im Trainingszentrum von Mapei ein und staunte über die reibungslosen, professionellen Abläufe. Ich saß in einem echten italienischen Stau fest (ein Erlebnis für sich, wenn man ein solches Hupkonzert nie zuvor gehört hatte), während der legendäre Trainer Max Testa uns beiläufig Geschichten aus der Zeit erzählte, als das Motorola-Team während der Saison in Europa seinen Sitz am Comer See hatte. Es war, als hätte sich vor mir eine Tür geöffnet, durch die ich nur hindurchgehen musste. Ich konnte nicht fassen, dass sie sich für mich geöffnet hatte.
Nachdem ich eine Reihe von Tests mit dem Team absolviert hatte, war ich guten Mutes, als ich Crespi und Parsani in Verona wiedertraf, aber weil noch nichts in trockenen Tüchern war, hatte ich nicht die Gewissheit, dass sich mein Traum wirklich erfüllen würde. Als ich mich an jenem Tag in Verona warmfuhr, sahen mir Crespi und Parsani eine Weile zu, wie mir immer heißer und mein Gesicht immer röter wurde und mir der Schweiß ausbrach, während die Minuten bis zu meiner Startzeit heruntertickten. Schließlich hielten sie den richtigen Moment für gekommen. Ich bekam die Worte zu hören, die ich hören wollte: »Alles klar für nächstes Jahr. Wir holen dich in die Mannschaft. Morgen kommen wir mit dem Papierkram ins Hotel.«
Endlich hatte ich die Gewissheit. Ich würde tatsächlich bei einem Profiteam unterschreiben, noch dazu beim besten der Welt: Ich würde eine Karriere als Radprofi machen.
Ich wäre beinahe von der Rolle gefallen.
Ich war quasi das ganze Jahr hindurch einer der erfolgreichsten Amateurrennfahrer gewesen, aber weil ich keine Angebote erhielt, kam es mir dennoch fast so vor, als wäre ich gescheitert. Plötzlich jedoch versicherte mir die beste Mannschaft der Welt, mir einen Platz im Team geben zu wollen. Von außen betrachtet ergab es durchaus Sinn, für mich aber kam es wie ein Schock. Weil alles so schnell und auf so surreale Weise vonstattenging, hatte ich das Gefühl, auf einen raffinierten Scherz hereingefallen zu sein.
Das war ein Gefühl, das ich nie ganz abschütteln konnte, obwohl ich unheimlich stolz war, als ich bei einem so renommierten Rennstall meinen ersten Profivertrag unterschrieb. Doch die Freude darüber, es geschafft zu haben, währte nur kurz. Als mir der Ernst der Lage bewusst wurde, fing ich nicht an zu tanzen und zu feiern, sondern machte mir stattdessen in die Hose – schon jetzt wollte ich meine zukünftige Mannschaft auf keinen Fall enttäuschen, indem ich ein schlechtes Zeitfahren hinlegte.
Ich kehrte mit dem Vertrag in der Hand von den Titelkämpfen zurück, und der Ex-Profi und Sportreporter Paul Sherwen rief an, um zu gratulieren. Paul hatte mir zu Beginn meiner Karriere zur Seite gestanden und versicherte mir natürlich, wie toll es sei, einen Vertrag unterschrieben zu haben. Aber er erklärte mir auch, dass es erst der erste Schritt wäre. Bisher sei ich als Radrennfahrer praktisch noch zur »Schule« gegangen, nun hätte ich den Sprung an die »Universität« geschafft – mehr aber auch nicht. Sherwen ermahnte mich, niemals zu vergessen, welch hartes Brot der Radsport sei. Bislang sei alles wie geschmiert gelaufen, aber als richtiger Profi dürfe ich mich erst dann fühlen, wenn ich einen Anschlussvertrag bekäme. »Rein kommen viele«, sagte er, »aber durchsetzen können sich nur wenige.«
Die Angst, niemals einen Vertrag zu bekommen, wich der Angst, keinen zweiten zu erhalten. Pauls Mahnung gab den Ton für meine ganze Karriere vor. Ich fing sofort an, alles dafür zu tun, mich nützlich zu machen, mich unersetzlich zu machen, nicht in Vergessenheit zu geraten, wenn die Zeit für eine Vertragsverlängerung käme.
Den Großteil meiner Karriere schien ich von dem Gedanken getrieben zu sein, irgendwie durchhalten zu müssen – bis zur nächsten Runde, zur nächsten Etappe, zur nächsten Saison. Es war eine kontinuierliche negative Motivation. Außenstehende nehmen Radprofis vielleicht wie in die Haarspitzen motivierte Wesen wahr, die nichts dem Zufall überlassen – dieser ganze Quatsch von wegen »ultimative menschliche Höchstleistungen«. Dabei sind es in Wirklichkeit echt beschissene Dinge, die einen antreiben, zum Beispiel der Gedanke, wie peinlich es wäre, vorzeitig auszusteigen, weil man weiß, wie es sich am Montag anfühlen wird, keinen guten Job gemacht zu haben. Vieles von dem, was mich anspornte, diente vor allem dazu, mir ein ruhiges Gewissen zu verschaffen.
Sherwen wusste, dass ich mir keine Vorstellung davon machte, worauf ich mich einließ, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieb. In den folgenden Jahren sollte ich das wahre Antlitz meines Sports kennenlernen, und zwar auf die ganz direkte und brutale Weise – fast so, als würde man ein Tier, das man überfahren hat, eigenhändig sezieren müssen.
Wie es ist, ein großer Champion zu sein, werde ich nie erfahren. Was ich Ihnen erzählen kann, ist, wie es ist, mit dem Radfahren seine Brötchen zu verdienen. Der Job eines Radprofis ist außergewöhnlich, aber das Peloton besteht aus ganz normalen Typen, wie ich es bin, die hart, sehr hart gearbeitet haben, um irgendwann einen Beruf ausüben zu dürfen, der sie bisweilen bloßstellt und manchmal überfordert. Ich wollte kein Buch darüber schreiben, wie schwer es ist, Radprofi zu werden; ich möchte über das Leben berichten, das man führt, wenn man einer geworden ist.
Radprofi zu werden, war etwas, für das ich mich ganz bewusst entschieden habe, und diese Entscheidung traf ich lange, bevor die beiden Männer von Mapei in Kanada an mich herantraten. Für mich war schon früh klar: Ich würde es schaffen, und bis ich es nicht geschafft hätte, würde ich keinen Frieden finden.