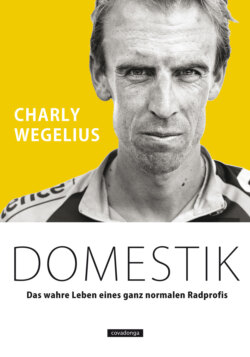Читать книгу Domestik - Wegelius Charly - Страница 9
ОглавлениеKAPITEL 1
ETWAS, DAS ICH TUN MUSSTE
»Monsieur Chaminaud … Charly Wegelius.«
Ich bemerkte die verständnislose Miene des Herrn in mittleren Jahren, der vor mir gegen den Kofferraum des weißen Teamfahrzeugs gelehnt stand, und beschloss, es noch einmal zu versuchen. Ich streckte die Hand aus und wiederholte, diesmal mit noch ausgeprägterem französischen Akzent, der den ungewöhnlichen Klang meines finnischen Nachnamens bis zur Unkenntlichkeit verzerrte:
»Char-lieh Weg-je-lie-üs.«
Nach einem bangen Moment des Zögerns schien bei ihm der Groschen zu fallen, und eine kalte Hand ergriff die meine und schüttelte sie zur Begrüßung. Trotz meiner Erleichterung darüber, dass Jean-François Chaminaud sich endlich entsann, wer ihm gegenüberstand, war das nicht gerade der Empfang, den ich mir erhofft hatte. Hinter dem Lächeln auf dem Gesicht meiner einzigen Bezugsperson beim französischen Amateurteam Vendée U, an dessen Stützpunkt ich soeben eingetroffen war, meinte ich einen Blick zu erkennen, der mit einem Anflug von Panik zu sagen schien: »Ach du Scheiße – bist du echt gekommen?«
Fairerweise muss ich sagen, dass ich nicht den besten Moment erwischt hatte, um mich bei meinem neuen Team vorzustellen. Als wir nach einer nächtlichen Fährüberfahrt am vereinbarten Treffpunkt ankamen, machte sich der Rest der Mannschaft gerade zum morgendlichen Training auf. Während ich nervös aus dem roten Ford Fiesta meiner Mutter stieg und die Gitane-Räder auf dem Dach des Vendée-U-Teamwagens sah, rollten die Fahrer allein oder zu zweit in den Morgen davon. Manche hatten argwöhnisch herübergeblickt, andere interessierten sich nicht die Bohne für den bebrillten blonden Teenager, der eben aufgetaucht war und darauf wartete, dass sich jemand um ihn kümmerte.
Von meinen Teamkollegen bewusst ignoriert zu werden, war etwas, woran ich mich in meiner Zeit als Amateur in Frankreich gewöhnen sollte, aber damals empfand ich es als eine ziemlich seltsame Art der Begrüßung. Für mein Dafürhalten war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als ich an diesem Morgen in Le Domaine Saint-Sauveur, ein paar Kilometer von La Roche-sur-Yon in der Vendée entfernt, eintraf, aber es stellte sich bald heraus, dass ich mit dieser Einschätzung alleine dastand.
1996 war Radfahren noch ein Sport, der weitgehend auf dem europäischen Festland stattfand. Als junger britischer Fahrer mit Ambitionen blieb einem nur eine Wahl: Man musste seine Heimat verlassen und jenseits des Ärmelkanals sein Glück versuchen. Das war ein Weg, den britische Radfahrer seit Generationen gegangen waren. Radrennsport war in Großbritannien eine Randsportart – das war schon immer so, und man hatte das Gefühl, dass sich das auch niemals ändern würde. Um es als Brite, Australier oder Amerikaner in den Profibereich zu schaffen, reichte es nicht, ein guter Fahrer zu sein, man musste auch zeigen, dass man das Zeug hatte, sich »da drüben« durchzusetzen.
Die Kommunikation zwischen Großbritannien und dem Festland ging damals noch quälend langsam vonstatten. Ein paar Monate vor meiner Ankunft in Frankreich hatte der britische Journalist Kenny Pryde mich in losen Kontakt mit Vendée-U-Trainer Jean-François Chaminaud gebracht. Nach einem handschriftlichen Briefwechsel hatte sich Chaminaud aus unerfindlichen Gründen bereiterklärt, mich aufzunehmen. Damals dachte ich mir nichts dabei, aber es war durchaus ungewöhnlich, dass eine Mannschaft wie Vendée U sich auf so etwas einließ. Ich war erst 17 und fiel noch in die Juniorenkategorie, ich war also nicht einmal alt genug, um an den gleichen Rennen teilzunehmen wie die anderen Fahrer im Team. Da ich damals immer einen Schritt weiter sein wollte, als gut für mich war, war es nur logisch, dass ich mich ausgerechnet bei Vendée U beworben hatte, der damals besten Amateurmannschaft in Frankeich. Jetzt war ich also da, nur einen Tag nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht hatte, und brannte darauf, mein Leben als Radrennfahrer zu beginnen.
Das Absurde meiner Situation war nicht das Einzige, was über meinen Horizont ging. Abgesehen von meiner Vereinsmannschaft VC York war ich nie Teil eines organisierten Rennstalls gewesen, und so hatte ich keine Vorstellung von den verwickelten Strukturen, die innerhalb eines richtigen Radsportteams herrschen konnten. Ich ahnte nichts von Seilschaften und verfeindeten Lagern. Der VC York hatte mir eine Rennlizenz besorgt und mich in seinem Trikot antreten lassen, aber es war nur ein kleiner Radsportverein, der ein Mal im Jahr ein Rennen und ein Clubdinner organisierte, mehr nicht. Als ich daher voller Freude das scheinbar konkrete Angebot von Vendée U annahm, war ich nicht darauf vorbereitet, dass die eine Hälfte der Mannschaft nicht mit der anderen sprach und Chaminaud, der innerhalb der Teamhierarchie nur eine Randfigur war, niemand davon unterrichtet hatte, dass ich käme. Als ich eintraf und mich vorstellte, waren Fahrer, Betreuer und Teamleiter Jean-René Bernaudeau vollkommen überrascht von meiner Ankunft.
Das Team steckte mitten in den Vorbereitungen für die Landesmeisterschaft im Mannschaftszeitfahren und hatte daher weder Zeit noch Lust, die Trainingseinheit wegen des unangekündigten Auftauchens eines dürren englischen Bengels zu verschieben. Sichtlich verlegen hatte Chaminaud eine kurze Unterredung mit Bernaudeau, die fast ausschließlich aus Grunzlauten zu bestehen schien. Man wies mich an, mich nicht von der Stelle zu rühren, und versprach, sich nach dem Training um mich zu kümmern. Meine Mutter war inzwischen wieder aufgebrochen, um ihre Fähre zu erwischen, so dass ich ganz allein zurückblieb. Ich suchte mir ein Plätzchen im Empfangsbereich der Teamzentrale und beschloss, mich zu setzen und zu warten.
Meine Reaktion war damals typisch für mich. Jemand, der für meine Karriere wichtig sein könnte, hatte mich aufgefordert zu warten, also wartete ich und dachte mir nichts weiter dabei. Ich stellte keine Fragen, und es gab keinen Teil von mir, der daran zweifelte, das Richtige zu tun, oder sich wunderte, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich war so wild entschlossen, dass ich keinen Gedanken an Heimweh verschwendete. Ich liebte meine Mutter und wusste, dass es nicht leicht wäre, so weit weg von zu Hause zu sein, aber gleichzeitig war mir klar, dass sie im Hinblick auf meine Ziele nicht mehr für mich tun konnte, als mich hierherzubringen. Von nun an würde es andere Leute geben, denen ich zuhören müsste, und die Vorstellung, mich solchen Gefühlen wie Heimweh hinzugeben, erschien mir wie reine Zeitverschwendung. Es war, als hätte ich diesen Teil meines Verstands einfach mit dem Skalpell herausgeschnitten und zurückgelassen, als ich meine Sachen packte und nach Frankreich aufbrach, weil er mir ja fortan eh nicht mehr von Nutzen sein würde.
Ich weiß eigentlich bis heute nicht genau, warum ich unbedingt Radprofi werden wollte. Ich war ganz gut in der Schule, ich kam nicht aus ärmlichen Verhältnissen und ich war nicht darauf angewiesen, mir auf diese Weise meine Brötchen zu verdienen. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich zwei Jahre alt war, ich kannte es also nicht anders und war so glücklich, wie man als Kind nur sein kann. Ich führte ein für mein Dafürhalten vollkommen normales Leben. Ich wuchs mit meinem Bruder Eddie und meiner Mutter Jane in York auf, verbrachte die Sommer und Schulferien aber bei meinem Vater in Finnland. Als wir jung waren, reisten Eddie und ich ziemlich viel zwischen den beiden Ländern hin und her. Eddie war vier Jahre älter als ich. Er nahm seine Verantwortung für mich sehr ernst und passte gut auf mich auf. Ich war sein kleiner Bruder, und er achtete stets darauf, dass mir auf unseren Reisen nichts passierte, und hielt jeglichen Ärger von mir fern.
Wir liebten es, nach Finnland zu fahren. Das ganze Land kam uns wie ein einziger Spielplatz vor. Die finnische Landschaft war so unberührt, dass sie uns wie eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten erschien. Es war ruhig und sicher, wir konnten in jede Richtung so weit laufen, wie wir wollten, und uns trotzdem darauf verlassen, dass jeder, den wir trafen, unseren Vater kannte und wusste, wer wir waren. Unser Vater wollte, dass wir unabhängig waren und uns selbst beschäftigten, weswegen er uns viele Freiheiten ließ. Eddie und ich waren voller Abenteuerlust, und uns selbst überlassen streunten wir herum wie wilde Hunde, kletterten im Wald auf Bäume, sprangen in Seen, fuhren auf der Farm den Traktor und tollten in den Ställen im Heu herum.
Dann gab es bisweilen Momente, in denen unser Vater es sich in den Kopf setzte, uns zu erziehen. Etwas zu tun, ohne dabei sein absolut Bestes zu geben, kam für unseren Vater nicht Frage, selbst wenn es sich um die banalsten alltäglichen Verrichtungen handelte. Er wollte uns ermuntern, uns ständig weiterzuentwickeln. Dieser Einfluss war es, der vielleicht mehr als alles andere den Nährboden für meinen unbedingten Ehrgeiz bereitete. Beim Baden im Schärenmeer suchten wir nach immer höheren Felsen, von denen wir uns ins eiskalte Wasser stürzten. Die Familienausflüge mit dem Fahrrad wurden länger und länger, bis ich schon als Neunjähriger Radtouren von mehr als hundert Kilometern unternahm.
Aufeiner dieser Touren gerieten wir 20 Kilometer von zu Hause in einen heftigen Sommerregen. Der Regen prasselte auf uns herab, und es wurde so finster, dass wir sicherheitshalber hintereinanderfuhren. Da ich der Jüngste war, fuhr ich vorneweg. Alles, woran ich denken konnte, war, nach Hause zu kommen und heiß zu duschen. Das Rad wog eine Tonne und hatte nur einen Gang und eine Rücktrittbremse, aber ich hämmerte in die Pedale und nahm immer mehr Tempo auf. Ich fuhr über den Lenker gekrümmt und spürte, wie mir das eiskalte Wasser in die Schuhe rann. Ich blinzelte auf die Straße vor mir und dachte an nichts anderes als daran, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Als ich dort ankam, stellte ich erstaunt fest, dass ich ganz alleine war. Ich hatte keinen Sturz mitbekommen und dachte mir daher nichts weiter dabei und ging ins Haus. Als mein Vater und Eddie eintrafen, war ich bereits geduscht und aufgewärmt. Eddie war fassungslos. »Warum zur Hölle bist du einfach abgehauen?«
»Ich bin einfach nur gefahren. Ich wollte euch nicht abhängen. Ich wollte nach Hause.«
»Warst du nicht müde? Wir kamen nicht mehr mit. Du bist einfach abgedampft.«
»Klar war ich müde. Ich war völlig im Eimer und mir war arschkalt. Aber ich wollte nach Hause, also habe ich Gas gegeben. Ich dachte, ihr wärt direkt hinter mir.«
»Na ja, hast du dich nicht umgeguckt?«
Mir dämmerte, dass ich das nicht getan hatte. Ich dachte, er wäre sauer, dass ich ihn stehen gelassen hatte. Aber Eddie war nicht sauer, dass ich schneller war als er; er verstand nur nicht, wie jemand einfach abhauen konnte, ohne sich nach den anderen umzusehen. Eddie fehlte die skrupellose Mentalität eines Leistungssportlers, die ich offenbar mit Löffeln gefressen hatte.
Während Eddie staunte, war mein Vater, nachdem er den Schock, von seinem Jüngsten abgehängt worden zu sein, erst einmal verdaut hatte, ziemlich beeindruckt. Für ihn war alles, auch Zuneigung und Aufmerksamkeit, eine Frage der Leistung. Weil ich nichts anderes kannte, hielt ich das für ganz normal. Nur die fassungslosen Mienen von Freunden der Familie, wenn sie von meinen Heldentaten erfuhren, ließen erahnen, dass es ungewöhnlich war.
So wie viele Kinder versuchte ich mich von klein auf in allen möglichen Sportarten und ich fand, dass ich ziemlich gut darin war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich einen Sport finden würde, dem ich mich ernsthaft widmen könnte. Als ich das Radfahren entdeckte, war mir sofort klar, dass ich den richtigen Sport für mich gefunden hatte. Es war etwas Besonderes daran – ich war zu jung und zu aufgedreht, um mich jemals zu fragen, was genau es war, aber anders als andere Sportarten, an denen ich recht schnell das Interesse verlor, zog es mich von Anfang an in seinen Bann.
Es war 1990, als ich den Radsport wirklich für mich entdeckte. Meine Mutter nahm mich zu ein paar Kriterien in York mit, wo ich unter anderem Malcolm Elliott sah, der im Jahr zuvor das Punktetrikot bei der Vuelta a España gewonnen hatte. Auf mich wirkte er wie ein verdammter Gladiator. Er war braun gebrannt, und seine Beine sahen aus, als wären sie aus Mahagoni geschnitzt worden. Mit seinem Teka-Stirnband und diesem umwerfenden Mädel im Schlepptau sah er dermaßen cool aus. Alles an ihm schien zu strahlen: sein Rad, seine Schuhe, er selbst. Er ließ Radrennfahrer wie etwas Außergewöhnliches erscheinen. In gewisser Weise sahen Radprofis nicht wie normalsterbliche Menschen aus; ihre Körper glichen eher Maschinen, die fürs Radfahren gemacht waren. Ich konnte meine Augen kaum von ihm lösen. Er war so etwas wie die Verkörperung aller Helden, die ich hatte. Es beeindruckte mich auch, wenn ich beispielsweise einen älteren Jungen sah, der ein paar coole Tricks auf seinem BMX-Rad draufhatte, aber das hier war noch mal etwas ganz anderes. Das hier war viel mehr. Es war so aufregend. Es kam mir vor, als wäre ein Filmstar aus der Leinwand gestiegen.
Malcolm Elliotts Auftritt in York hinterließ einen bleibenden Eindruck, war aber leider viel zu kurz. Ich wollte mehr, und so schaute ich mir im Sommer die Kellogg’s Tour an, die nicht weit von zu Hause entfernt über die White Horse Bank führte. Robert Millar war für das Team Z dabei und trug das Bergtrikot. Ich kann mich noch gut an seinen Blick erinnern, als er den Anstieg bezwang. Ich war berauscht davon, in den Mienen der Fahrer zu erkennen, wie sehr sie sich quälten.
Der Radrennsport war damals bei uns in England keine große Nummer, aber die tollen Rennen zu sehen und von den Fahrern mit ihren fremdartig klingenden Namen zu hören, die für exotisch wirkende Teams fuhren, weckte in mir den Wunsch, selbst Teil dieser aufregenden Welt zu werden. Der Straßenradport hatte seine Wurzeln nicht in England, so wie Fußball oder Cricket, er stammte von einem ganz anderen Planeten. Und ich war zunehmend besessen von allem, was diese ferne Welt des professionellen Radfahrens zu verheißen schien. Die einwöchige Kellogg’s Tour of Britain und die einstündigen Kriterien waren mir schon bald nicht mehr genug. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf das größte Rennen von allen: die Tour de France.
Die Tour war das Größte, was ich mir ausmalen konnte. Ich war so erfüllt davon, die Tour zu verfolgen und von der Tour zu träumen, wie man es nur als Kind sein kann, wenn man die entsprechende Freizeit hat. Ich besorgte mir Michelin-Regionalkarten der Alpen und vertiefte mich in sie. Ich war jung und ein Tagträumer, aber in mir reifte bereits die Entschlossenheit, diese Träume eines Tages Realität werden zu lassen. Wenn ich mir den Col de la Croix de Fer auf der Karte ansah, war es fast so, als würde ich den realen Ort ergründen. Bourg d’Oisans war, wie mir klar wurde, keine geheimnisvolle Fantasiestätte wie aus einem Buch von Tolkien, sondern es war ein realer Ort, an dem Menschen lebten, zur Schule gingen und arbeiteten.
Straßenkarten von Südfrankreich sind nicht unbedingt das, wofür Elfjährige normalerweise ihr Taschengeld ausgeben, aber für mich bildeten sie eine Verbindung zwischen meinem eigenen Leben in York und der unvorstellbar exotischen Welt des Profiradsports. Indem ich mir diese Karten kaufte und versuchte, mich an diese Orte zu versetzen, unternahm ich die ersten Schritte, um diese Kluft zu schließen. Meine ersten Gehversuche in Richtung einer Profikarriere musste ich aber vor der eigenen Haustür machen.
»Mum, du musst für mich einen Brief an den Direktor schreiben.«
Es war schon recht spät für ein Abendessen unter der Woche, aber meine Trainingsfahrt war wie üblich viel länger ausgefallen, als ich angekündigt hatte. Es war schon fast neun, und meine Mutter sah mich an, während sie mir die Portion Shepherd’s Pie servierte, mit der sie auf mich gewartet hatte.
»Und warum, Charles?«
»Ich verschwende in der Schule meine Zeit und ich glaube, ich könnte sie besser nutzen.«
»Wie meinst du das?«
Ich war stets dazu ermuntert worden, so zu denken und mich auszudrücken wie ein Erwachsener, und jetzt, mit 15 und zunehmendem Selbstvertrauen, fing ich an, meine Meinung unverblümt zu äußern. Ich trug meine Argumente vor.
»Ich möchte am Mittwochnachmittag meine Zeit nicht mehr mit Schulsport verschwenden, sondern sie zum Radfahren nutzen. In der Schule geht es ja darum, mich auf meine Zukunft vorzubereiten, und da ich weiß, dass ich später nicht Rugby oder Fußball spielen möchte, sondern Radprofi werde, ist das Training wichtiger als alles andere. Ich würde keinen Unterricht versäumen und außerdem mag ich es nicht, im Dunkeln zu trainieren: Es ist gefährlich und außerdem bleibt keine Zeit für Hausaufgaben, wenn ich nach Hause komme …«
Meine Mutter wusste schon, dass ich Radprofi werden wollte. Bis dahin hatte es nie Diskussionen darum gegeben, ob es mir gestattet würde, eine Laufbahn als Leistungssportler einzuschlagen. Mein Vater hatte als Springreiter Karriere gemacht, und wenngleich es grundsätzlich schwer umzusetzen und naturgemäß nicht planbar war, einen Sport zum Beruf zu machen, hatte meine Mutter, mehr als jeder andere, stets ohne Wenn und Aber an mich geglaubt. Als ich als Zehnjähriger erstmals davon gesprochen hatte, die Tour de France fahren zu wollen, hatte sie meinen Wunsch akzeptiert und sich große Mühe gegeben, mir beim Einstieg zu helfen, und mich zu Wettkämpfen im ganzen Land gefahren. An den Wochenenden saß sie, mit der Sunday Times und einer Thermoskanne Tee, auf Parkplätzen vor irgendwelchen Gemeindehäusern im Auto und wartete geduldig darauf, dass ich das Rennen, das ich gerade absolvierte, hinter mich brachte. Das war ihre Art, mich zu unterstützen. Nach jedem Rennen überließ sie es mir, ob ich auf dem Heimweg darüber sprechen wollte, wie es gelaufen war, oder eben nicht. Auch wenn ich auf der ganzen Rückfahrt nur mürrisch dasaß und kein Wort sagte, war sie nie genervt oder zudringlich. Mein Rennen war mein Rennen, und es war eben gelaufen, wie es gelaufen war, und das stellte sie nie in Frage. Ebenso stand nie zur Debatte, dass ich meine Ausbildung abschließen würde – das erschien mir nur fair. Ich ging weiterhin zur Schule und bekam ordentliche Noten, und im Gegenzug durfte ich praktisch meine ganze Freizeit auf dem Rad verbringen. Nun aber stand die Frage im Raum, ob es mir zu einem wichtigen Zeitpunkt meiner Schullaufbahn erlaubt werden sollte, den Schwerpunkt endgültig auf den Radsport zu verlegen. Obwohl die Abschlussprüfungen kurz bevorstanden, war es nur logisch, dem Radfahren mehr Zeit zu widmen – so sah ich es jedenfalls. Es war plausibel und es war machbar und es würde mir meinen Altersgenossen gegenüber einen Vorteil verschaffen.
Meine Mutter blickte auf die Uhr an der Wand, bevor sie wieder mich ansah und ohne eine Spur von Widerwillen sagte: »Tja, wenn du meinst, dass du deine Zeit auf dem Rad sinnvoller nutzen kannst, werde ich den Brief schreiben.«
Das war die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Ich wusste nun, dass ich den Segen meiner Mutter hatte, das eigentliche Ziel zu verfolgen, das ich mir gesetzt hatte.
Zwei Wochen später, nachdem ich rasch zu Mittag gegessen und in der Schulumkleide in meine Radklamotten geschlüpft war, holte ich mein Rad aus dem Schuppen. Als ich in die Pedale einklickte und Richtung Schultor rollte, verspürte ich eine fast unbeschreibliche Erregung. Der Schulleiter der Bootham School hatte mir erlaubt, den Sportunterricht am Mittwochnachmittag auszulassen und stattdessen in Eigenverantwortung auf dem Rad zu trainieren. Als ich durch das Tor fuhr und der Lärm des Schulhofs allmählich hinter mir verklang, verspürte ich ein Gefühl von Freiheit und Genugtuung, wie ich es in meinem Leben noch nicht gekannt hatte. Ich ließ den gewöhnlichen Alltag hinter mir und machte mich auf den Weg in die Welt, die ich mir erträumt hatte.
Es war nicht nur der physische Akt des Radfahrens, von dem ich besessen war. Ich wollte unbedingt alles wissen, was über die Welt des Radrennsports zu erfahren war. Ich verschlang jede Geschichte darüber, wie andere junge englische Fahrer sich durchgesetzt hatten, die ich irgendwie auftreiben konnte. Ich las jedes Buch und jedes Magazin zum Thema. In gewisser Weise war das Aufspüren solcher Geschichten nicht weniger aufregend als alles andere. Damals gab es kein Internet und auch sonst keine einfache Möglichkeit, an diese Informationen heranzukommen. Der Profiradsport wurde mir sozusagen tröpfchenweise verabreicht, mittels Begegnungen, Gemunkel und weitergereichten Büchern und Erzählungen.
Natürlich suchte ich den Kontakt zu Leuten, die mir hinsichtlich meiner Ziele behilflich sein könnten. Die Unterstützung meiner Mutter war ungemein wichtig, aber als ich in die Juniorenklasse kam, wusste ich, dass ich von nun an auf Leute angewiesen wäre, die sich im Profizirkus auskannten.
Ich traf Mike Taylor zum ersten Mal bei der Junior Tour of Ireland im Herbst vor meiner Abreise nach Frankreich. Mike war kurz zuvor zum Leiter der britischen Junioren-Nationalmannschaft ernannt worden, für die ich nominiert wurde. Ich fühlte mich bei Mike gleich gut aufgehoben. Er war schon seit einer scheinbaren Ewigkeit im Geschäft, er verstand die Fahrer und er verstand den Sport. Er hatte mehr Ahnung von diesem Metier als jeder andere, den ich bis dahin kennengelernt hatte. Mike war nichts für Zartbesaitete. Er war direkt und ließ sich nichts gefallen. Nach nur einer Woche in Irland schien ich eine der Schlüsselfiguren für meine berufliche Zukunft gefunden zu haben. Ich wollte wissen, wie ich es zum Profi bringen könnte, und ich wusste, dass Mike mir dabei helfen könnte. Nachdem wir aus Irland zurückgekehrt waren, hing ich fast täglich an der Strippe und bombardierte Mike mit Fragen über Fragen. Dank seiner Ratschläge erkannte ich bald, welchen Weg ich einschlagen müsste.
Die bewährte Weise, um es in den Profizirkus zu schaffen, war, auf das europäische Festland zu gehen und es darauf ankommen zu lassen. Es gab keine Schulen oder Akademien; alles hing vom persönlichen Engagement und einer Menge Unwägbarkeiten ab. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Seit den 1960er Jahren hatte sich an diesem Ablauf kaum etwas verändert: Um sich als britischer Fahrer Anerkennung im Peloton zu verschaffen, musste man sich an das Leben in einem anderen Land anpassen. Es gehörte mehr dazu, als von zu Hause auszuziehen und sich einen Job zu suchen. Man musste komplett seine Zelte abbrechen und bereit sein, alles zu tun, was einem von französischen oder belgischen Teamleitern – die keinerlei Aufsichtspflicht für ihre Schützlinge hatten – gesagt wurde, um das entscheidende Quäntchen besser zu sein als die anderen. Für mich, und vielleicht auch für andere, war es ein Teil des Anreizes, sich auf dem Festland als Profi durchzusetzen – es dort zu schaffen, war für einen britischen Radsportler ein echter Ritterschlag, denn das gelang nur ganz wenigen, und es war ein hartes Stück Arbeit. Als ich in Frankreich im Trainingslager von Vendée U eintraf, gab es nicht mehr viel, was mich hätte schrecken können. Innerlich war ich überzeugt: Mich würde nichts aufhalten.
* * *
In Frankreich ließen sich die Dinge anfangs weiterhin kompliziert an. Nachdem ich geduldig auf sie gewartet hatte, kehrte die Mannschaft schließlich von ihrer Trainingsfahrt zurück, und gemeinsam fuhren wir zur Unterkunft in Saint-Maurice-le-Girard. Dort stellte sich erneut heraus, dass mein Timing nicht besonders gut war. Auf der Fahrt erklärte man mir, dass sich ein Typ aus Polen um das Haus kümmerte, der früher selbst gefahren war, mittlerweile aber die Straße runter in Bernaudeaus Sportgeschäft arbeitete. Das Haus bewohnte er mit seiner Frau und den ausländischen Fahrern des Teams: Aidan Duff, Piotr Wadecki aus Polen und Janek Tombak aus Estland. Aidan war Ire und gerade zu einem Rennen unterwegs. Ich hatte von ihm gehört und war froh, wenigstens einen englischsprachigen Mitstreiter zu haben. Ich lernte ihn aber erst ein paar Tage später kennen.
Offenbar erpicht darauf, rechtzeitig zum Abendessen daheim zu sein, machte Bernaudeau mit mir, ohne sich von der Stelle zu rühren, eine Express-Führung durchs Haus. Er wedelte mit den Armen in Richtung verschiedener Türen, die von unserem Standort im Flur aus zu sehen waren. Nachdem er den Kopf zur Küche reingesteckt hatte und unter erstauntem Geschnatter der Osteuropäer erläuterte, dass ich von nun an ihr Mitbewohner wäre, wandte er sich an mich und sagte: »Sieh zu, dass du bis 13 Uhr geduscht hast. Danach gibt’s kein heißes Wasser mehr.« Und weiter: »Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Achte darauf, deine Lebensmittel zu kennzeichnen, falls du nicht willst, dass sie ein anderer isst.« Damit war die Einführung beendet, und Bernaudeau zog ab. Das war’s.
Die Unterkunft selbst war sehr schlicht. Sie wirkte auf mich wie ein Ort, an dem alte Leute wohnten oder sogar vor kurzem jemand gestorben war. Es machte auf jeden Fall den Anschein, als hätten die Bewohner soeben noch genug Kraft, um das Allernötigste sauber zu halten. Alles andere war verstaubt, und überall lagen irgendwelche vergessenen Dinge herum, die dort nicht hingehörten. Vendée U mochte das beste Team in Frankreich sein, aber die Fahrerunterkunft hatte eher etwas vom Versteck einer verfluchten Terrorzelle.
Ich sah mich noch einmal um, verzog aber keine Miene. Mir war klar, dass ich keine Wahl hatte, wollte ich Radprofi werden. Es war eine Art Initiationsritus.
Ein Teil von mir schätzte sich ehrlich gesagt sogar glücklich darüber. Die Geschichten meiner britischen Vorgänger hatten mich darauf vorbereitet, den ganzen Dreck, den ich über mich ergehen lassen musste, zu ertragen. Ich fasste diese Prüfungen als einen Prozess auf, der mir die Legitimation verschaffen würde, Profi zu werden. Selbst als ich mich in der armseligen Unterkunft umsah, die von nun an mein neues Zuhause wäre, war das einzige Gefühl, das ich verspürte, das von Schuld. Tief in mir drinnen wusste ich, dass ich es im Vergleich mit meinen Vorgängern noch leicht hatte, denn immerhin würde ich mir eine Telefonkarte von France Télécom kaufen können, um, wenn es gar nicht anders ging, meine Mutter anzurufen.
* * *
Meine ersten Wochen in Frankreich waren ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Es war nicht so, dass man sich nicht gut um mich gekümmert hätte; man kümmerte sich einfach überhaupt nicht um mich.
Ich musste erst den Mumm aufbringen, aber irgendwann beschloss ich, etwas zu unternehmen. Ich ging zum Büro, in dem Jean-René Bernaudeau telefonierte und Akten wälzte, klopfte an und trat ein. Jean-René schien nicht überrascht, mich zu sehen: In den paar Wochen, seit ich in Frankreich war, hing ich fast ständig in der Teamzentrale herum. Wenn ich nicht gerade auf dem Rad saß und trainierte, hatte ich sonst nicht viel zu tun. Mein Status als Fahrer, der noch in die Juniorenklasse fiel, stellte ein größeres Problem dar, als nur für verlegene Mienen bei meiner Ankunft zu sorgen. Das Team hatte keine Ahnung, wie sie an eine Lizenz herankommen sollten, noch bei welchen Rennen ich als Ausländer antreten durfte. Kurz gesagt wussten sie eigentlich nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollten. Die ersten beiden Wochen verbrachte ich damit, zu trainieren, herumzuhängen und kleinere Arbeiten wie Rasenmähen zu verrichten. Eines wurde mir allmählich klar: Wenn ich nicht selbst etwas unternähme, würde es auch niemand anders für mich tun. Ich beschloss also, die Initiative zu ergreifen.
Ich besorgte mir eine Ausgabe des France Cycliste, des Magazins des französischen Radsportverbands, ging damit zu Bernaudeau, schlug die betreffende Seite vor ihm auf und erklärte in meinem Schulfranzösisch: »Est ce que c’est possible de allez faire cette course?«
Jean-René schaute mich etwas überrascht an und bedachte mich mit einem unverbindlichen gallischen Achselzucken, während er ein gedehntes und spekulatives »Ouais …« von sich gab.
Das war genau die Art zurückhaltender Antwort, die ich erwartet hatte. Obwohl es Chaminaud – der Trainer des Teams – gewesen war, der mich eingeladen hatte, für die Mannschaft zu fahren, hatte ich seit unserer anfänglichen Begegnung wenig bis gar nichts mit ihm zu tun gehabt. Es stellte sich bald heraus, dass Jean-René Bernaudeau es war, der den ganzen Laden schmiss und mich jetzt an der Backe hatte.
»Ich bin los und habe mir den France Cycliste und eine Karte besorgt«, fuhr ich fort, »und ich habe geschaut, welche Rennen in der Nähe für mich in Frage kommen. Ich habe mal recherchiert und herausgefunden, dass ich mit einer internationalen Lizenz fahren darf, ich habe also Anmeldungen zu sämtlichen Rennen abgeschickt, die ich nächsten Monat bestreiten kann.«
Er sah mich fassungslos an, und ich konnte sehen, wie ihm buchstäblich ein Licht aufging: »Ach du Scheiße, der Knabe will echt Rennen fahren!« Das erste Rennen fand nur rund eine Stunde von unserer Unterkunft entfernt statt, und nachdem ich mein Anliegen vorgebracht hatte, lag es jetzt an Jean-René.
»Tja, nimm am besten den Transporter vom Laden und fahr selbst hin. Bon chance.«
Mir den Bulli zu überlassen, fasste ich als deutliches Signal auf, dass ich seinen Segen hatte, also packte ich am Wettkampftag meine Siebensachen zusammen und machte mich auf den Weg. Es war ein Rennen der sogenannten »Nationale«-Kategorie, die für junge Fahrer und berufstätige Freizeitradsportler gedacht waren – ein echtes Amateurrennen also. Als der Startschuss fiel, ging ich das Rennen an, wie ich damals jedes Rennen anging: Ich machte von Anfang an Attacke und riss aus, wenn mir danach war. Ich gewann sämtliche Prämiensprints und auch das Rennen. Nachdem ich meine Prämien eingesackt hatte, packte ich wieder zusammen und machte mich auf den Rückweg. Ich war zufrieden mit mir und machte mir wenig Gedanken darüber, was ich hatte auf mich nehmen müssen, um bei diesem Rennen dabei zu sein. Letztlich war es einfach etwas, das ich tun musste. Aber meine Kollegen und die Betreuer waren baff: »Leck mich, das hast du alles alleine hingekriegt?« Der Sieg war das eine, aber was sie wirklich beeindruckte, das war meine Einstellung. Die meisten Fahrer des Teams hätten nicht im Traum daran gedacht, ohne einen soigneur oder einen Mechaniker oder wenigstens jemanden, der sie hin- und zurückfuhr, zu einem Rennen aufzubrechen. Ich hatte die ganze Sache ganz ohne fremde Hilfe durchgezogen.
Ein gutes Beispiel dafür war die Art, wie wir unsere Räder warteten. Ich reinigte mein Rad nach jeder Trainingsfahrt mit Diesel und zwar so lange, bis es makellos sauber war. Ich achtete darauf, mein Rad jeden Morgen fit fürs Rennen zu machen, jeden verdammten Tag. Die anderen Fahrer und die Betreuer sahen mir dabei zu, und ich war sicher, dass sie sich insgeheim über mich lustig machten. Das Problem war, dass die Fahrer von Vendée U ihr Leben lang von ihren Clubs und Teams mit Rädern ausgestattet worden waren, während ich eigene Rahmen und Komponenten benutzte, auf die ich gespart und die ich von meinem eigenen Geld gekauft hatte. Nach jeder Rennsaison nahm ich mein Rad komplett auseinander und reinigte sämtliche Einzelteile mit Brasso-Metallpolitur und wickelte sie in Zeitungspapier ein, damit sie den Winter warm und trocken überstehen würden. Meiner Ansicht nach musste man seine Sachen hegen und pflegen, weil sie schwer zu bekommen waren. Die Kollegen von Vendée U sahen das anders, und nach ein paar Jahren im Profzirkus hatte auch ich mir diese Einstellung angeeignet. Auch mein Wettkampfrad war später eine Schande, es war ständig schmutzig, und die Reifen meiner Trainingslaufräder waren löchrig wie ein Schweizer Käse. Aber damals, Anfang der Neunziger, stand ich jeden Tag draußen und wienerte wie ein Irrer mein Rad, während meine Kollegen mich auslachten. Es war mir einfach egal.
* * *
Ich gewann in jenem Sommer noch weitere Rennen, aber gegen Ende Juli änderte sich alles.
Während ich mein Rad schob, trug Jean-René meine Tasche und führte mich durch den Vorgarten eines typischen französischen Vorstadthäuschens und klingelte an der Tür. Es war ein warmer Sommerabend, und Sprinkler wässerten träge den gepflegten Rasen vor dem Haus. Während ich auf das Gras blickte, öffnete sich die Tür und ein Mann, der ein paar Jahre älter war als Jean-René und den ich von ein paar Rennen in der Gegend kannte, bat uns herein.
Als wir hineingingen, fiel mir gleich auf, wie dunkel es im Haus war. Wegen der Hitze waren sämtliche Fensterläden tagsüber geschlossen und noch nicht geöffnet worden, um die kühle Abendluft hineinzulassen. Das Haus selbst war ordentlich und sauber, und trotz der seltsamen Stille, die von der Dunkelheit erzeugt wurde, kam es mir irgendwie heimelig vor. Wir gingen in die Küche und nahmen an einem Tisch Platz. Der Mann bot uns höflich etwas zu trinken an. Er öffnete den Kühlschrank und holte ein kaltes Bier für Jean-René und für mich ein Mineralwasser heraus. Dabei drang mir das scharfe Aroma eines vollreifen französischen Käses in die Nase. Es war das erste Mal, dass ich bei richtigen Franzosen daheim zu Gast war. Bis dahin hatte ich in Frankreich mit vier anderen Ausländern zusammengewohnt, und in unserem Kühlschrank roch es nach Schimmel und saurer Milch, und was darin war, hatte weiß Gott nichts Französisches an sich. Hier aber wurde mir gleich bewusst, dass ich mich in einem richtigen französischen Zuhause befand. Der Duft richtigen Essens hätte mich trösten sollen, aber stattdessen wurde mir noch schwerer ums Herz.
Ein paar Tage zuvor hatte ich erfahren, dass ich die Teamunterkunft verlassen sollte, denn Jean-René hatte im wenige Kilometer entfernten Städtchen La Roche-sur-Yon etwas aufgetan, was »passender« für mich wäre. Ohne mich zu fragen, war ausgemacht worden, mich im Haus eines Nachwuchsfahrers unterzubringen, der für den örtlichen Club antrat. La Roche war lose mit Vendée U verbunden und trug ähnliche Trikots, war aber nicht unbedingt das, was man sich unter einem seriösen Radsportteam vorstellte. Dem Club gehörten vor allem ältere Herren und Schüler an. Die Schulferien hatten begonnen, und entweder Jean-René oder die Eltern des Nachwuchsfahrers hatten sich wohl überlegt, dass es sicher nicht schön sein könne, so ganz ohne Altersgenossen in der Teamunterkunft zu wohnen. Vielleicht dachten sie, dass ich ein paar andere Dinge unternehmen würde außer Radfahren und Putzen, wenn ich bei ihnen unterkäme. Das war eine unheimlich freundliche Geste, aber ich war so verbohrt, dass ich am Boden zerstört war, statt mich über die Annehmlichkeiten einer familiären Umgebung zu freuen. Ich kam mir vor wie bei einem Schüleraustausch.
In meinem engstirnigen, verbissen auf mein Ziel ausgerichteten Denken war Vendée U genau der Ort, an dem ich sein musste: Vendée U war der schnellste Weg ins Profigeschäft. Das Leben in der Teamunterkunft war alles andere als einfach. Das ältere polnische Ehepaar war kurz nach meiner Ankunft ausgezogen, und mit den beiden ging auch der letzte Hauch von Sauberkeit und Ordnung verloren. Wir wuschen bestenfalls unsere eigenen Teller und unsere Plätze am Tisch ab, alles andere, wie auch Dusche und Toilette, wurde nicht ein Mal saubergemacht. Die Bude war über alle Maßen abstoßend, trotzdem hatte ich zwei Gründe, dort bleiben zu wollen. Zum einen bedeutete meine bloße Anwesenheit dort, dass ich, selbst wenn ich keine Rennen mit der Mannschaft bestritt, einen Fuß in der Tür hatte. Zum anderen hatte ich das Gefühl, dort einen echten Freund zu haben.
Aidan und ich hatten uns auf Anhieb gut verstanden. Als er nach meinem Einzug von seinem Rennen zurückkehrte, hatte er keine Ahnung, wer ich war und was ich dort zu suchen hatte, aber er schien nicht weiter überrascht, mich in der Unterkunft anzutreffen. Ich stellte mich vor, und es gab keinerlei Probleme, er sagte nur hallo und fing an zu erzählen, als wäre ich schon die ganze Saison da gewesen. So war Aidan: Er nahm die Dinge, wie sie kamen, mit einem Lächeln und einem Achselzucken, und machte weiter seinen Kram.
Als ich nach La Roche abgeschoben wurde, hatte ich das Gefühl, es verbockt zu haben, als hätte ich in den Rennen nicht genug gezeigt, obwohl ich jedes einzelne gewonnen hatte. Von dem Moment an, als Jean-René sich verabschiedete und mich am Küchentisch zurückließ, schlurfte ich durchs Haus wie ein beleidigter Teenager und geißelte mich dafür, in Ungnade gefallen zu sein. Morgens trainierte ich für mich allein und nachmittags lag ich auf dem Bett und las den France Cycliste von vorne bis hinten. Halbwüchsige Burschen sind nicht gerade Meister des Subtilen, und so dämmerte der Familie bald, dass etwas nicht stimmte. Nach etwa zehn Tagen klopfte eines Abends der Vater verlegen an meiner Tür und kam in mein Zimmer.
»Charly, wir haben das Gefühl, dass du nicht ganz glücklich bei uns bist, ich habe daher mit Jean-René gesprochen … falls du also zurück in die Teamunterkunft möchtest …«
Kaum hatte er es ausgesprochen, konnte ich meine Erleichterung kaum verbergen. Ohne darüber nachzudenken, wie unangenehm es für seine Familie war – und mir hätte sein sollen –, lief ich außer mir vor Freude durchs Haus und packte meine Sachen. Als ich etwa eine halbe Stunde später den Wagen von Vendée U vorfahren hörte, stürmte ich durch die Tür und konnte kaum erwarten, wieder in die Unterkunft zu kommen. Sobald ich zurück war in der alten Bruchbude voller polnischer Radfahrer, mit denen ich mich kaum verständigen konnte, und in der es ansonsten zuging wie im Taubenschlag, freute ich mich wie Bolle. In dem Haus einsamer Männer war ich glücklicher als im Schoß einer Familie.
Nach meiner Rückkehr eilte ich den Sommer hindurch beinahe nach Belieben von Sieg zu Sieg. Wie jeder Fahrer weiß, ist alles andere relativ egal, solange es auf dem Rad gut läuft. Das Siegen fiel mir damals leicht, aber ich hatte noch viel zu lernen.
* * *
Bevor ich nach dem Ende meiner ersten Saison heimfuhr, erhielt ich meine erste richtige Lektion im Profigeschäft. Zum ersten Mal wurde ich von jemand anderem als mir selbst unter Druck gesetzt.
Nachdem ich den einheimischen Superstar Sandy Casar bei einem Junioren-Weltcuprennen in der Bretagne locker geschlagen hatte, beschloss Jean-René, mich beim Grand Prix des Nations anzumelden, einem prestigeträchtigen Profizeitfahren, in dessen Vorprogramm auch eine Juniorenkonkurrenz ausgetragen wurde. Das Rennen wurde von den Machern der Tour de France veranstaltet und teilnehmen durfte nur, wer eine Einladung erhielt. Aus irgendeinem Grund wurde meine Anmeldung für das Rennen abgelehnt. Jean-René war außer sich. Wenn er sich etwas in den Kopf setzte, dann war er wie eine Naturgewalt: Nichts konnte ihn aufhalten. Er bestellte mich in sein Büro und sagte: »Setz dich, ich kläre das.«
Er rief sofort bei den Veranstaltern an. Ich wollte unbedingt dabei sein, aber als ich ihm so zuhörte, überlegte ich, ihm vielleicht sagen zu sollen, dass es nicht das Ende der Welt wäre, sollte ich nicht starten dürfen. Ich hörte alles mit: Er versicherte ihnen, dass ich meine Sache gut machen werde, und beteuerte mit der ganzen Empörung eines beleidigten Franzosen: »Ihr müsst diesen Burschen fahren lassen. Ich schwöre euch, dass er sich gut aus der Affäre ziehen wird.«
Vor diesem Telefonat hatte ich lediglich den Druck verspürt, den ich mir selbst auferlegte. Jetzt hatten sich die Vorzeichen geändert: Ich, der dürre kleine Charly Wegelius vom VC York, war soeben von Jean-René Bernaudeau in die Pflicht genommen worden. Der Gedanke, dass dieser Mann, der selbst eine erfolgreiche Profikarriere gehabt und später unter anderem die Castorama-Mannschaft geleitet hatte, ließ mich in meinen blau-gelben, vom Team bereitgestellten claquettes erzittern. Selbst in dem Alter war mir klar, was auf mich zukam. Wie ich im Laufe der Zeit feststellen sollte, waren Druck und die Fähigkeit, mit ihm umzugehen, zwei der maßgeblichen Aspekte im Leben eines Radprofis.
Nachdem er sich so sehr reingehängt hatte, mir einen Startplatz zu besorgen, setzte Jean-René alle Hebel für mich in Bewegung. Nun war es eine Frage der Ehre, also gewährte er mir jegliche Unterstützung, die er irgendwie organisieren konnte. Ich wurde mit dem Teamwagen, drei Zeitfahrmaschinen, vier Scheibenrädern und Teammasseur Jacques Duchain zum Rennen geschickt. Jacques war seit Jahren im Radsport unterwegs und hatte für verschiedene französische Profimannschaften gearbeitet. Er war richtig gut, der beste soigneur, den das Team hatte, und er war nur für mich da.
Das Rennen fand am Lac de Madine in der Nähe von Nancy im Nordwesten von Frankreich statt. Ich reiste am Vortag mit Jacques an und sah staunend zu, wie er einen minutiösen Fahrplan für mich aufstellte. Seine Anwesenheit wirkte beruhigend, aber nicht genug, um meine innere Anspannung zu überwinden. Mein sonst so friedlicher und unbeschwerter Schlaf war zum ersten Mal in meinem Leben unruhig und aufgewühlt.
Am Rennmorgen war ich erst recht ein Nervenbündel. Ich wollte nur endlich auf die Startrampe und losfahren. Bis es so weit war, erschien mir jede Sekunde wie eine Ewigkeit.
Als ich auf die Startrampe rollte und von einem Ordner festgehalten wurde, versuchte ich, alles andere auszublenden. Ich konzentrierte mich ganz auf den Countdown; ich schaute auf den Starter, der auf seine Stoppuhr sah, eine behaarte Hand vor mir ausstreckte und die Sekunden runterzählte: »Cinq … quatre … trois… deux … un … TOP!!«
Vor lauter Ungeduld trat ich so heftig in die Pedale, dass mein Reifen auf der hölzernen Rampe, die noch feucht war vom Morgentau, seitlich wegrutschte. Einen Moment lang rutschte mir das Herz in die Hose, aber nachdem ich es unfallfrei die Rampe hinab auf den Asphalt geschafft hatte, ging ich aus dem Sattel und ließ es richtig krachen. Ich drehte so schnell es ging auf maximale Leistung hoch. Als ich entlang der Absperrung um die erste Kurve in Richtung der offenen Strecke fuhr, fing ich an zu hyperventilieren. Ich hechelte wie ein Hund, der zu blöd ist, die Verfolgung des Hasen aufzugeben. Als ich die Stadt hinter mir ließ und durch die Landschaft bretterte, konnte ich hinter mir die quietschenden Reifen des Begleitwagens hören und Jacques’ Blicke auf mir spüren. Die Strecke war kurvenreich, aber es war windstill. Meine Gedanken kreisten um das Bild, das ich von Jean-Renés Telefonanruf im Kopf hatte: »Er wird Leistung bringen, ich verspreche es.« Meine Lunge brannte, aber weil ich unbedingt gut sein wollte, war ich beinahe sauer auf mich selbst, weil ich so litt. Ich verausgabte mich, trat immer härter – und selbst das war nicht genug. Ich forderte immer noch mehr von mir. Als ich am Limit war, stachelte ich mich dazu an, noch mehr aus mir herauszuholen. Die 35 Kilometer vergingen wie im Rausch. Ich konzentrierte mich auf einen Punkt in der Ferne und zwang jede Faser meines Körpers dazu, diesen Punkt so schnell wie möglich zu erreichen.
Begleitet vom ekstatischen Geschwätz des Sprechers schoss ich ins Ziel, aber sobald ich hinter der Linie keuchend zu Atem kam, wünschte ich mir, noch einmal von vorn beginnen zu können. Ich war sicher, dass es nicht gereicht hatte. Ich steuerte das Rad in Richtung Parkplatz und schaute mich nach Jacques um. Während der Schmerz der Anstrengung langsam meinem Körper entwich, sah ich den Wagen 50 Meter weiter in eine Parklücke brettern. Jacques sprang aus dem Auto und gestikulierte ganz aufgeregt in meine Richtung. Plötzlich begriff ich, dass sich die Mühe gelohnt hatte.
Ich kam neben dem Wagen zum Stehen, und Jacques fasste mich an den Schultern. »Fantastisch, Charly, fantastisch!« Er konnte seine Freude nicht verbergen; ich hatte die Bestzeit abgeliefert. Ich hatte Jean-Renés Versprechen eingelöst und den Zweitplatzierten um eine Minute und 20 Sekunden geschlagen, ein Riesenvorsprung über diese Distanz.
Auch auf der Rückfahrt war Jacques noch außer sich vor Freude. Es war, als hätte er soeben eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Ich glaube, er hatte über den Sieg hinaus etwas in meiner Fahrweise gesehen, mit dem ich es weit bringen könnte. Jacques verkörperte einen Teil der Radsporttradition, er gehörte zu der Art von soigneur, die sich aufgrund reiner Begeisterung und Hingabe für das métier einen gewaltigen Wissensschatz erworben hatten. Er kannte den Radsport und wusste, wie man Talente fördert. Er zügelte seine Euphorie und sprach sehr bedächtig zu mir: »Charly, das war ein vielversprechender Anfang. Du hast das Talent, aber du darfst es dir nicht zu Kopfe steigen lassen. Wenn du Profi werden willst, hast du noch einen langen Weg vor dir und du darfst nicht durchdrehen. Es ist ein harter Job. Es heißt, faire le métier, wenn du verstehst, was ich meine … Du musst sehr viel arbeiten, du musst sehr hart arbeiten und du darfst nicht abheben, aber das war ein schöner Anfang. Ein sehr schöner Anfang …«
Der GP des Nations war mein letztes Rennen des Jahres 1996 und bildete den Abschluss meiner ersten Erfahrungen auf dem europäischen Festland. Bevor ich mich auf den Rückweg nach England machte, teilte Jean-René mir mit, dass ich auch für die folgende Saison eingeladen und ein monatliches Gehalt von 4.000 Franc erhalten würde. Dass ich es auf Anhieb in eine der besten Amateurmannschaften in Frankreich geschafft hatte, empfand ich nicht als besonderen Erfolg, sondern als ganz natürlich. Das Geld war wie alles andere nur Mittel zum Zweck. 4.000 Franc waren damals ein ziemlicher Batzen für mich, bedeuteten aber nichts weiter, als dass ich zusammen mit den Preisgeldern, die ich im Laufe der Saison gewonnen hatte, genug hätte, um durch den Winter zu kommen, ohne arbeiten zu müssen. So würde ich mich voll und ganz auf das Training für das kommende Jahr konzentrieren können. Ich war erst 18 und auf einem guten Weg, aber nichts hätte mich auf meine erste richtige Saison bei den Männern vorbereiten können.
* * *
Im April 1997 stand ich an der Startlinie der Trophée des Grimpeurs und sah mich um. Nur wenige Monate zuvor war ich noch bei den Junioren gefahren, wenn auch ziemlich erfolgreich. Jetzt war ich von einigen der besten französischen Profis der damaligen Zeit umgeben, darunter der dreimalige Bergkönig der Tour de France Richard Virenque und seine Teamkollegen von Festina. Ich war wie gelähmt. Im Vorjahr war ich meinen Konkurrenten noch so überlegen gewesen, dass ich sie nach Belieben beherrschte, und hatte es großartig gefunden. In einem Rennen hatte ich mich zum letzten Erwachsenen umgedreht, der noch an meinem Hinterrad klebte, und hätte fast gelacht, als er mich anbettelte, »bitte langsamer zu fahren«, weil er unbedingt Zweiter werden wollte. Ich war sadistisch und grausam gewesen, aber nun war ich nicht mehr auf dem Kinderspielplatz und würde am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlte, wenn einem wehgetan wurde.
Dank seines Status als eines der besten Amateurteams in Frankreich erhielt Vendée U Einladungen zu zahlreichen Profirennen, bei denen zu jener Zeit auch Amateure zugelassen waren. Eins davon war die Trophée des Grimpeurs. Es mag nicht so bekannt sein, aber es war ein hartes Rennen, und ich war erst 18. Als wir am Start losfuhren, rollte ich mit und hoffte, dass die Kollegen es gemächlich angehen würden und ich mich so lange wie möglich im Feld verstecken könnte. Keine Chance. Das Rennen war nur 96 Kilometer lang und führte über einen Rundkurs in der Nähe von Paris, auf dem es buchstäblich einen Hügel rauf- und wieder runterging. Sobald es losging, hatte ich das Gefühl, in Treibsand zu versinken. Ein Fahrer nach dem anderen zog an mir vorbei, und so sehr ich mich auch abstrampelte, ich konnte das Tempo einfach nicht mitgehen. Ich schaffte es nicht mal, meine Position im Hauptfeld zu halten. Verzweifelt musste ich mitansehen, wie mich die Konkurrenz einfach stehen ließ. Noch bevor es zum ersten Mal in den Anstieg ging, wurde ein barbarisches Tempo angeschlagen – so etwas hatte ich nie zuvor erlebt. Ich hielt nicht mal eine Runde durch. Als ich ausstieg, schämte ich mich in Grund und Boden und stellte mich auf einen gewaltigen Anpfiff von Jean-René ein.
Ich fürchtete, dass er wütend und enttäuscht sein würde und dass das Team nun sähe, dass ich doch nicht so gut war, wie alle dachten. Komischerweise schien sich aber niemand an meiner jämmerlichen Vorstellung zu stören – zumindest nach außen hin. Meine Ergebnisse im Vorjahr hatten Bernaudeau von meinem Talent überzeugt. Vielleicht hielt er mehr von meinen Leistungen, als ich es selbst tat, oder vielleicht stellte ich einfach unrealistisch hohe Erwartungen an mich. Womöglich zog ich mich gar nicht so schlecht aus der Affäre. Wie auch immer, Jean-René stellte mich weiterhin in der ersten Mannschaft auf, und ich war weiterhin bei allen größeren Rennen dabei, an denen das Team teilnahm.
Nach der Trophée des Grimpeurs bestritten wir die Tour de Vaucluse in der Provence, wo die Anforderungen und das Leiden sich nochmals steigerten. In einem Etappenrennen ist man gezwungen, irgendwie durchzuhalten und sich die ganze Quälerei bis zum bitteren Ende und bis zum nächsten Tag anzutun – ganz einfach, weil es einen nächsten Tag gibt. Ich kam durchweg als Letzter ins Ziel. Sobald das Feld Ernst machte, wurde ich durchgereicht und fiel hinter das Peloton und die Begleitwagen zurück. Ich war vollkommen platt. Wenn ich morgens zum Frühstück ging, legte ich mich danach in der kurzen Pause bis zum Start noch einmal hin, weil ich dermaßen im Eimer war.
Es waren nicht nur die Anforderungen des Rennens, mit denen ich mich schwertat. Für meine Kollegen, die in der Regel sehr viel älter waren als ich, war ich nur einer dieser Ausländer, die es auf ihren Platz abgesehen hatten, und daher verdiente ich kein Mitleid. Auf einer Etappe der Tour de Vaucluse stand ich plötzlich im Wind, als das Feld in die Länge gezogen wurde. Ich versuchte verzweifelt, mich wieder einzureihen, aber selbst mein eigener Teamkollege Walter Bénéteau ließ mich nicht rein. Ich war fassungslos. Er hätte nur einen Tritt auslassen müssen, damit ich nicht bis ans Ende des Feldes durchgereicht würde, aber er sah mich nur an, schüttelte den Kopf und machte die Lücke wieder zu. Das enttäuschte mich damals und tut es auch heute noch. Ich glaube nicht, dass es an der Sprachbarriere lag oder das Problem kultureller Natur war oder mir der Sinn für den französischen Humor fehlte. Ich wollte Profi werden und sämtliche meiner Kollegen wollten es auch. Die Zahl der Plätze war begrenzt, und letztlich kämpften wir alle, jeder auf seine Weise, mit allen Mitteln darum. Derartige Konkurrenzkämpfe sind es, die über das Wohl und Wehe vieler Fahrer den Ausschlag geben. Sie zwingen einen dazu, entweder aufzugeben oder noch mehr aus sich herauszuholen.
Meine einzige Rettung war Aidan. Aidan lebte bereits seit zwei Jahren in Frankreich, als ich dort ankam. Er hatte ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht, und dieses Verständnis trug dazu bei, dass wir auf Anhieb prächtig miteinander auskamen.
Wir hatten nicht viel Geld und setzten uns in den Kopf, damit so lange wie möglich über die Runden zu kommen. Wir machten eine Art Wettbewerb daraus und verfielen auf immer neue Möglichkeiten, jeden Penny zu sparen. Das Spiel war für uns eine Art Erweiterung der Welt, als dessen Teil wir uns verstanden: Amateurfahrer waren dazu bestimmt, kein Geld zu haben, also setzten wir es uns in den Kopf, dementsprechend zu leben. Wir lachten darüber und machten uns einen Spaß daraus, aber jedes Mal, wenn wir den Wagen im Leerlauf bergab rollen ließen, um Sprit zu sparen, oder morgens zum Supermarkt fuhren, um das muffige Brot vom Vortag zu kaufen, grinste Aidan mich an und sagte: »Wir machen das, damit wir später Champagner trinken können.« Das Ganze wurde zu einer fixen Idee. Selbst die Gratiskekse in einem Campanile-Hotel abzugreifen, werteten wir als sagenhaften Coup. Wir kehrten mir aberwitzigen Mengen an Beute aus Hotels zurück, unsere Koffer bis zum Bersten gefüllt mit Toilettenpapierrollen, Seife, Zuckertütchen – alles, wovon man behaupten konnte, es würde die Haushaltskasse irgendwie entlasten (und die Sparfuchs-Erfolge des anderen übertreffen).
Zwar waren diese Eskapaden mit Aidan eine nette Ablenkung, aber mehr eben auch nicht. Mitte 1998, in meinem zweiten Amateurjahr bei Vendée U, reifte in mir die Gewissheit, dass sich etwas ändern musste. Ich hatte reichlich Prügel eingesteckt, war aber bei keinem einzigen Rennen dabei gewesen, bei dem ich mir ernsthafte Hoffnungen auf einen Sieg machen konnte. Ich war zunehmend frustriert. Zielstrebigkeit und Jugend bilden eine Kombination, die einen den Kummer bisweilen vergessen lässt. Wie man sich wirklich fühlt, wird einem erst klar, wenn man eines Tages die spontane Entscheidung trifft, alles über den Haufen zu werfen.
Ich zitterte beinahe, als ich an Jean-Renés Tür läutete. Ich zwang mich dazu, geradezustehen, bevor ich den Klingelknopf drückte. Als ich es tat, spürte ich den Adrenalinschub, der einen durchfährt, wenn es kein Zurück mehr gibt. Wenn man einen schwierigen Anruf hinter sich bringen muss, gibt es beim ersten Läuten immer diesen Bruchteil einer Sekunde, in dem das Herz rast und man sich sagt: »Noch kann ich auflegen.« Aber sobald ich die Klingel betätigte, wusste ich, dass ich von Jean-Renés Tür nicht einfach davonlaufen könnte. Ich musste die Sache durchziehen, komme, was da wolle.
Als die Tür entriegelt wurde, klopfte mir das Herz in der Brust. Jean-René war ein wenig überrascht, mich um neun Uhr morgens vor seiner Haustür anzutreffen. »Charly?«
»Jean-René, ich komme, um dir zu sagen, dass ich das Team verlasse. Ich gehe zurück nach England, sobald ich einen Flug organisiert habe. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, aber es ist an der Zeit, dass ich weiterziehe.«
Er sah aufrichtig erstaunt aus.
»Und die Tour de l’Avenir?«
Die Tour de l’Avenir im September war für das Team eines der größten und wichtigsten Rennen der Saison und nur noch drei Wochen entfernt. Meine Entscheidung aber war gefallen, und ich wusste, dass es kein Zurück gab und ich nicht mehr mit der Mannschaft weitermachen könnte. Es hatte mir so viel abverlangt, bis hierher zu kommen, dass ich fest entschlossen war, auf keinen Fall einen Rückzieher zu machen.
»Ich werde nicht für Vendée U dabei sein. Ich gehe. Es tut mir leid, aber das ist das Beste für meine Karriere.«
Es war getan. Jean-René akzeptierte meine Entscheidung, aber ich wusste, dass sein Stolz verletzt war. Fahrer verließen Vendée U nicht einfach aus eigenem Antrieb. Es war das beste Amateurteam in Frankreich, und Jean-René genoss in den Kreisen, in denen er verkehrte, großen Respekt. Er war ein Mann, der einem jungen Fahrer den Traum von der Profikarriere erfüllen konnte, und dementsprechend wurde er auch von den Leuten um ihn herum behandelt. Mein Schritt muss ihm ziemlich anmaßend erschienen sein, aber für mich ergab er Sinn.
Die Entscheidung war mir keineswegs leicht gefallen. Die Kehrseite meiner bornierten Zielstrebigkeit, die mich eine Menge Dreck erdulden ließ, war die fehlende Einsicht, dass man manchmal einen Schritt zurückmachen muss, um voranzukommen. So konnte es nicht weitergehen, und eines Tages, bei meiner Rückkehr aus einem Trainingslager, war das Maß voll. Wie sich abends herausstellte, war in meiner Abwesenheit etwas vorgefallen. Ich weiß bis heute nicht, was genau, aber offenbar war jemand in mein Zimmer eingebrochen, als er es verschlossen vorfand. An sich war das nur eine Lappalie und vielleicht belanglos, aber diese Verletzung meiner Privatsphäre ging mir gegen den Strich und sie war der Auslöser, den ich brauchte. Als ich entdeckte, was passiert war, war ich so sauer, dass ich einen fürchterlichen Wutanfall bekam. Ich werde Aidan ewig dafür dankbar sein, eingeschritten zu sein. Er hatte meine Unzufriedenheit schon gespürt, als ich noch blind dafür war. Er nutzte den Zwischenfall, um mich zu bestärken: »Du kannst jetzt nicht mehr zurück, du musst hier weg.« Das war genau, was ich gebraucht hatte.
Ich war nach Frankreich gegangen, weil es mir als die einzige Möglichkeit erschienen war, es zum Profi zu schaffen. Ich setzte eine lange Tradition britischer Radfahrer fort, indem ich den ganzen Mist in Frankreich auf mich nahm, auf einem Bett auf Ziegelsteinen schlief, in einem Haus voller Kakerlaken, und mich wieder und wieder vom System und den Leuten um mich herum verarschen ließ. Das alles konnte ich ertragen. Das Problem war, dass es mich überhaupt nicht weiterbrachte, in Frankreich zu fahren, und ich keine Gelegenheit erhielt, mich zu profilieren. Ich hatte das Gefühl, seit meinem Wechsel von den Junioren zu den Amateuren nur versagt zu haben. Ich hatte in meinem ersten Jahr in Frankreich elf Rennen gewonnen, aber seither war ich bei allen Wettkämpfen nur noch unter ferner liefen gelandet. Zum ersten Mal in meiner Karriere war mein Selbstvertrauen angekratzt. Ich fing schon bald an, alles um mich herum in Frage zu stellen. Nüchtern betrachtet verbrachte ich meine Zeit damit, gegen 35-jährige Amateure in Mavic-Cup-Rennen zu fahren oder in Rennen der Coupe de France gegen Profis anzutreten. Letztere waren viel zu schwer für mich und die erstgenannten, die typisch französischen Rennen, fanden auf flachen Straßen statt und waren eher etwas für Fahrer, die den ganzen Tag Tempo fahren konnten oder sich mit Kortison zudröhnten und grundsätzlich bis zum Anschlag bolzten. Welche Art Fahrer ich war, lag auf der Hand: Mit 60 Kilogramm, schmaler Figur und zierlichem Körperbau war ich zweifellos zum Klettern bestimmt. Weil ich kräftig war, konnte ich auch in der Ebene mithalten, aber in flachen, windgepeitschten Rennen war meine Physis ein großes Handicap.
Als ich mich mit dem Gedanken an eine mögliche Karriere als Profi auseinandersetzte, begann ich dies als Problem zu sehen. Man muss schlicht und ergreifend Siege vorweisen können, um ins Geschäft zu kommen. Damit sah es bei mir aber mager aus. In taktischer Hinsicht funktionierte Vendée U wie eine Profimannschaft, meine Dienste waren also vor allem in der Anfangsphase eines Rennens gefragt, mit dem Ausgang hatte ich aber nichts zu tun. Ich fing an, mir einzureden, dass ich einfach nicht gut genug sei, aber Jean-René verstand den Radsport und erkannte mein Talent. Was er nicht ahnen konnte, war, dass mir das nicht klar war. Ich war zunehmend ernüchtert über das, was ich tat. Ich fuhr die Rennen zu Ende, mehr aber auch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass es eh niemanden interessierte. Tatsächlich wurde ich ein immer besserer Fahrer, aber ich nahm die Fortschritte nicht wahr, und Jean-René hielt es nicht für nötig, mir dies zu erklären.
Nachdem ich meinen Frust herausgelassen und Aidan mich auf die eigentlichen Probleme gestoßen hatte, sah ich sehr klar, was ich zu tun hatte und was falsch lief. Von da an hielt ich es keinen weiteren Tag mehr dort aus. Mein Entschluss war gefasst. Ich verkaufte Aidan noch am gleichen Abend mein Auto und bereitete mich innerlich darauf vor, Jean-René gegenüberzutreten und mich für immer zu verabschieden.