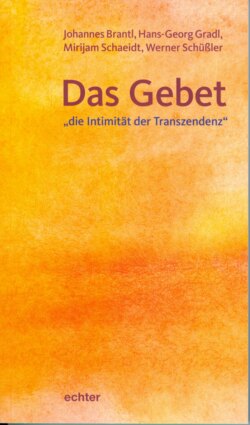Читать книгу Das Gebet - "die Intimität der Transzendenz" - Johannes Schelhas, Werner Schüßler - Страница 10
3. Erkenntnistheoretische Rahmenbedingungen sinnvollen Betens
ОглавлениеGebet ist nur da sinnvoll, wo Gott als Du gedacht wird, wo er ein personales Antlitz trägt. Emil Brunner hat das Gebet in diesem Sinne einmal als „Prüfstein des Glaubens“ und die Theologie des Gebetes als „Prüfstein aller Theologie“ bezeichnet.53 Denn „ob wir unter Gott einen Ich-Du-Gott verstehen oder ein namenloses Absolutes, entscheidet über die Christlichkeit einer Theologie“.54 Griechische Philosophie kennt dagegen den personalen Gott, der sich dem Menschen zuwendet, nicht. Der Gott Platons und Aristoteles’ ist kein personaler Gott; Personalität scheint ein Proprium des jüdisch-christlichen Gottes zu sein. Vielleicht sind Anklänge an Gottes Personalität bei Plotin festzustellen,55 aber sie sind hier nicht sonderlich ausgeprägt, und der Gedanke einer Zuwendung Gottes zur Welt ist Plotin zeitlebens fremd geblieben.
Nun hat aber Karl Jaspers zu Recht darauf hingewiesen, dass das Göttliche den Gegensatz von Subjekt und Objekt „umgreift“ und es darum auch als das Umgreifende, genauer: als „das Allumgreifende“ zu bezeichnen sei.56 Damit will er zum Ausdruck bringen, dass dieses kein Seiendes ist, das wir in der Welt vorfinden, sondern als Grund der Welt noch jenseits des Subjekt-Objekt-Gegensatzes anzusiedeln ist. Unter den Bedingungen der Existenz kommt der Mensch aber erkenntnismäßig niemals aus der Subjekt-Objekt-Spaltung heraus: Ich als Subjekt denke jemanden/etwas als Objekt.57 Wie aber kann man etwas denken oder über etwas sprechen, das im ontologischen, d.h. seinsmäßigen Sinne, an sich selbst nie Objekt ist?
Auch der Religionsphilosoph und protestantische Theologe Paul Tillich (1886-1965) kommt in einer Ontologie-Vorlesung aus dem Jahre 1951 auf dieses Problem zu sprechen, wenn es dort heißt: „Man macht ihn [sc. Gott] logisch zum Objekt. Wenn man ihn aber logisch zum Objekt macht, kann man nicht verhindern, dass man ihn auch ontologisch zum Objekt macht, [...] d.h. er wird ein Seiendes, dem ich als Subjekt gegenüberstehe, das mir als Objekt gegenübersteht. In dem Augenblick, wo das geschieht, liegt etwas vor, was zugleich wieder zurückgenommen werden muss.“58 Denn, so schreibt Tillich weiter, „Gott kann nie Objekt werden, weil er seinem Wesen nach das ist, was jenseits von Subjekt und Objekt liegt. Machen wir ihn doch zu einem Objekt, tun wir etwas, was seinem Wesen widerspricht, und müssen es im Augenblick, in dem wir das getan haben, wieder zurücknehmen.“59 Tillich sucht das mit einem Verweis auf die Liebe zu plausibilisieren, wo es sich ähnlich verhält: „Die Liebe kann nicht aufrechterhalten werden, die Liebe ist innerlich zerbrochen in dem Augenblick, wo der andere zum Objekt für mich wird. Ein Objekt kann ich behandeln, managen, kann ich so und so dirigieren, den Geliebten kann ich nicht so und so dirigieren, er ist etwas, mit dem ich Gemeinschaft haben kann oder von dem ich in Hass getrennt sein kann. Aber das ist eine völlig andere Haltung.“60 Mache ich den anderen dagegen zum (bloßen) Objekt, dann kommt darin zum Ausdruck, dass ich ihn eben gerade nicht liebe.
Zurück zum eigentlichen Thema: Zwar spreche ich beim Beten nicht über, sondern mit Gott, aber das Problem bleibt das gleiche. Das heißt, beim Beten tun wir eigentlich etwas, was vom Menschen her unmöglich ist: „Wir sprechen mit jemandem, der nicht irgendein anderer ist, sondern der uns näher ist, als wir uns selbst sind. Wir wenden uns an jemanden, der niemals Objekt unserer Hinwendung werden kann, weil er immer Subjekt ist, immer der Handelnde, immer der Schaffende. Wir sagen ihm etwas, obwohl er nicht nur schon weiß, was wir ihm sagen, sondern auch all die unbewußten Antriebe kennt, aus denen unsere bewußten Worte stammen.“61 So ist das Gebet eigentlich vom Menschen aus unmöglich. Aus diesem Grunde kommt Tillich zu dem paradoxen Satz: „Es ist Gott selbst, der durch uns betet, wenn wir zu ihm beten.“62 Das Gebet hat somit paradoxen Charakter, weil im Gebet zu jemandem gesprochen wird, mit dem man nicht sprechen kann, weil es kein Jemand ist. Im Gebet wird an Jemanden eine Bitte gerichtet, von dem man nichts erbitten kann, weil er gibt oder auch nicht gibt, ehe man ihn bittet. Im Gebet sagt man zu Jemandem „Du“, der dem Ich immer schon näher ist als dieses sich selbst.63
Beim ernsthaften Gebet darf Gott eben nicht „wie ein beliebiger Gesprächspartner“ behandelt werden, sondern das ernsthafte Gebet ist „ein Sprechen zu Gott in dem Sinne, daß Gott zwar logisches Objekt ist für den, der betet. Doch kann Gott niemals zum Objekt werden, es sei denn, daß er gleichzeitig Subjekt ist.“64 Theologisch kann man das dadurch ausdrücken, dass man sagt, dass der göttliche Geist, der den Betenden ergreift, Gott selbst ist. Von hieraus ist auch der folgende Satz Tillichs zu verstehen: „Gott spricht durch uns zu sich selbst.“65 Das bedeutet, dass Beten eigentlich eine „unmögliche Möglichkeit“ ist,66 da hier die Subjekt-Objekt-Struktur überwunden ist. Nach Tillich drückt der Hl. Paulus dieses Paradox in klassischer Weise aus, „wenn er von der menschlichen Unfähigkeit zum richtigen Beten spricht und vom göttlichen Geist sagt, daß er die Betenden vor Gott vertritt ‚mit unaussprechlichem Seufzen‘ (Röm. 8,26)“.67
Dass wir Gott Personalität zusprechen dürfen, wenn er auch nicht in dem Sinne Person ist, wie wir Personen sind, findet seinen letzten Grund darin, dass es eine Analogie zwischen Schöpfung und Schöpfer gibt. So wie das Kunstwerk immer schon einen Rückschluss auf den Künstler zulässt, so trifft das auch auf das Schöpferhandeln Gottes zu: Gott ist zwar nicht der Welt ähnlich, aber die Welt ist Gott ähnlich, wie es die mittelalterliche Philosophie und Theologie68 im Anschluss an Plotin vorgetragen hat, der diesen Grundgedanken erstmalig entwickelt hat; denn das Bewirkte kann nicht gänzlich verschieden sein vom Bewirkenden. Auf unser Problem angewandt, heißt dies: Wenn Gott Grund unseres Personseins ist, das sich wesentlich im Begriff der Freiheit dokumentiert, so kann er nicht weniger, sondern immer nur mehr sein als Person. Gott kann also nicht a-personal, sondern immer nur über-personal sein,69 und aus diesem Grunde dürfen wir ihn auch ansprechen als Person, als Du.
Von daher ist es verständlich, dass nicht nur vom Unveränderlichkeitsaxiom her immer wieder kritische Einwände gegen das Gebet, besonders gegen das Bittgebet, erhoben wurden, sondern auch ausgehend von einer Ablehnung der Personalität Gottes. Am Beispiel von Karl Jaspers könnte das näher verdeutlicht werden.70
Auf die Frage, warum überhaupt das Symbol des Personalen in Bezug auf Gott gebraucht werden muss, antwortet Tillich: „Das ‚Über-Persönliche‘ ist kein ‚Es‘, oder genauer, es ist ebenso ein ‚Er‘ wie ein ‚Es‘; und es steht gleichzeitig über beiden. Wenn aber das ‚Er‘-Element weggelassen wird, dann verwandelt das ‚Es‘-Element das angenommene Über-Persönliche in ein Unter-Persönliches [...]. Und solch ein neutrales ‚Unter-Persönliches‘ kann uns nicht in der Mitte unseres Personseins treffen [...]. Der Philosoph Schelling sagt: ‚Allein eine Person kann eine Person heilen.‘ Das ist der Grund, warum das Symbol des ‚persönlichen Gottes‘ für eine lebendige Religion unentbehrlich ist.“71
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) meint mit Blick auf Jaspers: „Jene Verschwisterung von Gottesliebe und Menschenliebe im Doppelgebot lenkte unseren Blick auf die Transparenz des endlichen Du, aber auch auf die Gnade des Unendlichen, zu erscheinen, wo und wie es erscheinen will. Nun soll uns das Du-sagen zur Gottheit als unrechtmäßig verwiesen werden. Gewiß ist der Philosoph unverbrüchlich befugt zu erklären, ‚philosophische Existenz‘ ertrage es, ‚dem verborgenen Gott nicht zu nahen‘. Er ist aber nicht befugt, das seiner Erfahrung also fremde Gebet als ‚fragwürdig‘ zu bezeichnen.“72
Sprechen wir vom personalen Gott, so impliziert dies also eine ganze Reihe philosophischer Voraussetzungen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Analogiegedanke, der besagt, dass die Welt Gott ähnlich ist. Es ist dann eine sekundäre Frage, welche Ausprägung des Analogiedenkens zu bevorzugen ist: die sog. Negative Theologie, die Analogielehre eines Thomas von Aquin oder die Symboltheorie Paul Tillich, um nur die wichtigsten Ausformungen zu nennen.73 Entscheidend ist hier zuerst einmal, dass das Verhältnis von Welt und Gott in Beziehung gedacht wird und nicht – wie bei Jaspers – in einseitiger Differenz.74