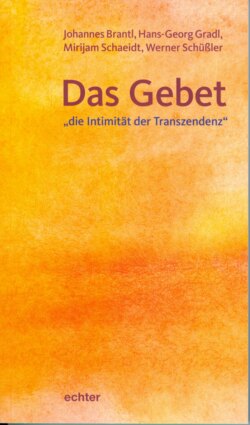Читать книгу Das Gebet - "die Intimität der Transzendenz" - Johannes Schelhas, Werner Schüßler - Страница 13
6. Resümee
ОглавлениеMit dieser mystischen Überhöhung des Gebets ist jede Mittel-Zweck-Relation in Bezug auf die Gebetsproblematik vollends überwunden. Aber es muss hier natürlich auch kritisch angemerkt werden, dass damit gleichzeitig auch das konkrete Element in den Hintergrund gerät, haben doch mystische Erfahrungen immer nur punktuelle Präsenz. Demgegenüber sind die „Materialisierungen“ des Bittgebets, in denen die konkrete Situation des Menschen in seiner Not an Gott herangetragen wird, mit der Hoffnung auf Erhörung im ganz vordergründigen Sinne, immer auch schon gerechtfertigt, wenn sie im Geiste des zitierten Vater-unser-Wortes „Dein Wille geschehe“ erfolgen.
Wenn ein Betender in der ganz konkreten Erhörung seiner Bitte die Erfüllung des Gebets sieht, so spricht sich hier religiöse Erfahrung aus, die man keinem absprechen sollte. Aber der Beter sollte sich auch der Tatsache bewusst sein, dass es sich hierbei um eine religiöse Deutungskategorie handelt und Ungläubige oder Unbetroffene eventuell andere Erklärungsmuster heranziehen würden, Wissenschaftler wohl darauf verweisen würden, dass es solche Phänomene nicht nur im religiösen Bereich gibt und es zum gegenwärtigen Stand der Forschung einfach noch nicht möglich sei, diese Dinge „wissenschaftlich“ zu erklären, was aber nicht unbedingt eine prinzipielle Grenze impliziert, wir es also hier nicht notwendig mit „Unerklärlichem“ zu tun haben. Das heißt nun aber nicht, dass sich die Deutung des Beters nur auf der Seite der Subjektivität abspielte, wobei mit einem Verweis auf die Objektivität eines solchen Geschehens – wie dargelegt – kaum etwas gewonnen wäre. Wenn eine Gebetserhörung aber keine historische oder empirische Angelegenheit ist, was ist sie dann?
Ich würde sagen, dass solche Ereignisse weder allein der subjektiven Seite, noch allein der objektiven Seite zuzurechnen sind, sondern dort anzusiedeln sind, was Martin Buber im Zusammenhang seiner personalistischen Philosophie als den Bereich des „Zwischen“ oder Karl Jaspers als die „Unlösbarkeit von Subjektivität und Objektivität“ bezeichnet hat.101 Ein Vergleich mit der Liebe, auf den ich oben im Zusammenhang mit der Gottes-Rede schon einmal eingegangen bin, kann auch hier verdeutlichen, was gemeint ist: Die Liebe haftet ja nicht dem Ich an, als ob sie das Du „nur zum ‚Inhalt‘, zum Gegenstand hätte“ sondern „sie ist zwischen Ich und Du“.102
Damit ist immer auch schon ein weiterer Aspekt verbunden: dass nämlich Glaube und Zweifel prinzipiell zusammengehören und nicht zu trennen sind.103 Wenn wir das bedenken, dann wird sich so manches Problem als „Scheinproblem“ entlarven. Auf unser Problem angewandt heißt dies, dass ich nie zweifelsfrei erkennen oder wissen kann, ob mein Beten geholfen hat, selbst wenn meine religiöse Erfahrung mir das sagen mag, also selbst wenn ich darüber eine religiöse Gewissheit besitze. Eine solche Einsicht macht zuerst einmal bescheiden. Um noch einmal den Vergleich mit der Liebe heranzuziehen: Das Entscheidende ist ja hier, dass wir lieben, nicht dass wir geliebt werden. Und diese Liebe wird sowohl denjenigen, der liebt, als auch denjenigen, der geliebt wird, verändern. Ähnlich ist es auch beim Beten: Beten verändert den Menschen immer – wenn er „richtig“ betet; es verändert nämlich sein Verhältnis zu Gott, und darauf kommt es wesentlich an. Und wenn Beten, wie gesagt, dazu führt, dass unser Verhältnis zu Gott intensiviert wird, dann ist unser Gebet immer schon erhört, selbst wenn die an Gott herangetragene Bitte nicht erfüllt ist. In diesem Sinne kann man also die Frage „Hilft beten?“ mit Ja beantworten. Aber dieses Ja ist erst möglich, nachdem die philosophische Erhellung viele mögliche Missverständnisse aus dem Weg geräumt hat. Und dieses Ja ist kein eindeutiges Ja im Sinne einer Mittel-Zweck-Relation, sondern ein dialektisches oder paradoxes Ja.
Nur Fundamentalisten und naive Biblizisten werden die Frage der Gebetserhörung eindimensional sehen und im Falle, dass ein Gebet nicht erhört wird, das womöglich noch dem Beter selbst anlasten. Ein richtiges Gebetsverständnis ist aber von einer solchen Deutung weit entfernt, denn es lässt Gott Gott sein, das heißt, es verrechnet Gott nicht kalkulatorisch, verzweckt ihn nie.104 Gott bleibt letztlich Mysterium, genauerhin mysterium tremendum et fascinosum, wie Rudolf Otto es ausgedrückt hat.105 In dieser Kontrastharmonie von Erschrecken und Anziehung bewegt sich das religiöse Leben. Und diese Spannung gilt es auszuhalten, auch in Bezug auf die Gebetsproblematik. Das erinnert in gewisser Weise auch an die Situation Hiobs.106 Paul Ricœur (1913-2005) sieht die entscheidende Einsicht des Hiobbuches bekanntlich im „völligen Verzicht auf die Klage“,107 und dieser Standpunkt leuchtet am Ende des Hiobbuchs auf, wenn es dort heißt, „dass es Hiob gelungen sei, Gott ohne Grund zu lieben“.108
Nach diesem Durchgang durch das Dickicht philosophischer Fragen und Probleme sind wir zwar wieder dort angelangt, wo wir unseren Ausgang genommen haben, aber unser Blick hat sich durch die philosophische Vertiefung geweitet. Beten, so können wir jetzt – gegen Kant – formulieren, ist kein abergläubischer Wahn, sondern der Grundakt des Glaubens, der Gott gegenwärtig macht. Als Akt des menschlichen Geistes ist das Gebet aber flüchtig. „Es ist eine momentane, instantane Zuwendung zu Gott“, schreibt Frankl ganz in diesem Sinne. „Aber so, wie ein Kristall selber Kristallisationspunkt wird, an dem sich immer wieder neue Kristalle apponieren, so kristallisiert sich aus dem Akt des Betens das Symbol aus. Das Gebet vergeht – das Symbol bleibt bestehen, und am Symbol kann sich der Akt der Präsentation Gottes immer wieder erneuern und verjüngen. Was das Gebet leistet, das ist die Intimität der Transzendenz; was das Symbol meistert, das ist die Vergänglichkeit der Vergegenwärtigung.“109 Zum Begriff des religiösen Symbols wäre sicherlich viel zu sagen, aber das wäre ein eigenes Thema.110