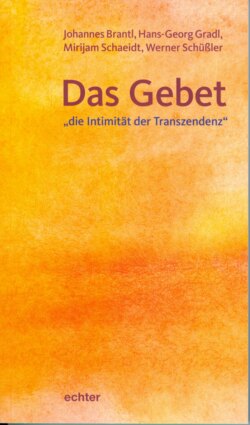Читать книгу Das Gebet - "die Intimität der Transzendenz" - Johannes Schelhas, Werner Schüßler - Страница 9
2. Metaphysische Rahmenbedingungen sinnvollen Betens
ОглавлениеDie Problematik des Bittgebets steht im größeren Kontext der Frage nach dem Handeln Gottes und damit verbunden der Frage nach dem Verhältnis von göttlicher Vorsehung und menschlicher Freiheit. Verschiedene Autoren sehen die Gebetsproblematik zudem auch eng mit dem sog. Theodizeeproblem oder der Hiobfrage verwoben.28 Bei dieser Frage geht es um das prinzipielle Problem, wie die Vorstellung eines allgütigen und allmächtigen Gottes mit der Erfahrung von Bösem und Leid in der Welt zu vereinbaren ist. Angewandt auf die Gebetsproblematik geht es dann um die Frage, warum Gott die Bitten der einen erhört, die der anderen aber nicht? Ich halte diese Fragestellung aber nicht für sonderlich spezifisch für das Gebet, stellt sie sich doch in einem größeren Kontext, wenn sie sich auch in Bezug auf das Bittgebet noch einmal verschärfen mag bzw. hier drastisch vor Augen geführt wird. Das Theodizeeproblem stellt sich ja schon, wenn – um mit Dostojewski zu sprechen – ein einziges unschuldiges Kind sterben muss, oder, um mit Max Scheler zu sprechen, wenn wir versehentlich einen Wurm zertreten.29
Nun haben die Überlegungen zum Handeln Gottes über die Jahrhunderte hinweg ganze Bibliotheken gefüllt, und ich kann im Rahmen dieser Überlegungen darum nicht in extenso auf diese Fragestellung eingehen, die theologisch auch recht kontrovers diskutiert wird. Aber da das zitierte Kant-Wort im Kontext dieser Fragestellung steht, muss hierauf doch kurz eingegangen werden, was ich im Anschluss an ein Wort von Meister Eckhart, dem großen mittelalterlichen Mystiker, tun werde. Doch zuvor noch einige grundsätzliche Überlegungen.
Wie ich Gott denke, das hat entscheidende Konsequenzen für das Gebetsverständnis. Die klassische Metaphysik und Theologie haben immer die Absolutheit Gottes betont, das heißt, sie haben einen „werdenden Gott“ abgelehnt mit dem Argument, dass ein solcher nicht der Grund der Welt sein kann, deren Charakteristikum ja gerade das Werden, d.h. die Veränderung ist. Nur ein Gott, der absolut vollkommen ist, der somit keine Potentialitäten aufweist, sondern reine Aktualität, actus purus, ist, kann wirklich Gott sein, ansonsten wäre er selbst ein Stück Welt. Auf die Gebetsproblematik angewandt, heißt dies – um mit Ludger Oeing-Hanhoff zu sprechen: „Kann man sich mit Bittgebeten an einen Gott wenden, der nicht allmächtig ist, der keine Wunder wirken kann? Andererseits fragt es sich aber auch, ob man sinnvoll zu einem Gott beten kann, der schon alles vorherbestimmt hat und in seiner Ewigkeit und Unveränderlichkeit als der ‚unbewegte Beweger‘ doch durch nichts zu bewegen ist.“30
Das Wort von der Unveränderlichkeit wird nicht selten von Theologen missverstanden – als würde es sich hierbei um einen „statischen“, letztlich „apathischen“ Gott handeln, der von dem „dynamischen“ Gott der Bibel weit entfernt sei.31 Dabei hat Aristoteles, auf den der Begriff sachlich zurückgeht, schon ausdrücklich gesagt, dass der „unbewegte Beweger“ reine Lebensfülle impliziert.32
Es finden sich aber auch Stimmen auf philosophischer Seite, die als Voraussetzung der Sinnhaftigkeit des Bittgebets ein Gottesbild vertreten, das sich von der Lehre der Unveränderlichkeit verabschiedet. In diesem Sinne können wir in der Schrift des Utrechter Religionsphilosophen Vincent Brümmer „Was tun wir, wenn wir beten? Eine philosophische Untersuchung“ lesen: „Wenn seine [sc. Gottes] Absichten von Ewigkeit an unveränderlich festgesetzt sind, dann wäre er weder in der Lage, auf das, was wir tun oder fühlen, zu reagieren, noch auf die Bitten, die wir an ihn richten. Man könnte von ihm nicht sagen, daß er irgend etwas tut, weil wir ihn darum gebeten haben. In der Tat wäre ein absolut unwandelbarer Gott einem neuplatonischen Absoluten ähnlicher als dem personalen Wesen, als das ihn die Bibel darstellt, und deshalb nicht die Art von Wesen, mit dem wir ein personales Verhältnis haben könnten.“33 Brümmer plädiert demgegenüber dafür, Gott „in einem weniger absoluten Sinn für unwandelbar“34 zu halten: „Gott ist in einigen Hinsichten unveränderlich – in seiner Güte, in seiner Liebe und in seiner Treue –, aber er verändert sich in anderen Hinsichten. Wenn Gott sich in keiner Hinsicht verändern könnte, wäre er keine Person.“35 Brümmer koppelt also die Veränderlichkeit Gottes an sein Personsein: Gott kann sich nach Brümmer verändern, „z.B. indem er wirklich auf kontingente Ereignisse und menschliche Handlungen reagiert“.36 Lassen wir momentan die Frage einmal beiseite, wie Gottes Personsein zu denken ist und ob dieses Personsein notwendig Veränderlichkeit impliziert. Zieht eine solche Konzeption, wie sie Brümmer vorschlägt, Gott nicht in die Dimension der Zeitlichkeit, damit verbunden aber in die der Endlichkeit? Schließen sich Gottes Unveränderlichkeit auf der einen und sein vom Beter erwartetes Reagieren auf der anderen Seite wirklich aus? Die klassische Tradition hat dies jedenfalls nicht so gesehen. Sie hat sowohl an der Unveränderlichkeit Gottes als auch an der Sinnhaftigkeit des Bittgebetes festgehalten. Es muss also nach Lösungen gesucht werden, die an der Unveränderlichkeit Gottes festhalten, gleichzeitig aber auch die Sinnhaftigkeit des Bittgebets37 erweisen können. Die Frage: Wie ist Gott zu denken, damit das Bittgebet sich als sinnvoll erweist, ist darum schon als solche falsch gestellt. Vielmehr muss gefragt werden: Wie kann das Bittgebet sinnvoll sein unter Voraussetzung der Unveränderlichkeit Gottes?
In seinem deutschen Traktat „Von Abgeschiedenheit“ erörtert Meister Eckhart (1260-1328) in sehr plastischer Weise genau dieses Problem.38 Es geht hier um die Frage: Hätte das Bittgebet keine Wirkung auf Gott, dann hätte es letztlich keine Realität, wäre höchstens so etwas wie ein inneres reflektierendes Umgehen mit sich selbst, wie das z.B. bei der Gebetsauffassung von Walter Bernet der Fall ist, der das Bittgebet psychologisch-immanent interpretiert.39 Wirkt das Bittgebet dagegen auf Gott, wie geht das mit der Unveränderlichkeit Gottes zusammen? Hat dann nicht Kant doch Recht mit seiner Kritik?
Eckhart geht dieses Problem grundsätzlicher an, nämlich von der Frage aus, was Gott zu Gott macht. „Daß Gott Gott ist,“ heißt es hier, „das hat er von seiner unbeweglichen Abgeschiedenheit, und von der Abgeschiedenheit hat er seine Lauterkeit und seine Einfaltigkeit und seine Unwandelbarkeit.“40 Für unseren Zusammenhang interessiert ganz besonders das letzte Merkmal Gottes: seine Unwandelbarkeit.
Nun gesteht Eckhart ohne weiteres zu, dass alle Gebete und guten Werke, die der Mensch im Zeitlichen verrichten kann, Gottes Abgeschiedenheit so wenig bewegen, als ob niemals ein Gebet oder gutes Werk in der Zeit verrichtet würde, und es heißt dann weiter: „Und Gott wird deshalb nimmer gnädiger noch geneigter gegenüber dem Menschen, als wenn er das Gebet oder die guten Werke niemals verrichtete.“41
Aber macht diese „unbewegliche Abgeschiedenheit“ das Gebet nicht sinnlos? Eckhart macht sich diesen Einwand selbst: „Nun könntest du sagen: So höre ich wohl, daß alles Gebet und alle guten Werke verloren sind, weil sich Gott ihrer nicht so annimmt, daß ihn jemand dadurch bewegen könnte, und doch sagt man: Gott will um alles gebeten werden.“42 Wie passt das zusammen?
„Hier sollst du mich wohl anhören“, sagt Eckhart, „und recht verstehen, wenn du kannst, daß Gott in seinem ersten ewigen Anblick – wenn wir einen ersten Anblick da annehmen sollten – alle Dinge ansah, so wie sie geschehen würden, und er sah in diesem selben Anblick [...] das geringste Gebet und gute Werk, das jemand verrichten würde, und sah an, welches Gebet und welche andächtige Hingabe er erhören wollte oder sollte; er sah, daß du ihn morgen mit Ernst anrufen und bitten willst, und dieses Anrufen und Gebet wird Gott nicht erst morgen erhören, denn er hat es bereits in seiner Ewigkeit erhört, ehe du je Mensch wurdest. Ist aber dein Gebet nicht eindringlich und ohne Ernst, so wird dich Gott nicht erst jetzt abweisen, denn er hat dich ja schon in seiner Ewigkeit abgewiesen. Und so denn hat Gott in seinem ersten ewigen Anblick alles angesehen, und Gott wirkt nichts neu [d.h. er wirkt nichts auf Veranlassung], denn alles ist vorausgewirkt. Und so steht Gott allzeit in seiner unbeweglichen Abgeschiedenheit, und doch sind darum der Leute Gebet und gute Werke nicht verloren.“43
Gott, der unveränderliche und vollkommene, wäre nicht Gott, wenn er seinen Ratschluss, der von Ewigkeit her besteht,44 aufgrund unserer Bitten ändern würde. Gott sieht nach Eckhart von Ewigkeit her, was der einzelne Mensch frei wählen wird; und im Hinblick auf diesen freien Willensentschluss und die freigewollten Handlungen des Menschen – besonders mit Rücksicht auf dessen Gebet – fasst Gott dann seine unabänderlichen Ratschlüsse.45 Es geht hier um den spekulativen Versuch, die metaphysische Möglichkeit der Gebetserhörung zu erweisen. Das Gebet steht bei Eckhart im Rahmen der Vorsehung. Wirksam erbitten kann der Mensch nur das, was in Gottes ewigem Ratschluss bereits als Gebetserhörung vorgesehen ist. Das Gebet bedeutet somit weder ein veränderndes Eingreifen noch ein rein passives Sich-Fügen in den göttlichen Plan, sondern es ist eine „miterfüllende Kraft“ in der Entfaltung und Ausführung der göttlichen Pläne.46 Hier denkt Eckhart ganz im Sinne des Thomas von Aquin. Auch Thomas wehrt von dem Gedanken der Unveränderlichkeit Gottes her jede Überlegung ab, die dem Bittgebet irgendwelche kausale Wirkmöglichkeiten auf Gott zuzuschreiben sucht.47 „Gott kann und braucht nicht an etwas erinnert oder über etwas in Kenntnis gesetzt zu werden.“48 Und doch wird gleichzeitig an der Wirksamkeit der Bitte festgehalten.49 Der Vorwurf, dass dann der Weltverlauf letztlich determiniert sei, greift zu kurz, denn Gottes Vorsehung ist nicht im Sinne eines zeitlichen Vorhersehens zu verstehen, sondern als ein gegenwärtiges Sehen, das daher in keiner Weise determiniert.50 Providentia darf nicht im Sinne von Praevidentia oder Praescientia, nicht als ein Vorauswissen gleichsam der Zukunft, aufgefasst werden, sondern als das Wissen einer niemals erlöschenden Gegenwart. Spätestens seit Boethius (480-524) ist dieser Einwand aus dem Wege geräumt.51 Mit diesem Ansatz wird die Unveränderlichkeit Gottes einerseits und die menschliche Freiheit einschließlich eines sinnvollen Bittgebetes andererseits als einander nicht widersprechend dargestellt.52