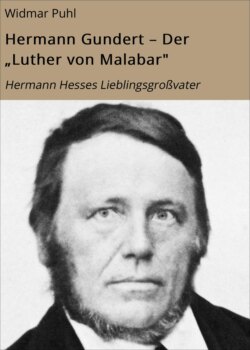Читать книгу Hermann Gundert – Der "Luther von Malabar" - Widmar Puhl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Umfeld: Armut, Frömmigkeit, Bildungsstreben
ОглавлениеWilhelm Gundert, ein zeitgenössischen Nachfahre Hermann Gunderts und Autor einer „Geschichte der deutschen Bibelgesellschaften im 19. Jahrhundert“, schrieb zum 175. Geburtstag der Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt: „Die Britische und Ausländische Bibelanstalt ernannte zu ihrem Auslandssekretär den Pfarrer an der deutschen lutherischen Savoykirche in London, Carl Friedrich Adolph Steinkopf. Er war Schwabe und hatte zur gleichen Zeit wie Hegel, Hölderlin und Schelling im Stift und an der Universität Tübingen studiert. Nach dem Studium war er aber nicht in den württembergischen Kirchendienst eingetreten, sondern als Sekretär der Deutschen Christentumsgesellschaft nach Basel gegangen. In dieser Eigenschaft kam Steinkopf ab 1804 viel unter den Ablegern dieser Gesellschaft in ganz Europa herum – auch nach Stuttgart“.
Am 11. September 1812 fand dort im Haus des Kaufmanns Lotter am Markt, nur einen Steinwurf von Gunderts Elternhaus entfernt, eine Versammlung statt, auf der die Gründung der Bibelgesellschaft beschlossen wurde. Teilnehmer waren Christoph Matthäus Daniel Hahn, der Korrespondent der Christentumsgesellschaft am Ort, die angesehenen Kaufleute Heinrich und Ludwig Lotter sowie der Pfarrer und Erweckungsprediger Christian Adam Dann. Steinkopf brachte als Starthilfe das Abgebot mit, 200 Pfund, 600 Bibeln und 50 Ausgaben des Neuen Testaments zu stiften. 200 Pfund waren damals eine stattliche Summe – Steinkopfs Jahresghalt als Pfarrer in London betrug 150. Vier Tage später war die Grundungsversammlung.
Der erste Präsident der neuen „Bibelgesellschaft für die ärmeren Volksklassen in dem protestantischen Teil des Königreichs Württenberg“ war Gottlob Heinrich Rieger, Dekan der evangelischen Landeskirche in Stuttgart. Nebenamtliche Sekretäre wurden die Kaufleute Christian Heinrich Enßlin, Ludwig Gundert und Heinrich Lotter. Auch der Staatsminister Johann Carl Christoph Graf von Seckendorf war Gründungsmitglied. Wilhelm Gundert bemerkt, dass dies wichtig war, „denn in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts, als Vereinigungen von Bürgern noch nahezu unbekannt waren, wirkte die Mitliedschaft eines Ministers für die Obrigkeit als Garantie des Wohlverhaltens einer Vereinigung“.
1831 schrieb der besorgte Vater seinem Sohn Hermann ins vorrevolutionär erregte Maulbronn: „Uns aber gilt das Wort: Seid unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, also der republikanischen wie der monarchischen. Der Christ sagt dazu Ja und Amen; denn sein Reich ist nicht von dieser Welt, und das ist seine Freiheit“. Eben dieser Untertanengeist aber hat bei Hermann Gundert nie so ganz funktioniert. Es war ein Denken, das auch Hermann Hesses Vater Johannes Hesse seinen Eintritt in die Basler Mission mit den Worten begründen ließ: „Ich sehne mich nach einem Korporationsleben, überhaupt nach einem großen Ganzen, dem ich als dienendes Glied aus Überzeugung und Pflicht mich unterordnen kann, um zur Erreichung des großen Ziels mitzuwirken oder wenigstens mitzustreben. Eine solche Korporation scheint mir: die Missionsgesellschaft“. Unter den Freunden Gunderts in Maulbronn waren aber der spätere Philosophieprofessor Eduard Zeller, der Schriftsteller Hermann Kurz sowie Gottlob Fink, der als früher Sozialdemokrat bekannt wurde. Und die haben gewiss nicht zu allem Ja und Amen gesagt, was von der Obrigkeit kam.
Und sind die Motive auch politisch oder weltanschaulich betrachtet eher konservativ, so dürfen doch die Folgen der Bibelarbeit als geradezu revolutionär gelten. Wenn Wissen, wie Friedrich Nietzsche schrieb, Macht ist, dann war schon Luthers Übersetzung der Bibel ins Deutsche revolutionär. Ganz ähnlich musste die Bibelanstalt wirken, deren Zweck es war, die Bibel in der lutherischen Übersetzung ohne alle Anmerkungen – außer Parallelstellen - „also zu verbreiten, dass sie auch in des Ärmsten Händen sey“.
Die historische Emanzipation des Bürgertums und die Aufklärung wären ohne solche christlichen Antriebe undenkbar. Ein Luther, der die göttliche Offenbarung der Bibel unmittelbar in die Hände der einfachen Leute gab, indem er sie ihnen sprachlich erschloss, ein Bildungsideal, das mit Lesen und Schreiben eben deswegen untrennbar verknüpft ist: Das sind Anstöße zum selbständigen Denken. Lesen und Schreiben zu können, sind die elementaren Voraussetzungen zur Unabhängigkeit des Geistes. Wer die Bibel liest, kann alles lesen. Was das bedeutet, wird spätestens klar, wenn man sieht, wie manipulierbar die Menschen in Ländern der Dritten Welt sind, wo Diktatoren und Putschisten die öffentliche Meinung durch Rundfunk und Fernsehen total im Griff haben. Vor allem, wenn es dort viele Analphabeten gibt.
Johannes Hesse schreibt über das Haus des Großvaters Gundert: „Äußerlich ging es sehr bedrückt zu im Hause des Schullehrers, und der kleine Ludwig hatte nicht gerade das, was man eine fröhliche Jugend nennt. Der Vater sparte die Rute nicht, die Mutter war jahrelang krank, das Einkommen sehr gering. Das Abendessen bestand aus einem Tee, zu dem die Kinder selbst die Kräuter auf Wiesen und Rainen suchen mussten; dazu kam ein wenig Milch“. Hermann Gunderts Jugend im Hause von Vater Ludwig, dem „Bibel-Gundert“, sah streckenweise gar nicht so viel anders aus. Was am Essen fehlte, mussten das Lesen in der Bibel, das Psalmensingen und andere religiöse Übungen ersetzen. Geld war besonders knapp nach dem Niedergang des Kolonialwarengeschäfts, und als Sekretär der Bibelanstalt verdiente der Vater auch kein Vermögen.
Die Armut und die Frömmigkeit verhinderten keineswegs ein Bildungsstreben, das den breiten Massen zugute kam. König Friedrich I. Von Württemberg genehmigte die Errichtung der Anstalt, die der Königlichen Oberstudiendirektion unterstellt wurde, einer Vorläufer-Einrichtung des Kultusministeriums. Wilhelm Gundert berichtet: „Sie ernannte eine „Administrationsbehörde“ aus sechs Personen, die die Gründer vorschlagen durften. Diese unterstand der Königl. Oberstudiendirektion. In späteren Jahren wurde daraus der Verwaltungsrat, der ein Organ der Bibelantalt, nicht des Kultusministeriums war“. Das bedeutet eine Art von Selbstverwaltung nach dem Subsidiaritätsprinzip, deren Modernität auch heute Erstaunen hervorruft.
Es fällt auf, wie sehr diese Konstruktion der Regelung ähnelt, die der Staat (erst das Königreich Württemberg und später das Land Baden-Württemberg) für die Verwaltung der säkularisierten Kirchengüter und für die Ausbilung des Theologennachwuchses getroffen hat: die staatlichen „Evangelisch-theologischen Seminare“ von 1806 leben ebenso wie die Seminar-Stiftung von 1928 ganz im Geist der Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Dass daraus auch Spannungen entstehen, muss man nicht eigens betonen. Im Zusammenhang mit den Stichworten „Maulbronn“ und „Tübingen“ wird noch davon die Rede sein.
Hermann Gundert wuchs in einem Umfeld auf, wo nicht nur die Armut, sondern auch die Frömmigkeit und die beschriebenen Formen des privaten, kirchlichen und staatlichen Bildungsstrebens ganz normal und alltäglich waren. In den Hungerjahren 1816 und 1817 kostete eine Bibel etwa so viel wie zehn Laibe Brot – der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Immerhin waren bei Missernten damals praktisch alle Bevölkerungsschichten existenziell getroffen, auch die Familie Gundert. Die Bibelanstalt machte wenigstens die geistige Nahrung, das Buch der Bücher, erschwinglich. So wurde Gundert zu einem Repräsentanten jener Frömmigkeit, die sich historisch zugleich als Fundament einer bürgerlichen Emanzipation bewährt hat. Die Bildungsideale des Christentums haben sich in diesem Zusammenhang gewiss auch im weltlichen Sinne als Motor für den Fortschritt der Menschheit erwiesen. Zunächst einmal aber wollte Hermann Gundert nicht Pfarrer werden, sondern Soldat. Er lernte gut, besaß jedoch noch nicht den Blick für die religiösen Wurzeln dieses Bildungsdranges. Wo er darauf stieß, rieb er sich sogar zeitweilig daran.
Johannes Hesse schreibt über das Verhalten der Brüder Hermann und Ludwig Gundert im Sommer 1826: „Die Mutter weilte damals mit der kranken Marie zur Erholung in Korntal (Anm. des Autors: in der pietistischen Brüdergemeinde), wo Ludwig und Hermann sie öfters besuchen durften. Aber eben diese Besuche, welche meist am Sonntag gemacht wuerden, übten einen sonderbaren Einfluss auf sie aus. Während sie der Mutter und Schwester von ganzem Herzen zugetan waren, ärgerten sie sich über jeden Kirchenbesuch, über jedes Gespräch der „Brüder“ und über so vieles Einzelne, was sie vom Pietistenleben vernahmen. Wenn sie, durch den Wald herübergejagt, mit Raupen, Schmetterlingen und Schlangen beladen, auf der Korntaler Höhe angelangt waren, wünschten sie oft Blitze und Kanonen herbei, das »verwünschte Nest» auszutilgen“.
Wohlverhalten – das war auch, zumindest vordergründig, das wichtigste Erziehungsideal in der Familie Gundert. Als die Brüder sich darüber entrüsteten, dass die Eltern als Pietisten galten, schrieb Mutter Christiane an Vater Ludwig: „Gebe Gott, dass beide wohl leben mögen . Immer bin ich in Sorgen, ob sie keine Ausschweifungen im Zorn oder Leichtsinn begehen und den Kummer ihrer Eltern vermehren helfen. Bitte sie in der Mutter Namen, ihr niedergebeugtes Herz nicht noch mehr zu verwunden; ihr Wohlverhalten ist doch das einzige Stärkungsmittel für mein betrübtes Herz“. Heutige Psychologen würden da wohl von emotionaler Erpressung sprechen; aber damals war das eben so.