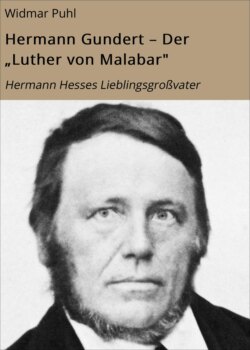Читать книгу Hermann Gundert – Der "Luther von Malabar" - Widmar Puhl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Flucht aus der Enge: Maulbronn und Tübingen
ОглавлениеSeit 1556 gibt es für Württemberg einen geradezu klassischen Weg für begabte Söhne aus armen Familien, Karriere zu machen: Die säkularisiderten Klöster Maulbronn und Blaubeuren wurden in Klosterschulen umgewandelt, in denen die evangelische Landeskirche den Nachwuchs an Pfarrern und Lehrern heranbildet. Dazu wurden die 12-14jährigen Jungen „aus ehrbaren christlichen Familien“ aufgenommen, wenn sie sich in der Landeshauptstadt Stuttgart mit Erfolg dem strengen „Landexamen“ unterzogen hatten. Die Glücklichen, die bestehen, erhalten bis heute aus den Einnahmen der in einen sogenannten „Kirchenkasten“ eingezogenen Kirchengüter ein Stipendium für kostenlosen Schulbesuch, Verpflegung und Unterkunft. Besondere Betonung liegt beim Landesamen auf den Fächern Latein und Religion, denn die unveränderten Schwerpunkte der Ausbildung im Seminar heißen dann auch alte Sprachen, Religion und Kirchenmusik.
Hermann bestand das Examen und trat 1827 in das Klosterseminar Maulbronn ein, um sich auf das Theologiestudium vorzubereiten. Er hatte erlebt, wie der Vater sein Tagebuch konfiszierte. Er hatte erlebt, wie der Vater selbst einen Besuch der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ aus rein musikalischem Interesse (Hermann hatte die Partitur abgeschrieben und wollte die Musik hören) nur missbilligend hinnahm, weil ihm alles, was mit dem Theater zu tun hatte, als Sünde galt. Er hatte einen großen Schreck bekommen, als der Vater wegen geheimer pietistischer Umtriebe von der Polizei vorgeladen wurde und eines seiner Traktate nicht mehr verbreiten durfte, weil es den Lesern allzuviel Teufels- und Höllenangst zumutete. Er hatte unter dem Eindruck gelitten, dass seine Eltern jeden kleinen Unfall, jede Krankheit, jeden Schicksalsschlag und jeden Todesfall in der Familie immer und konsequent als Prüfung oder Strafe eines strengen Gottes gedeutet hatten. Und er hatte sich diesem Einfluss nicht oder nur begrenzt entziehen können. Schon in der Schülerseele lagen Anfälle absoluter Frömmigkeit mit Ausbruchsversuchen im Widerstreit, etwa 1824, als Hermann in einen neugegründeten Turnverein eintreten wollte und der Vater dies verbot. Und nun kam er in die Atmosphäre einer Bildungsstätte, in der Aufklärung und Wissenschaft, Geschichte und mönchische, also unprotestantische Tradition mit Händen zu greifen waren.
Aus Kloster und Stift Maulbronn waren Dichter und Philosophen hervorgegangen, Staatsmänner und Beamte, Schauspieler und Redakteure, ja sogar Revolutionäre. Keime der Veränderung lagen in der Maulbronner Luft. Der Unterschied zu Hermanns bisheriger Umgebung kam zusammen mit der natürlichen Unruhe der Pubertät. Schon als Gymnasiast hatte Hermann wie ein Wilder zu lesen begonnen und vor allem Romane, Schauspiele und Geschichtsbücher verschlungen. Die Bibel kannte er bereits. Seine Neugier wurde in Maulbronn umfassend, und er entfernte sich zusehends von den sorgfältig behüteten Wegen des Elternhauses. Aus der Sicht des Vaters freilich wurde er in dieser Zeit zum Luftikus. Tatsächlich aber war Hermann Gundert nur jeder Fanatismus fremd, und der Vater aber hatte durchaus auch seine fanatischen Züge. Typisch für seine Art, immer noch eins draufzusetzen, ist ein Briefwechsel nach Hermanns Eintritt in Maulbronn. Zur Begrüßung hatte der „Ephorus“, der die Stelle der früheren Äbte bekleidete, gesagt: „Meine Herren, hüten Sie sich vor Dummheiten; Dummheit ist die größte Sünde“. Als der Vater davon erfuhr, schrieb er an Hermann: „Hüte dich vor der Sünde; Sünde ist die größte Dummheit!“ Diese Art muss dem Jungen zugesetzt haben. Der Verzicht darauf, und seine weltläufige Bildung und Erfahrung, machten Hermann Gundert dann auch so anziehend für den Enkel Hermann Hesse, der sich am pietistischen Elternhaus ebenso wund rieb wie an der strengen klösterlichen Disziplin in Maulbronn. Obwohl dort 1806 die schwarze Kutte der Seminaristen dunkler bürgerlicher Kleidung gewichen war, lebten die Bewohner der mittrelalterlichen Gemäuer recht asketisch. Das begann schon damit, dass die fürs Auge so reizvollen alten Flure und Säle vom ersten Frühlingstag bis in den späten Herbst nicht geheizt waren. Im malerischen Kreuzgang fehlen seit jeher Fensterscheiben in den gotischen Spitzbögen, und es zieht dort noch heute ganz jämmerlich.
Über den Tagesablauf in Maulbronn kennen wir durch Hermann Hesse einige Einzelheiten: Aufstehen um 6.00 Uhr, Andacht um 6.30 Uhr, Frühstück um 7.00 Uhr. Es folgte eine halbe Stunde Arbeitszeit, und von 7.45 bis 12.45 Uhr gab es Unterricht mit einer Pause von zehn Minuten. Um 19.30 Uhr war es Zeit für das Abendessen, und danach bis zum Abendgebet um 9.00 Uhr stand eine gemeinsame „Freizeitgestaltung“ in den Wohnräumen auf dem Programm. Überhaupt hat sich anscheinend zwischen 1827, dem Eintrittsjahr Hermann Gunderts, un dem Jahr 1891, dem Eintrittsjahr Hermann Hesses, in Maulbronn nicht allzu viel verändert. Rauchen war verboten, Essen während der Arbeitszeit, auffällige Kleidung ebenfalls. Kaffee war knapp (das Getränk kam erst nach Gundert, zur Zeit seines Sohnes Paul, überhaupt auf den Speiseplan von Maulbronn). Bier war so streng rationiert wie Ausgang und selbst zu bezahlen, ebenso wie Milch, die sich viele der Schüler nicht leisten konnten. Ansonsten waren die Mahlzeiten wohl immer gut und reichlich. Neben dem Ephorus wachen zwei Professoren und zwei Repetenten über die Einhaltung der Statuten und vermitteln außerdem geistige Nahrung. Viele Ordnungsämter wie Fiskar, Stubenältester, Bibliothekar und „Censor“ (Sittenrichter), sind den Seminaristen selbst zugewiesen.
Unter den Kameraden Gunderts in Maulbronn befinden sich der spätere Philosophieprofessor Eduard Zeller, der sozialkritische Schriftsteller Hermann Kurz sowie Gottlob Fink, der als früher Sozialist bekannt wurde. Ihn brachte Hermann 1831 in den Ferien sogar mit ins Stuttgarter Elternhaus, zusammen mit dem späteren Pfarrer Ernst Reinhard. In dieser Mischung zeigen sich erneut die zwei Seelen in Hermanns Brust. Mit Zeller und Kurz war Hermann Gundert auch in der Zeit am Tübinger Stift eng befreundet. Sie wurden Stubenkamneraden, und man darf davon ausgehen, dass sie sich gegenseitig geistig beeinflusst haben. Eduard Zeller, 1814 in Kleinbottwar geboren und 1908 in Stuttgart gestorben, habilitierte sich 1840 in Tübingen als Privatdozent der Theologie und wurde 1847 als Theologe nach Bern berufen, obwohl von seiten der Konservativen heftiger Widerspruch gegen seine freisinnigen Auffassungen laut wurde. Zeller orientierte sich an Ferdinand Christian Baur und seiner Bibelkritik, der streng logischen, vernunftbetonten Naturphilosophie Hegels und dem Jungheglianer David Friedrich Strauß, den er mit Gundert und Kurz schon als Repetent in Maulbronn kennen- und schätzen gelernt hatte. Strauß bestach durch eine scharfe, klare Sprache und bestand auf einer streng positivistischen Bibelauslegung. Er lehrte Gunderts Jahrganhg in Tübingen Logik und Metaphysik, Geschichte der Philosophie und Gschichte der Moral.
Hermann Gunderts Jugendfreund Hermann Kurz, der Autor von „Schillers Heimatjahre“ und „Der Sonnenwirt“ (ein revolutionärer Roman über den Ebersbacher Verbrecher aus verlorener Ehre, Friedrich Schwan), wurde 1813 in Reutlingen als Sohn eines Kaufmanns geboren und starb 1873 in Tübingen als Universitätsbliothekar. Peter Härtling schrieb 1980 in seinem Vorwort zu einer Wiederauflage des fast vergessenen Romans „Der Sonnenwirt“: „An Kurz kann man, wie kaum an einem andern, das Scheitern der Achtundvierziger erläutern, ihren verzögerten Mut, ihre Ängste, vor allem aber den Widerstand auf den sie stießen, das hemmende, retardierende Element in allen deutschen Revolutionen, diese Beharrlichkeit, die vorhandene Miserabilität ertragen zu wollen und der erhofften Veränderung zu misstrauen“.
Das war typisch für das ganze, unentschieden schwankende geistige Klima, dem Gundert in Tübingen begegnete. Im Schiller-Nationalmuseum zu Marbach hängt ein Bild, das Hermann Kurz mit Kollegen des „Schwäbischen Dichterkreises“ bei einem Ausflug nach Weinsberg zeigt. Graf Alexander von Württemberg gehörte dazu, Justinus Kerner, Nikolaus Lenau, Gustav Schwab und Ludwig Uhland. Dieser Kurz war ein unruhiger Geist, aufgeschlossen für alles Neue, hochbegabt, sensibel, kritisch – und unglücklich. Er gab die theologische Laufbahn auf, aber noch radikaler und ungeschützter als etwa Hegel oder Hölderlin, die sich erst einmal als Hauslehrer ein Auskommen suchten. Kurz ließ sich gleich in Stuttgart als „freier Schiftsteller“ nieder und litt von da an den größten Teil seines Lebens materialle Not. Als Redakteur eines Familienblattes in Karlsruhe und später der radikal demokratischen Zeitschrift „Der Beobachter“ engagierte er sich politisch für die Revolution von 1848 und saß dafür einige Monate in Festungshaft auf dem Asperg. Diese wenigen Stichworte zeigen schon, welche Einflüsse von seinem Jugendfreund Kurz auf Gundert gewirkt haben müssen.
Hermann beginnt das Jahr 1828 in Maulbronn mit Hingabe an die weltlichen Musen. Er deklamiert, schauspielert, dichtet und „schöngeistert“, kurz: Er entdeckt die Welt der Literatur. Der Vater ermahnt ihn mit dem Verweis, er könne sich auf Gottes Erdboden nichts Elenderes denken als einen Schauspieler. Sogar ein Holzhauer stehe in seinen Augen sehr viel höher. Das Verhältnis Hermanns zu den Eltern kühlt ab. Die nächsten Jahre vergehen in einem ständigen Wechsel zwischen Ausbruch und Flucht aus der Enge des pietistischen Elternhauses einerseits und Phasen reuevoller Umkehr andererseits.
Im Herbst 1829 kommt es zu einer Krise. Hermann hat gute Zeugnisse, will aber die Welt genießen und an ihr Anteil nehmen, während dem Vater die Welt doch gar nichts bedeutet. Der Sohn findet am Maulbronner Studiengang einiges auszusetzen und will sich auf seine Lieblingsfächer beschränken. Er trägt sich mit dem Gedanken, das Seminar zu verlassen und auf einem staatlichen Gymnasium in Stuttgart weiterzulernen, damit er sich freier bewegen könne. Natürlich verbot ihm der Vater diesen Schritt. Hermann beschäftigte sich unterdessen immer mehr mit neuer Geschichte und Politik. In gewissen Grenzen kam ihm dabei der Kontakt zum Dürrmenzer Pfarrhaus entgegen. Bei dem freundlichen, aufgeschlossenen Pfarrer Kern und dessen Vikar Christoph Blumhardt (dem Älteren) fand er Verständnis und Freundschaft, konnte Bücher und Musikalien ausleihen. Immerhin wirkten die beiden Geistlichen auch mäßigend auf Hermann. Seine Teilnahme am Stammtisch mit den schöngeistigen Kameraden gab zu zum Beispiel aus Rücksicht auf den Geldbeutel der Eltern und unter dem Einfluss des Dürrmenzer Pfarrhauses wieder auf. Im März 1830 hat Hermann einen Unfall. Ein Schulkamerad verletzt ihn versehentlich bei einer Neckerei mit dem Federmesser, und die Familie spricht natürlich prompt von einer „Todesmahnung“.
Nachhaltiger als dieser Schreck wirkt die Säkularfeier der Augsburger Konfession. Hermann vertieft sich aus gegebenem Anlass in die Geschichte der Reformation und seiner Glaubensgemeinschaft. Im Winter 1830/31 wird der Vater schwer krank. Hermann wacht vierzehn Tage an seinem Bett und vertritt ihn anschließend mit außerordentlicher Erlaubnis im Bibelhaus. Daneben liefert er die ersten Übersetzungen aus dem Englischen für die „Missionsnachrichten“: eine Versöhnung zwischen seinen Neigungen und der väterlichen Welt, auch ein ersten Kontakt mit dem Umfeld und Gedankengut der Mission. Durch Notenabschreiben und Privatstunden verdient sich Hermann etwas Geld. Das will er, zusammen mit dem Taschengeld, das die Seminaristen vom Staat erhalten, den Eltern zur Unterstützung geben (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall war damals noch nicht üblich). Die Eltern sind gerührt, lehnen aber ab.
Anfang 1831 politisiert sich Hermanns Leben jedoch wie nie zuvor. Johannes Hesse berichtet: „Ein alter Buchdrucker des Vaters (namens Carl Burkhardt) hatte sich in Vaihingen an der Enz niedergelassen und fing jetzt an, ein Intelligenzblatt für die Oberämter Vaihingen und Maulbronn herauszugeben. Vor allem die Maulbronner Seminaristen waren um Beiträge gebeten. Der Vater warnte, aber der Kitzel war zu stark, und das Blatt begann mit politischen Aufsätzen aus Hermanns gewandter Feder. Auch andere Seminaristen beteiligten sich, bis sich das Oberamt dreinlegte. Hermann aber lebte jetzt in den Zeitungen“.
Europa ist in Aufruhr. In Paris hatte die Juli-Revolution statgefunden, in der Schweiz gab es Unruhen, auch in Stuttgart wurden „Aufruhrplakate“ gefunden, sogar der Fakor in der Bibeldruckefrei hatte im Wirtshaus öffentlich auf die Regierung geschimpft. Hermann träumt von einem neuen Polen im Bund mit einem freien, vereinten Deutschland. Nationale und liberale Gedanken treiben ihn um, während der Vater schreibt: „Ich weiß nicht, wie ich dem Ding von Aufruhrdämon einen Namen schöpfen soll, es ist so dumm und so fad. Revolutionen haben einen Sinn, aber dieses Gewusel durch ganz Deutschland kommt mir vor wie Pulverfrösche, die bald da, bald dort aufknallen, und dann ist´s basta“. Nur der Gedanke, dass es in Württemberg auch eine Geheimpolizei geben soll, gefällt ihm nicht. (Da war er weiter als SPD-Minister im 21. Jahrhundert, die noch 2014 nichts dabei finden, einen Verfassungsschutz und eine politische Abteilung Staatsschutz beim Landeskriminalamt zu haben.) Das Christentum betrachtet Hermann zu dieser Zeit als eine überholte Stufe seiner Entwicklung. Ästhetik, Geschichte und Sprachen sind ihm wichtiger.
Das letzte Maulbronner Semester brachte einen handfesten Krach und eine Begegnung mit Folgen. Einer der Professoren war in einem Zeitungsartikel als verantwortlich für Mißstände im Seminar kritisiert worden und gab die Schuld daran den Seminaristen. In „Christianens Denkmal“ berichtet Hermann wenige Jahre später darüber in der dritten Person: „Hermann, der gerade Lektor war, hatte ihm darauf die Erklärung der Promotion (Anm. des Autors: des Jahrgangs) zu überbringen, der Verfasser sei nicht unter ihr zu suchen; hatte, als der Professor dieselbe zerriss, den ganzen Vorfall dem Ephorus zu melden. Hiedurch wurden Verwicklungen herbeigeführt, die mit dem Rücktritt des Lehrers endeten“. Statt des Zurückgretenen übernimmt nun der 23jährige Repetent David Friedrich Strauß den Unterricht in Latein, Geschichte und Hebräisch. Er begeistert die jungen Leute durch seinen wachen Geist, seine Klarheit und seine Liebenswürdigkeit. Hermann verschlingt Goethe und freut sich auf die Universität. Die Schlussexamina bereiten ihm nicht die geringste Mühe.
Strauß geht ein halbes Jahr nach Berlin, um Hegel zu sehen und zu hören, den wichtigsten deutschen Vertreter der Naturphilosophie und des Idealismus. Als Hermann Gundert im Herbst 1831 in das theologische Stift Tübingen eintritt, treffen er und seine Freunde Kurz und Zeller ihren Lieblingslehrer dort als Repetenten wieder – feuriger denn je und voll von Hegel. Die übrigen Professoren wirken eher langweilig auf die Studenten; ihre Frömmigkeit ist kein Ersatz für Logik und intellektuelle Brillanz. Hermann schreibt nach Hause: „Ich höre Uhland zweimal und Haug zweimal; vielleicht liest aber unser neuer Strauß noch Metaphysik, und den höre ich gar zu gern und öfter. Strauß wird ein Licht. Ich habe ihn besucht. Dem ist´s darum zu tun, Klarheit in die Köpfe zu bringen. O Strauß, bring Salz in das faule Leben! Gestern hat er eine sehr schöne Predigt getan und dem Volke wieder einmal was Neues zum Schwätzen gegeben. Es ist ganz unglaublich, wie ganz Tübingen von dieser Philosophie angesteckt ist...“.