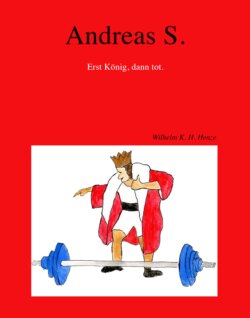Читать книгу Andreas S. - Wilhelm K. H. Henze - Страница 5
Die Bestandsaufnahme
ОглавлениеDer Fremde, mit dem sich Andreas im Bahnhofscafé seiner Heimatstadt verabredet hatte, wartete bereits. Beide hatten sich zufällig in dem Raucherzimmer eines Hotels in Straubing getroffen. Diese Stadt liegt direkt an Andreas Handelsstraße gen Osten. Eine Autopanne hatte Andreas gezwungen, hier einen zweitägigen Not Stopp einzulegen. Und das neue, deutsche Gesetzt, dass Raucher an einem hierfür ausgewiesenen Platz sich von Nichtrauchern zu isolieren haben, hatte Andreas und den Fremden zufällig zusammen gebracht. Beide waren sie im Sinne des Rauchergesetzes Geächtete, eine Grundsympathie für einander konnte man als gegeben annehmen. Über die Rauchware „was ist das für ’ne Marke, die Sie rauchen? Riecht gut“ war zwischen dem Fremden und Andreas ein Gespräch in Gang gekommen. Anfänglich wurde über allerlei Belangloses gesprochen. Doch nach und nach tauchten beide immer tiefer in spezifische Themen ein. Andreas begann, über sich und seine Vergangenheit zu sprechen und stellte dem Fremden unverhofft die Frage: „Darf ich fragen, was Sie beruflich machen“. So eine Frage ist häufig der Beginn einer verbalen Intimität. Sie setzt ein gewisses Vertrauen in den anderen voraus. Ein blindes Vertrauen, denn keiner kannte bisher den anderen. Der Frager geht das Risiko ein, seinen neuen Gesprächspartner zu verleiten „das geht Sie einen Scheiß an“ zu erwidern oder einfach aufzustehen und sich durch „na, denn tschüss auch“ aus der beginnenden Intimität heraus zu winden. „Ich bin als freiberuflicher Berater im Absatzmarketing tätig“, antwortete der Fremde, ohne irgendwelche Geheimnisse preiszugeben. Die frische, unbeschwerte Art, wie der madjarisierte Deutsche bei diesem Rauchertischgespräch über sich und seinen Status quo berichtete, hatte den Fremden positiv überrascht. Gleichermaßen interessierte ihn auch Andreas Lebensberichte. Und da der Fremde in Kürze beruflich in der Gegend von Andreas Heimatort zu tun hatte, wurde im Foyer des Hotels diese Verabredung im Bahnhofscafé angedacht. Es sollte ein dreistündiges Gespräch zwischen den beiden werden, bei dem Andreas chronologisch die Stationen seines bisherigen Lebens beschrieb. Er sprach auch ein im Fernsehen ausgestrahltes Interview mit Bernd H. an, dass sehr viel, so drückte sich Andreas aus, enthüllt hätte und in einem nicht erwarteten Eklat geendet wäre. „Kannst Du mir das einmal zeigen“, fragte der Fremde. Beide waren inzwischen beim Du angekommen, was die Kommunikation zwischen ihnen, besonders Andreas Berichterstattung, viel ergiebiger gestaltete. „Mein Papa hat es zu Hause. Ich ruf rasch an, dass wir vorbeikommen. Ist nicht weit von hier.“ Der Papa stimmte zu, der Fremde bezahlte die Zeche, nachdem ihm Andreas versicherte, dass er am zwanzigsten eines Monats kein Geld mehr habe, und sie fuhren gemeinsam zum Papa. „Nächste muscht links ab!“ lotste Andreas ihn durch den Verkehr. „Nun die zweite nach rechts und dann die dritte Straße links. Da sin ma.“ Und er fügte beim Abbiegen in die Straße, an der der Papa wohnte, noch hinzu: “Der Papa weiß aber nicht, dass ich Hells Angel bin. Sag bitte nichts!“ Ungläubig schaute ihn der Fremde von der Seite an und sagte: „Steht doch bei Dir auf dem Rücken!“ Der Papa wohnte in einer Siedlung, die aus zwanzig Wohnblocks, jeder in sechs Wohneinheiten unterteilt, bestand. Von der Zubringerstraße gingen nach links zwei parallel verlaufende Straßen ab. Jeweils fünf Wohnblocks waren zu jeder Seite dieser Straßen in exakt gleichen Abständen, mit der langen Front zur Straße hin, errichtet worden. Am Ende der Straße bog man dann auf eine quer verlaufende Durchgangsstraße ein. Alle Wohnblocks waren ‚preußokratisch’ angeordnet. Dazwischen lagen großflächige Rasenteile, die die Siedlung hell und freundlich erschienen ließen. In den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, als diese Wohnsiedlung erbaut wurde, erlaubten die niedrigen Baulandpreise solch eine großzügige Bebauung. Sie galt als fortschrittlich und sozial und war so der Bedürfnisse des modernen, verantwortungsbewussten Bürgers angepasst. Es war eine typische Arbeitersiedlung, die von einem international tätigen Konzern für leitende Mitarbeiter des dortigen Werkes erbaut worden war. Zu jener Zeit waren für einen Konzern eigene Immobilien eine interessante, produktionsunabhängige Diversifizierung. Hauptsächlich waren sie für die Mitarbeiter eine preisgünstige Wohnung und für den Arbeitgeber eine enge Bindung an seine Firma. Ganz zu schweigen von steuerlichen Aspekten. Damals waren Mitarbeiter noch das Fundament eines Unternehmens. Und dieses Fundament konnte gar nicht genug gefestigt werden. Auch nach Feierabend wusste die Unternehmensführung die Zeit ihrer Mitarbeiter sinnvoll zu gestalten. Es gab eine Betriebssportabteilung, in der Mannschaftssportarten angeboten wurden. Ergänzt durch sporadische Fahrten ins Grüne der einzelnen Abteilungen des Konzerns wurde die von der Führungsetage kreierte Firmenphilosophie auch noch in die kleinste Zelle der Beschäftigten implantiert. Im Laufe der Jahre und durch eine innovativere Geschäftspolitik der Großunternehmen hatte sich in dieser Siedlung, in der Andreas Papa seit seiner Heirat wohnte, eine Veränderung ergeben. Die Wohnblocks waren an eine Finanzgruppe veräußert worden, die die Wohnungen auch an andere Personenkreise vermieteten. Dadurch hatte sich eine gemischte Mieterstruktur ergeben, die sich teils durch sprachliche Barrieren, teils durch kulturelle Gegensätze in einzelne Interessengruppen zergliedert hatte. Es war nicht mehr wie zu Andreas Jugendzeiten, als jeder jeden kannte, man miteinander sprach oder sich sporadisch in der Nachbarschaft zum geselligen Beisammensein verabredete. Die neuen Mieter kamen von überall. Das Sprachengewirr und die große Fremdartigkeit einiger Kulturen und Bräuche erstickten ein eventuelles interkommunikatives Bemühen bereits im Keim. Man konnte sich nur schwer verständlich machen. Häufig bildeten sich Parallelgesellschaften. In diesen Jahren hatte die Mieterfluktuation zugenommen. Oft hervorgerufen durch soziale Schieflagen. Wohnungen wurden als Eigentumswohnungen angeboten und wieder veräußert. Zwangsräumungen geschahen zwangsläufig. Vieles, ja sehr vieles hatte sich hier im Laufe eines halben Jahrhunderts geändert. Nur der Papa war geblieben. Papa wohnte im Haus Nummer sechs. Es war der dritte Block auf der rechten Seite der ersten Straße. Andreas S. klingelte an der Haustür. „Er wohnt gleich unten rechts. Also parterre“, erklärte er dem Fremden. Seine Stimme klang ganz aufgeregt, wie die Stimme eines Buben, der von der Schule heim kommt, um die Eltern mit allen Neuigkeiten zu überhäufen, die er erlebt hatte. Das Summen des Öffners an der Haustür forderte die beiden zum Eintreten auf. Zielstrebig ging Andreas voran. Drei Steinstufen hinauf und sie kamen auf die Wohnung zu, in der er seine ganze Jugend verbracht hatte. Der Papa erwartete sie vor dem Wohnungseingang und führte beide nach einem kurzen, knappen ‚Guten Tag’ ins Wohnzimmer. Kein Wort oder irgendeine Geste zwischen dem Papa und Andreas deuteten darauf hin, dass sie mit einander verwandt waren. Und ein Vater-Sohn-Verhältnis war für den Fremden überhaupt nicht erkennbar. Eine sehr eigenartige Stimmung, kühl und doch erwärmt gewünscht, abweisend und doch herzlich gewünscht. Merkwürdig. Der Fremde versuchte, mit dieser unerwarteten Atmosphäre einigermaßen klar zu kommen. Er empfand ein Mitgefühl mit Andreas Vater, der ihm sehr verbittert erschien, warum auch immer. Die Erscheinung des sehr schweigsamen Papa, knapp über einmetersechzig groß, ließ vermuten, dass sein Berufsleben von Akribie und Korrektheit bestimmt worden war. Sein Körper war schlank, ohne jeglichen, in diesem Alter fast üblichen Bauchansatz. Er machte auf den Fremden den Eindruck, als wenn er immer noch aktiv Sport betreiben würde. Seine Kleidung war nicht dem letzten Modetrend angepasst, aber akkurat und gepflegt. Er trug eine braune Cordhose, fein gerippt, und ein kariertes, rosafarbenes Freizeithemd mit langen Ärmeln. Den oberen Kragenknopf hatte er nicht verschlossen, so dass ein paar graue Brusthaare neugierig herauslugen konnten. Über dem Hemd trug er, der momentanen Witterung angepasst, einen Pullunder in dunklem Rot. Eng anliegend und gleichmäßig über die Taille gezogen. Sein schon ausgedünntes Haupthaar hatte er parallel nach hinten gekämmt und das goldgerahmtes Brillengestell bestätigte die hohe Qualität dieses Produktes augenscheinlich schon im dritten Jahrzehnt nach der Markteinführung dieses Brillendesigns. „Schöne, helle Wohnung“, sagte der Fremde zum Papa. „Wohnen Sie schon länger hier?“ „Seit unserer Heirat. Also seit neunzehnhundertneunundfünfzig. Leider ist meine Frau im letzten Jahr gestorben. Andreas ist hier aufgewachsen. Jedenfalls wohnten wir hier schon, als er in Argentinien geboren wurde.“ „In Argentinien?“ fragte der Fremde erstaunt. „Ja“, kam die knappe Antwort vom Vater. Er wollte damit zu verstehen geben, dass er dieses Thema nicht weiter vertiefen wollte. Die Dialoge wurden immer einsilbiger, bis sie endgültig endeten. Und Andreas sagte von sich aus nichts. Nur ab und zu wollte er bei der Beantwortung einer Frage dem Vater zuvor kommen, wurde aber sofort von diesem zurechtgewiesen. Er gab die Versuche schließlich auf und überließ dem Fremden die Versuche zu einer weiteren Gesprächsführung. ‚Seltsam’, dachte der Fremde, ‚wie können Vater und Sohn sich gegenseitig so ignorieren? War der Papa immer so? Oder war er im Moment nur abgespannt und müde?’ Der Fremde glaubte zu bemerken, dass der Vater sich anders gab, als er in Wirklichkeit war. Er erschien mutlos, resigniert, verbittert. Aber die sportliche Erscheinung des Vaters passte absolut nicht zu diesem Verhaltensmuster. Gut, er war introvertiert. Aber deshalb konnte man sich doch nicht so abweisend gegenüber dem eigenen Sohn verhalten. Irgendetwas hatte das Gleichgewicht des Vaters vollkommen zerstört. Im Wohnzimmer hatte der Papa, da Andreas ihm beim vorangegangenen Telefonat den Grund seines Kommens erzählt hatte, schon alles vorbereitet. Auf dem Fernseher älterer Bauart stand der für die Vorführung erforderliche Videorekorder, die Kassette wurde aus der zimmerbreiten Schrankwand genommen und der Papa begann nun, alles für die Vorführung vorzubereiten. Andreas und der Fremde hatten auf der Couch, einem Möbelstück aus der Ersteinrichtung der Wohnung, Platz genommen. Der Papa hatte einen der zwei Sessel, die an jeder Stirnseite des glasplattenbelegten Couchtisches standen, so gestellt, dass er dem nun kommenden Beitrag ungestört folgen konnte. Sein Sohn saß, für ihn im Moment nicht sichtbar, hinter ihm. Die Fragen, die der Fremde während des Videobeitrags teils an Andreas und teils an den Papa stellte, wurden meist vom Papa beantwortet. Er drehte sich dann zu dem Fremden um, fokussierte sich nur auf ihn und gab ausführlich Auskunft. Fragen, die Andreas an seinen Vater stellte, blieben entweder unbeantwortet oder die Antwort wurde, wie die Kugel auf dem Billardtisch, via Bande, sprich Zimmerwand und Zimmerdecke, zu Andreas hingeleitet. Die Vorkommnisse, das heißt die Berichterstattung, in der Andreas eine tragende Rolle spielte, und die Interviews von Bernd H. in der Videoaufzeichnung waren für den Fremden unglaublich. Ein Sumpf in der sonst so gefestigt erscheinenden Sportwelt, der unglaublich tief zu sein schien. Als die Vorführung nach knapp einer halben Stunde beendet war, bat der Fremde Andreas um die Zusendung einer Kopie dieser Aufzeichnung, um sich in aller Ruhe in dieses Thema nochmals vertiefen zu können. Nach dieser Videovorführung herrschte eine beklemmende Ruhe, die durch das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn noch verstärkt wurde. Um die Atmosphäre etwas zu entkrampfen, fragte der Fremde den Vater allerlei unverfängliche Sachen. „Treiben Sie denn noch Sport? Andreas hat mir erzählt, dass Sie früher einmal geboxt haben. In welcher Klasse sind Sie gestartet?“ Dem Papa erschien diese Frage etwas unbehaglich zu sein. Er wollte nicht gern über Siege und Erfolge sprechen. „Ich gehe heute noch einmal in der Woche zum Faustball. Die Mannschaft ist jetzt seit fast dreißig Jahren zusammen. Es ist eine Betriebsmannschaft meiner ehemaligen Arbeitsstelle“. „Die Gegend ist ja ganz ideal für Fahrten ins Grüne. Sind Sie häufig in der Natur“, startete der Fremde den nächsten Versuch, eine ergiebigere Unterhaltung an zu stoßen. „Seit dem meine Frau im letzten Jahr gestorben ist, bin ich kaum noch draußen“. „Ja, aber mit der Mama warst Du doch öfter in die Berge gefahren“, mischte sich Andreas vorsichtig ein. „Lass die Mama, sie ist tot“, kam es ungewöhnlich schroff vom Vater. Erschrocken schaute der Fremde verstohlen zu Andreas hin, der bei dieser Zurechtweisung durch seinen Papa förmlich zusammengezuckt war. Scheinbar hatte der Vater dies auch mitbekommen, denn er drehte nun seinen noch in Richtung Fernseher stehenden Sessel so, dass sich, zumindest optisch, eine richtige Gesprächsrunde ergab. Und vielleicht auch selbst etwas erschrocken über die Wirkung seiner Worte, wartet er nun auf eine Gelegenheit, dieses verstärkte Spannungsfeld zwischen ihm und seinen Sohn zu entschärfen oder vielleicht sogar gänzlich abzubauen. Andreas hatte in dem vormittäglichen Gespräch seine Mutter als eine herzensgute Frau beschrieben, die alles tat, um ihren Sohn zu unterstützen. Sie war für ihn Zufluchtsort und Kraft gebende Quelle gleichermaßen gewesen. Er hatte gesagt: ‚Sie fehlt mir sehr‘. „Du hast doch“, der Papa wandte sich mit diesen Worten an Andreas, „noch Zeitungsausschnitte, Pokale, Urkunden und vieles mehr in Deinem Zimmer. Zeig’s mal!“ Andreas Augen begannen zu leuchten. Wie bei einem Hund, der nach einer Rüge unerwartet ein Leckerchen bekam. Er empfand diese Aufforderung als einen erneuten Ansatz einer, schon lange von ihm ersehnten Aussöhnung zwischen ihm und seinem Vater. Doch kaum war diese Hoffnung bei Andreas gefestigt worden, da kam der nächste Knockout. „Wenn er doch nur arbeiten würde“, sagte der Vater zu dem Fremden, „wenn er doch nur würde“. Wie ein Stundengebet klang dieser Wunsch des Vaters. „Aber seit die Mutter gestorben ist…“ Der Fremde hatte den Eindruck, dass seine Anwesenheit für Vater und Sohn eine Chance war, die beide zur neuen Annäherung an einander nutzen könnten. Denn es kam dem Fremden vor, als wenn sie beide ihn als einen möglichen Streitschlichter einplanen wollten. Oder in ihm einen Katalysator, einen Beschleuniger, für eine mögliche Aussöhnung in ihrer total verkorksten Vater-Sohn-Beziehung sehen würden. „Das Nichtstun kann doch kein Lebensinhalt sein“, klagte der Vater weiter. „Ei, wenn mich doch keiner nimmt. Ich bin zu alt“, verteidigte sich Andreas mit seinen achtundvierzig Jahren. „Was soll ich denn dagegen machen.“ Ende eines Ansatzes zu einem möglichen Versöhnungsversuch. „Halten Sie denn die Wohnung ganz allein in Ordnung“, fragte der Fremde, um die Zeit über die Runden zu bringen, denn er konnte sich im Augenblick unmöglich verabschieden. Es wäre für Vater und Sohn beleidigend gewesen. Und er fuhr fort: „Die Wohnung ist doch ganz schön groß.“ „Ja. Sonst hat es meine Frau ja getan. Aber seit dem sie im letzten Jahr leider gestorben, muss ich es ja allein machen. Aber so geht die Zeit wenigsten vorbei.“ Der Fremde hatte, neugierig wie er war, schon beim Betreten der Wohnung sich möglichst unauffällig umgeschaut. Die Wohnung war alt möbliert, teilweise war es noch die Erstausstattung, so vermutete er. Aber es war alles sauber. Kein Staubkörnchen. Alles war exakt geordnet und ausgerichtet. Die weißen Stores vor den großen Wohnzimmerfenstern waren in parallele Falten gelegt, deren Abstände sicherlich mit dem Zollstock kontrolliert worden waren. Der Fußboden, mit den zur Erbauer Zeit üblichen PVC-Fliesen belegt, war größtenteils mit Teppichen bedeckt. Der nicht verdeckte, sichtbare PVC-Teil war auf Hochglanz getrimmt. „Wollen Sie nicht Andreas Zimmer sehen“, fragte der Wohnungsinhaber unvermittelt. „Er wohnt hier zwar nicht mehr, aber die Pokale, Urkunden, Auszeichnungen und alle Zeitungsberichte über ihn sind dort. Wenn Sie wollen?“ und er stand auf, um den Fremden zu Andreas Jugendzimmer zu lotsen. Das Zimmer war hell und freundlich. Es sah nicht aus, als sei es unbenutzt. Es war aufgeräumt und vermittelte doch den Anschein, dass es täglich mit Leben gefüllt war. In den weißen Schränken waren Bücher und zahlreiche Pokale. An den Wänden Urkunden, Zeitungsausschnitte und Fotos mit Andreas in Aktion, und Andreas als Kind mit seinen Eltern, und Andreas bei seinem ersten Schulgang, und Andreas als Jugendlicher mit seinen Eltern. Vermutlich auf einem der Ausflüge in die umliegenden Berge. Andreas war von Beginn an seinem Vater und dem Fremden gefolgt, um besondere Fragen beantworten zu können. „Dies war in, na, Papa, wo war das noch mal?“ und der Papa antwortete: „Weißt Du’s nicht. Das war bei der EM.“ Und so ergänzten sie sich weiter bei der Beantwortung der Fragen, die der Fremde stellte. Er bekam immer mehr den Eindruck, dass der Aussöhnungsversuch zwischen Vater und Sohn wieder in Gang gekommen war. Doch der Vater sollte es seinem Sohn noch unendlich schwer machen. Es war schon spät am Nachmittag, als der Fremde den beiden sagte, dass er sich verabschieden müsse. Er hatte noch eine dreihundertfünfzig Kilometer lange Heimreise vor sich. „Soll ich Dich mit zu Deiner Wohnung fahren?“ fragte er Andreas. „Nein, der Papa bringt mich nach Haus. Gell, Papa.“ „Wieso?“ fragte dieser überrascht. „Ich wollte noch ein wenig mit Dir reden.“ „Worüber?“ fragte ihn sein Vater. ‚Aha’, dachte der Fremde, ‚wieder Abbruch der Familienintegrationsversuche’. Nun, leicht amüsiert über das verdeckt geführte Duell zweier Querdenker, wartete der Fremde auf eine Entscheidung. „Ja, doch“, entgegneter Andreas. „Bringst mich nach Hause?“ „Wann denn?“ fragte der Papa. „Dauert nicht lange. Nur kurz reden“, sagte Andreas. Glücklich über seinen Erfolg wandte er sich zu dem Fremden und sagte: „Der Papa bringt mich schon!“ Der Fremde verabschiedete sich vom Vater und ein erwartungsvolles Leuchten in dessen Augen zeigte ihm, dass auch er reden wollte. Endlich. Andreas begleitete seinen Gast zur Tür und verabschiedete ihn mit den Worten: „Komm gut heim. Melde Dich mal wieder.“