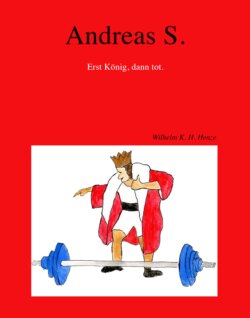Читать книгу Andreas S. - Wilhelm K. H. Henze - Страница 6
Allein
ОглавлениеEine Woche später wurde der Fremde von Andreas angerufen. „Wie geht es Deinem Vater?“ fragte dieser Andreas. „Den habe ich am Samstag ins Krankenhaus gebracht. Krebs. Soll Chemotherapie bekommen. Ich werde ihn zweimal die Woche dorthin fahren. Aber der Arzt hat gesagt, dass er vielleicht nur noch zwei Monate zu leben hat.“ Wie sich herausstellte, war auf diese Aussage des Arztes Verlass gewesen. Der Vater hatte sich noch an dem Tag, als der Fremde dort war, mit seinem Sohn aussprechen können. Dem Vater hatte es Frieden gegeben, dem Sohn machte es glücklich. Aber Andreas spürte jetzt, dass er noch einsamer war. Die Mutter, die sein ganzer Halt über all die Jahre gewesen war, und der Vater, dessen Halt er die ganze Zeit gesucht hatte, beide hatten ihn nun allein gelassen. Der Schreibtisch aus matt glänzendem Mahagoniholz war viel zu groß für die paar Akten, die darauf auf Bearbeitung warteten. Und der Arbeitscomputer mit dem davor befindlichen Keyboard nahm auch nicht viel Platz ein. Aber die Größe hatte den Vorteil, dass Gesprächspartner, die dem am Schreibtisch arbeitenden gegenüber saßen, auf Distanz gehalten werden konnten. Andreas, ein auf Distanz gehaltene Gesprächspartner, erklärte seinem Gegenüber den Grund seines Kommens. „Mein Vater ist gestern verstorben“, begann er sein Gespräch. „Er hat hier bei Ihrer Bank ein Sparkonto. Ich brauche nun dieses Geld, um die Beerdigung und das ganze Drum und Dran bezahlen zu können.“ „Um welches Konto handelt es sich denn“, wollte der Banker wissen. Er lächelte verbindlich bei dieser Frage, was ein gewisses Wohlwollen vortäuschen sollte. Denn sein Äußeres, der dunkelblaue Anzug, das blütenweiße Hemd und die dezent geblümte Krawatte aus reiner Naturseide wirkten auf Andreas wie ein unüberwindbares Bollwerk. „Ja, nun, dass von meinem Papa“, sagte Andreas etwas erschrocken, denn der Banker kannte ihn doch von früher. Er hatte ihn oft bei Wettkämpfen angefeuert und hatte sich, wenn immer es möglich war, in Andreas Umfeld gesonnt. „Wie ist denn Vorname des Vaters“, forschte der ehemalige Fan weiter. „Rudolf“, antwortete Andreas weiter. Er stellte sich langsam auf einen zu erwartenden Fragenautomatismus ein. Doch letztlich waren Ihm die Fragen auch egal. Die Hauptsache war für ihn, dass ihm Papas Erspartes ausgezahlt wurde. Er schätzte es auf mindestens fünftausend Euro. Geschäftig durchsuchte der Banker über die Tastatur des Keyboards die entsprechende Computerdatei. „Ach ja, hier ist es“, sagte er strahlend zu Andreas. „Ja und, wie viel is uff’m Konto“, fragte dieser. „Moment bitte. Genau zweitausendachthundert Euro und fünfundsechzig Cent“, kam die Antwort vom immer noch stereotyp lächelnden Bankmitarbeiter. Nachdem Andreas seine Enttäuschung über den wesentlichen geringeren Sparbetrag als angenommen überwunden hatte, sagte er zu seinem Gegenüber klar und knapp: „Denn hätt ich das gern mitgenommen“. „Sie haben eine Vollmacht über das Konto“? Und er fügte noch hinzu: „Diese müsste ich eben einmal einsehen“. „Was für ’ne Vollmacht. Er war ma Babba. Und nun ist der weg. Da krieg ich doch das Geld“, forderte Andreas den Banker auf. „Ohne Vollmacht können wir Ihnen das Geld erst nach der Beerdigung auszahlen“, lehnte der bankintern Ausgebildete diese Forderung ab. „Wir zahlen die Beerdigungskosten vom Konto Ihres Vaters und werden Ihnen dann den Rest auf Ihr Konto überweisen“. Dies war die letzte Anweisung und gleichzeitig die Aufforderung an Andreas, den Stuhl, den Raum und das Bankgebäude zu verlassen. Auf der Straße angekommen, murmelte er stocksauer vor sich hin: ‚Ich kennt mich uffreesche iwwer demm sei dumm Gebabbel. Dem Arschloch werde ich es zeigen. Dabbschädel. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht schon jetzt Papas Erspartes bekommen sollte. Den du ich runnerbuzze! Werde mit einem Anwalt gegen die Bank vorgehen und eine Auszahlung erzwingen.’ Da es schon spät am Nachmittag war, verschob er dieses Vorhaben auf den nächsten Tag. In seinem neuen Zuhause, das heißt, in der Wohnung seines verstorbenen Vaters angekommen, fand er eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter vor, dass seine Tante, die Schwester seines Vaters, am morgigen Donnerstag mit dem Zug aus Berlin anreisen würde. Der Zug würde um 9.30 Uhr dort eintreffen. Und er möge sie bitte vom Bahnhof abholen. Sie war die einzige Verwandte, wie es schien, die den Tod von Rudolf S. wahrnahm. Am nächsten Tag begab sich Andreas zur mitgeteilten Zeit zum Bahnhof, um seine Tante abzuholen. Er mutmaßte, dass er sie seit mindestens zwanzig Jahren nicht gesehen hatte. Bei der Beerdigung seiner Mutter im letzten Jahr war sie nicht gekommen, weil sie, wie sie im Kondolenzbrief mitteilte, gerade eine starke Grippe hatte. Sonstige Kontakte brieflicher oder fernmündlicher Art waren ihm nicht bekannt. Wie stark die Bindung zwischen seinem Vater und dessen Schwester gewesen war, hatte er auch nie richtig erfahren. Der Bahnhof seiner Heimatstadt sah, wie die meisten Bahnhöfe im regionalen Raum, veraltet, vernachlässigt und ungepflegt aus. Für jeden sichtbar, intime Mitteilungen eines Jungen an seine Liebste. Und Graffitis überall dort, wo freie Flächen waren. Allerdings nicht im Stil eines klassischen Graffiatos, wie sie zur Verzierung von Tonwaren verwendet wurden, sondern ausschließlich in eigener Auslegung der Sprüher, als schwer zu beseitigende Wandkritzelei. Mit lautem Kreischen wurde die restliche Schubkraft des einlaufenden Zuges abgebremst, bevor der Triebwagen und die beiden angekoppelten Waggons mit einem leichten Ruck stehen blieben. Andreas schaute die Wagenreihe entlang, um zu sehen, wo seine Tante aussteigen könnte. Einige Reisende versperrten ihm dabei die Sicht. Doch der Bahnsteig war so schmal, dass man nicht unbemerkt aneinander vorbeikommen konnte. Er würde seine Tante auf keinen Fall verfehlen können. Diese hatte, im Gegensatz zu Andreas, aufgrund ihres höheren Standortes beim Verlassen des Zuges, einen guten Überblick über die hastenden Leute auf dem Bahnsteig. Und so erblickte sie auch eine Person, bei der sie sich sicher war, dass es Andreas sein musste. Auch wenn sie ihn das letzte Mal vor gut zwanzig Jahren gesehen hatte. Er konnte es nur sein. Seine Erscheinung, seine Kleidung. Unverwechselbar! Einer alten Gewohnheit folgend, nahm zog sie ein blütenweißes Spitzentaschentuch aus ihrem schwarzen Handtäschchen und winkte heftig damit in Andreas Richtung. Zusätzlich verstärkte sie die gewollte Aufmerksamkeit auf sich durch ein lautes „Hallo, Andreas, huhu!“ Nicht nur Andreas war durch diese überfallartige Verbalattacke auf sie aufmerksam geworden. Auch andere, nicht unmittelbar betroffene Reisende, nahmen die Dame wahr. Sie sahen eine ganz in schwarz gekleideten, mittelgroße, schlanke Rentnerin, die wie in der Zeit unbeschwerter Eisenbahnromantik mit dem Taschentuch winkend und immer wieder ‚Andreas, hier!’ rufend aus dem Zug an Bahnsteig drei stieg. Einige der ungewollt zu Voyeuren gewordenen Reisenden fühlten sich urplötzlich wieder in die Zeit versetzt, als es noch keine Handys, keine Computer, keine Verkehrsstaus gab, und die Lokomotiven in die Bahnhöfe mit ihrem herauspuffenden Qualm, der diesen unwiderstehlichen Geruch nach Ferne, Urlaub, Abenteuer hatte, ein- und ausfuhren. Als noch Bahnbedienstete in ihrer weit erkennbaren Uniform den Reisenden freundlich ihre Fragen beantworteten. Die Zeit, in der den Reisenden die Fahrkarten nach Angabe ihres Reiseziels persönlich von einem Schalterbeamten ausgehändigt wurden. Die Zeit, als die Züge zu den angegebenen Zeiten auch wirklich in den Bahnhof einliefen und zu den vorgegebenen Zeiten auch wieder herausfuhren. Andreas eilte auf seine Tante zu und begrüßte sie herzlich. Er freute sich, dass sie gekommen war. Dass ihm jemand beistand bei den nun anstehenden Formalitäten. Er berichtete seiner Tante auch sofort von seinem Versuch am Vortage, Papas Erspartes von der Bank zu bekommen. Seine Tante war überzeugt, dass sie ihm bei diesem Unterfangen helfen müsse und marschierte mit ihrem Neffen zusammen geradewegs zur Bank. Ihren Trolley wie eine abschussbereite Kanone hinter sich herziehend. Sie marschierten zusammen zielstrebig, Andreas kannte ja den Weg, zur Abteilung für Spareinlagen. Sie wurden angemeldet und nach einer kurzen Wartezeit zu demselben Banker geführt, mit dem Andreas seine Meinungsverschiedenheit hatte. „Guck emol, esch der agemoddelt“, raunte Andreas seiner Tante leise zu. Der Anzug, die Krawatte, beides war Andreas noch vom Vortage bekannt. Den Rest hatte der Banker gewechselt. Das Gespräch verlief in einer unverbindlich höfflichen Atmosphäre. Er hatte vollstes Verständnis für Andreas Nöte, sprach mit der Tante über Berlin, dass er vor drei Monaten dort war, ihn die Freizügigkeit dieser Stadt begeistert hätte und war auch durch die Tante nicht zur augenblicklichen Herausgabe des Geldes zu bewegen. Auch sie hörte die gleiche Antwort wie Andreas: „Tut mir leid, aber ohne eine Vollmacht kann ich im Moment kein Geld auszahlen“. Selbst sie, die gestandene Berlinerin, ausgestatte mit der weltberühmten Berliner Schnauze, konnte Vorschriften, auch sinnlose, nicht außer Kraft setzen. „Und wer zahlt ma de Fahrtkosten?“ fragte die Tante vorsichtshalber den Banker. „Die können wir selbstverständlich vom Konto des Verstorbenen zahlen“, sagte der Mann und er sah, wie die Berlinerin diese Zusage erleichtert aufnahm. „Na, dann machen Se det man“ sagte sie rasch. Man konnte ja nie wissen, ob der Angesprochene seine Meinung nicht noch ändern würde. „Dann werde ich doch den Anwalt einschalten“, sagte Andreas entschlossen zu seiner Tante, als sie das Bankgebäude verließen und auf das gegenüber liegende Café zusteuerten. „Der kostet aber Geld“, gab sein Tante zu bedenken. „Hajo, schon, aber…“ in diesem Moment riss ihn seine Tante am Ledermantel zurück. „Hast Du denn das Auto nicht gesehen. Kannst doch nicht einfach so über die Straße träumen“, sagte sie vorwurfsvoll. „Warum hält der nicht“, ereiferte sich Andreas. „Der hat mich doch gesehen, der Dabbschädel!“ „Vielleicht auch nicht“, sagte sie etwas eigenartigen mit einem kurzen Seitenblick auf Andreas. „Du bleibst doch bis zur Beerdigung“, vergewisserte er sich bei seiner Tante. „Kannst bei mir übernachten. Ich wohne jetzt in der Wohnung vom Papa.“ „Wirst Du sie übernehmen“, erkundigte sie sich. „Wenn es geht, ja. Meine Wohnung draußen ist mir zum Ende April gekündigt worden. Ich muss ausziehen! Wo soll ich hin. Is schun schäh in de Wohnung vom Babba!“ „Kannst Du nicht versuchen“, überlegte die Tante, „ im Rathaus mit jemandem über die Sturheit der Bank zu sprechen. Man kennt Dich doch! Vielleicht erreichst Du etwas“. „Die Idee ist gut und koschtet nichts“, pflichtete Andreas ihr bei. „Ich muss doch Rechnungen bezahlen. Woher soll ich das Geld nehmen“? „Du kriegst doch Harzt vier. Nimm doch davon das Geld für die Rechnungen“, schlug sie vor. „Hajo, die dreihundertfünfundvierzig Euro sind schon für Energiekosten und Miete druffgegange“; rechtfertigte er sich. „Und wovon soll ich leben“, beklagte sich Andreas weiter. Neben Andreas, der dem trüben Wetter im langen schwarzen Ledermantel trotzte, und seiner Tante, die einen Regenschirm gegen eventuell einsetzenden Regen aufgespannt hatte, waren noch ein Bekannter aus dem Wohnviertel, in dem seine Eltern jahrzehntelang gewohnt hatten, und eine Abordnung der Sportkameraden von Rudolf S. zum Friedhof gekommen, um von Andreas Vater Abschied zu nehmen. Nach der kurzen Trauerrede ging jeder dem üblichen Ritual nach und warf eine der bereitgestellten Nelken ins das offene Grab, hielt kurz inne und verabschiedete sich von Rudolf S. in aller Stille, um wieder dem Tagesgeschehen nachgehen zu können. Andreas brachte seine Tante rechtzeitig zum Bahnhof, damit sie den ICI in Frankfurt um 15.14 Uhr sicher erreichen würde. Ein kurzes Winken zwischen beiden bei der Abfahrt des Zuges und Andreas war allein. Wieder allein. Ganz allein. Wie hatte er sich gefreut, dass er nach den zwei Jahren Entfremdung von seinem Vater wieder von diesem aufgenommen worden war. Er hatte wieder Lust am Dasein gewonnen. Fast schien es wieder wie früher zu werden. Er hätte sich Rat holen können, sich wieder aufbauen lassen. Und nun war dieser Mentor ohne Andreas Einwilligung gestorben. Einfach so. So langsam schien Andreas zu begreifen, was geschehen war. Es war niemand mehr da, mit dem er über seine Sorgen sprechen konnte. Niemand, der ihn beraten konnte, ihm Mut zusprechen konnte oder ihm einfach nur zuhörte. Er saß in der Wohnung seiner Eltern, in der er aufgewachsen war. In der er früher bei seinen Eltern stets Geborgenheit gespürt hatte. Die für ihn da gewesen waren, wenn er sie brauchte. Nun war er wieder zurückgekommen und war allein. Das Klingeln des Telefons brachte ihn wieder in die Gegenwart. „Ja, hier Andreas S.“. „Hallo, Andreas“, sagte der Fremde, „wie fühlst Du Dich. Hast Du den Abschied von Deinem Vater überwunden?“ „Ei, schon“, antwortete er. „Aber was soll ich nun mit der Wohnung machen?“ „Mit welcher Wohnung?“ fragte der Gesprächsteilnehmer. „Du weißt, dass ich aus meiner Wohnung ausziehen musschte. Nun dachte ich, dass dem Papa diese Wohnung hören tät. Ist aber nicht. Er hat seine Abfindung, die ihm von seinem langjährigen Arbeitgeber beim Ausscheiden in den Vorruhestand gezahlt worden war, umgewandelt in ein lebenslanges Wohnrecht.“ „Kannst Du die Wohnung nicht anmieten“, forschte der Fremde nach. „Das will ich ja. Aber ich soll viertausendfünfhundert Euro Kaution hinterlegen. Ei, woher denn? Und ma Frau bekommt ein Baby.“ „Toll“, kam es vom anderen Ende der Leitung. „Ja, nun lausche mal. Da sagt mir dieser Verwalter, dass ich mit einem Kind sowieso keinen Mietvertrag bekäme. Mit einem Hund ja, aber mit einem Kind nicht! Und als Hartz vier-Empfänger sähe das Ganze von vorn herein nicht gut aus.“ „Wie lange kannst Du denn in der Wohnung Deines Vaters noch bleiben?“ „Drei Monate, dann muss ich ausgezogge sein!“ „Kannst Du denn nicht Euren Bürgermeister einschalten. Du bist doch von ihm immer für Deine Verdienste um die Stadt hochgehalten worden“, wollte der Fremde wissen. „Ja, scho“, versicherte ihm Andreas. „Kannst doch bei Gelegenheit auch nochmals wegen eines Jobs aktiv werden. Ein Job würde einige Deiner Probleme lösen“, schlug der Fremde vor. „Ich hatte ja versucht, meinen alten Job als Bademeister wieder zu bekommen. Ist aber belegt. Dann hat man mir gesagt, man könnte mir nur einen Eineurojob anbieten. Aber dafür sei ich wohl überqualifiziert.“ „Und nun?“ kam die Frage vom Anrufer. „Als letztes wollten sie mir einen Job an einer Autobahnraststätte an der B5 anbieten. Ich sollte für ein Euro und neunzig Cents die Stunde zuzüglich fünfzig Prozent eventueller Trinkgelder WC-Dienst machen. Habe ich aber abgelehnt.“ „Hast Du versucht, in Deinem erlernten Beruf als Masseur und Physiotherapeut für Behinderte unterzukommen?“ bohrte der Fremde weiter. „Keine Stelle frei“, kam etwas genervt die Antwort. Der Fremde, dem Andreas Schicksal nicht nur interessierte sondern auch berührte, spürte allerdings jetzt, dass es für ihn kostengünstiger wäre, an dieser Stelle das Telefonat zu beenden.