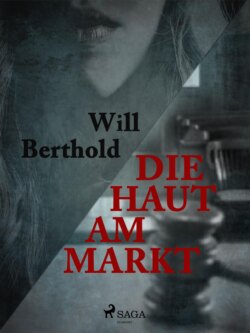Читать книгу Die Haut am Markt - Will Berthold - Страница 4
Prolog
ОглавлениеSodann hoffe ich bei meinem letzten Auftritt in der ersten Morgenblässe des kommenden Tages gut disponiert zu sein. Ich werde unschuldig sterben, aber zu Recht. Mit meinem Kopf fällt auch die Angst; selbst ein Fallbeil hat sein Gutes.
Mein Wartezimmer zwischen Prozeß und Prozedur ist in einem großen, wuchtigen Haus, das nach Moder und Masse riecht und seltsam verwaschen wirkt, gebleicht von Wind und Regen, jedoch von morscher Stabilität gegen Leid und Tränen. Ein Maison voll düsterer Tradition in einer verstaubten Vorstadtstraße, die sich wie ein spröder Gürtel um den vierschrötigen Leib dieses Gefängnisses schnallt, einer häßlichen Warze im Gesicht einer schönen Stadt. Rue de Santé, ein Stück Paris ganz ohne Charme, Sackgasse gemeiner Verbrecher, Schleuse armer Sünder, Ausflugsziel gieriger Bummelanten, die in der Nacht vor der Hinrichtung die benachbarten Bistros füllen wie die Arena eines Sechstagerennens und mit behaglichem Gruseln den gleichen Moment erwarten wie ich.
Mein Raum im weitläufigen Prison de Santé, dem Gefängnis, das so frivol den Namen der Gesundheit führt, ist das Sterbezimmer. Wer es verläßt, verliert sein Leben.
Die Zelle ist sauber, rechteckig, ein wenig größer als man erwarten würde. Sonst von üblicher Ausstattung: ein kleiner Tisch, ein hölzerner Schemel, eine eiserne Pritsche mit einer ganz ordentlichen Matratze, ein Kübel mit Patentverschluß, an den Wänden, in der Keilschrift der Messerspitze, kleine Zoten und verwehte Namen, an der Stirnseite, viel zu hoch gerückt, ein zu klein geratenes vergittertes Fenster, durch das Licht in das Halbdunkel fällt wie eine posthume Versuchung.
Zwölf Stunden noch. Vielleicht dehnen sie sich wie eine welke Liebesnacht, oder sie sind so schnell wie ein gerissenes Seil. Eines Tages Halbzeit: 720 Minuten Wechselgeld gibt mir mein Leben noch heraus, in kleiner, glühender Münze; dann ist es soweit.
Mit einem Bruchteil dieser Zeit könnte man vielleicht eine Frau erobern oder ein Vermögen verspielen, ein Buch lesen oder nach Übersee fliegen, eine Operation überleben oder eine Welt vernichten, ein Kind zeugen oder nur auf einem breiten Boulevard sitzen, inmitten brodelnden Lebens, auf den Champs-Elysées vielleicht, die von meinem Gefängnis nur ein paar Kilometer entfernt sind, könnte bei einem Apéritif im Zauberspiel des Lichtes und der Farben die Anmut bewundern und der Jugend nachsehen, das Leben spüren und den Wind kosten, Träumer des Tages und beschäftigte Müßiggänger, um bei dem nächsten Apéritif wieder zur Zeitung zu greifen, in der morgen in dem Jargon, der das Pathos anzieht, stehen wird: Heute vollzog sich im morgengrauen der letzte düstere akt im sensationellen fall der schönen, reichen, aber unglücklichen marcelled.
Vielleicht kann ich morgen Mut wenigstens mimen, wenn ich der makabren Maschine als letzter Novität meines schwindenden Lebens begegne: an Armen und Beinen auf ein flaches Brett geschnallt, über dem ein schwarzer Vorhang zittert, hinter dem sich der Tod versteckt, in einer letzten gähnenden Sekunde zwischen Exekution und Exitus: ein Wink des Direktors, ein Daumendruck des Scharfrichters, ein Ruck, den ich kaum mehr spüre – und alles ist vorbei.
So leicht macht das Fallbeil eines Menschen Sterben – oder so schwer.
Ich ende so logisch wie absurd, so schuldig wie schuldlos. Ich wußte nicht, wie man lebt, und so muß ich lernen, wie man stirbt. Aber vielleicht ist das Schlagwort vom savoir vivre ohnedies nur die keusch-kokette Umschreibung der Kunst des Sterbens, in der wir alle Schüler sind.
Keiner kann etwas dafür, daß ich morgen hingerichtet werde, keiner, es sei denn, ich selbst. Das hat seinen Grund, den ich hier mit einem einzigen Satz darlegen kann: Ohne Umweg folge ich einer Frau, die mich vergessen ließ, daß es noch andere gab. Es war das Übermaß eines Gefühls, das nicht mehr leben kann, weil es sich nicht erfüllen durfte.
Vor mir, auf dem rohen Holztisch, an dem ich schreibe, steht ihr Bild. Es lebt schon auf den ersten Blick von dem Kontrast aus Lebenslust und Schwermut, von der Gegensätzlichkeit jünger Augen zu melancholischen Lippen. Der Mund ist von einer verspielten Müdigkeit, als hätte er zuviel gesagt oder verschwiegen. Das Lächeln steht im Duell mit sich selbst; es fasziniert noch immer, auch wenn es zur Endgültigkeit geronnen ist. Eine Fotografie kann ja nichts anderes sein als ein Denkmal aus Papier – und dieses hier ist an den Rändern abgenutzt von den Fingerabdrücken der Sehnsucht.
Das Foto wird nicht mehr lange an diesem Platz vergilben. Morgen früh, danach, wird Marcelles Bild, zusammen mit einer Armbanduhr, einer Brieftasche und Manschettenknöpfen, in ein Stoffsäckchen wandern. Ab morgen werden meine persönlichen Utensilien als Asservate – so nennt man die Souvenirs der Strafjustiz – in einem verschlossenen Aktenraum verwahft, sauber geordnet auf großen Holzgestellen: überführende Indizien neben gesäuberten Mordwerkzeugen, sortiert, etikettiert und registriert wie der Versatz eines gängigen Leihhauses; schließlich handelt es sich bei diesem tödlichen Sortiment auch um die Pfandleihen verwirkten Lebens.
Ich habe das Bild Marcelles in den letzten Monaten so oft betrachtet, daß ich es mit geschlossenen Augen zeichnen könnte. Es besteht nur aus Kopf, der Kopf nur aus Augen. Es sind Augen, die das Leben lieben, helle Augen, klare Augen, Augen, deren Iris leicht zu moussieren schien, sooft Marcelle sich erregte, und dunkel wurde, wenn sie Furcht spürte.
Apropos Angst: Hier kauert sie in jedem Winkel, in jeder Zelle, hinter jeder Wand. Dieser dunklen Schattierung begegne ich, seitdem ich in diesen Flügel des düsteren Hauses eingezogen bin, in den Pupillen aller, die mich betrachten: der Mithäftlinge, die eines Tages das Gefängnis durch das Hauptportal wieder verlassen werden, mit eigener Kraft, und nicht wie ich in einer widerlichen Fichtenkiste verstohlen durch die Seitenpforte; in den Augen des Anstaltsgeistlichen, des Feigenblatts der Zivilisation bei einer Hinrichtung, der sich sicher gerade die passenden Worte für die morgige Gelegenheit zurechtlegt; in den Augen des Gefängnisdirektors, dessen Frau den. vom Protokoll des Fallbeils verlangten dunklen Anzug soeben aus dem Schrank hängt. Die Angst ist der unsichtbare, unheimliche Zaungast dieses steinernen Riesenkäfigs, in jeder Zelle zu Hause, in jedem Gang auf der Lauer – wenigstens in diesen Nächten davor, die der Henker aus Gründen der Zweckmäßigkeit bereits unter einem Dach mit seinem Opfer verbringt.
Jeder ringt mit dieser schleichenden, dauernden Furcht und dekuvriert, sie gerade dann, wenn er sie zu verbergen sucht. Denn jeder Blick und jeder Ton ist ein Hilferuf nach oben, die Art, in der auch der Areligiöse noch betet, sich unbewußt an den einzigen wendet, der die Angst nicht kennt, denn: Gott betet nicht.
Meine Zelle ist stickig-warm, aber ich fröstle, denn hier beginnt der Flur, der stets ungewaschen wirkt, so sehr man ihn auch schrubbt, und der in die Dunkelheit führt.
Wieder geht ein Wächter über den Gang, diesen Blinddarm des Lebens, und dämpft auf der Höhe meiner Zelle mechanisch den Schritt. Auch das ist symptomatisch für den Umgang mit mir. Es sieht so aus, als ob die Funktionäre des Santé sich der fatal-letalen Art meiner Bestrafung schämten.
Schließlich ist eine Hinrichtung auch für keinen der Beteiligten ein Vergnügen. Eine Exekution ist immer unwürdig und unmenschlich – das wußte ich längst, bevor ich im Prison de Santé zur Partei wurde.
Aber ich benutze meinen Fall keineswegs, um gegen die Todesstrafe zu polemisieren, obwohl ich im grauenden Morgen ihr Objekt bin. Sie hat sich nicht nur moralisch überlebt, sondern zudem auch noch praktisch als zwecklos entlarvt. Kein Mensch mit Kopf tritt heute ernsthaft für sie ein, was nicht ausschließt, daß in vielen Ländern weitergeköpft wird, und in anderen dieser schlicht-rohe Strafmodus wieder eingeführt werden soll – eine Forderung, die biedere Demagogen jeweils kurz vor den Wahlen vorbringen, wenn sie mit dem atavistischen Ressentiment der Masse auf die Addition der Stimmzettel spekulieren.
Daß meine Geschichte in Frankreich spielt, ist einer der vielen Zufälle, die sie mit Pikanterie würzen. Ich bin Deutscher, aber ich sterbe morgen in Paris, da auch Bonns Auswärtiges Amt nach Rückgabe der Akten die formaljuristische Korrektheit des Urteils nicht bestritten hat. In der Bundesrepublik gibt es keine Todesstrafe oder, besser gesagt: noch keine. Ausgerechnet in Frankreich, dem klassischen Land der Freiheit und des Fortschritts, wurde das Fallbeil noch nicht pensioniert, als könnte man sich hier, wo man die Guillotine erfand, von dem Relikt der Französischen Revolution noch nicht trennen.
Damit endet der theoretische Teil meiner Pathographie, dem sich morgen der praktische anschließt.
Morgen gäbe es nicht ohne Marcelle.
Sie war die berühmte Frau, der man nur einmal begegnet.
Der berühmte Gemeinplatz.
Aber Gemeinplätze können, wie mein Fall beweist, tödlich werden.
Marcelle war die Frau, die einem das Mitleid mit der eigenen Vergangenheit beibrachte und die gesammelten Erlebnisse eines halben Lebens wie wertlosen Ballast über Bord werfen ließ. Die Frau, deren Hände beruhigten und aufpeitschten. Die Frau, auf die man Durst hatte, während man trank; die von der Erotik die abgeschmackte Banalität wegwischte und einen Mann vergessen ließ, daß zur selben Zeit Hunderte oder Tausende das nämliche sagen oder tun, nach gleichem Modus, in verschiedenen Betten, als eine Art müden Gesellschaftssports, dessen Antrieb die Gewöhnung ist.
Mit Marcelle und mir war das alles ganz anders.
Marcelle war die Frau, die ich nicht verlieren wollte.
Mein Fall ist die Geschichte Marcelles, und vielleicht preist die Boulevardpresse, wenn erst alles überstanden ist, diese ihren Lesern als eine faszinierende und abscheuliche Story an oder als einen hinterhältigen, egozentrischen Liebesroman, freilich ohne die süße Langeweile dieser parfümierten, bestrumpften Produkte.
Das Rätsel dieses Falles aber könnte kein noch so findiger Reporter lösen. Deshalb hinterlasse ich mit diesem Manuskript mein Geständnis als Vermächtnis. Ein Freund soll nach meinem Tod über seine Verwendung befinden. –
Diesmal kommt ein Mann offen über den Gang. Laute Schritte, klare Schritte, Schritte mit der sauberen Sohle staatlicher Gerechtigkeit. Das meine ich keineswegs sarkastisch; denn an mir vollzieht sich ja kein Justizmord. Meine Richter konnten nicht anders handeln; sie haben in meinen Fall mehr Menschlichkeit investiert, als ihnen die Paragraphen vorschrieben.
Paragraphen sind aus Granit. Paragraphen sind wie Findlinge der Steinzeit im Leben der Neuzeit. Paragraphen sind seelenlos und kahl und zudem die einzigen Mörder, die kein Gewissen haben.
Alle, die mit diesen Taggespenstern des Rechts zu tun haben, beschworen mich, ein Gnadengesuch einzureichen: meine Richter, mein Anwalt, der Gefängnisdirektor, die Kriminalbeamten, selbst ein paar meiner Aufseher, die in ihren unbehauenen Gesichtern ihre schlichten Gefühle nicht verstekken können.
Ein Gesuch dieser Art wäre schon im voraus bewilligt gewesen.
Ich reichte es nicht ein.
Vielleicht bereue ich diesen Umstand in den nächsten Stunden wie nichts zuvor in meinem Leben.
Ich weigerte mich, um Gnade zu bitten, obwohl mir zum Helden der Exhibitionismus, zum Märtyrer der Fanatismus fehlt. Deshalb ist die Exekution von morgen ein halber Selbstmord mit fremder Hand.
Selbst das Urteil wäre ohne meine altruistische Mithilfe nicht zustande gekommen. Mir kam es auch nur darauf an, daß mein Mitangeklagter, der als Haupttäter verurteilt wurde, morgen den gleichen Weg gehen muß wie ich; vor mir, wie mir der Gefängnisdirektor versicherte.
Nur das wollte ich erreichen. Nicht der Richter hatte den Haupttäter verurteilt, sondern ich. Ich war ihm und mir gegenüber schärfer als der Staatsanwalt, als dessen Kronzeuge ich im übrigen fungierte; weshalb die Geschworenen mit ihrem Todesurteil die Empfehlung aussprachen, mich zu begnadigen. Dazu wäre aus formellen Gründen ein schriftlicher Antrag zu stellen gewesen. Da ich befürchtete, ein summarischer Gnadenerweis könnte auch den Haupttäter mit einbeziehen, wollte ich ganz sicher sein; sicher noch um den Preis meiner eigenen Vernichtung.
Ich habe Marcelle verloren. Er war daran schuld. Deshalb muß er die gemeinste Strafe erleiden, die es gibt – somit werde ich ihm morgen in die Todeskammer folgen, gestützt auf den Wahn, nach Marcelle nichts mehr verlieren zu können.
Deshalb hatte ich auch während der Verhandlung des Schwurgerichts befriedigt erlebt, wie seine hysterischen Anfälle mit Beruhigungsspritzen behandelt werden mußten. Ich stand neben ihm, sah unbeteiligt zu, wie er nach der Verkündung des Todesurteils zusammenbrach, so erfüllt von meinem Haß, daß ich mein eigenes Todesverdikt überhörte.
Noch jetzt, am Vorabend des Vollzugs, stehen zwischen diesem Mann und mir ein paar leere Zellen und dampfender Haß. Die Konsequenz heißt nunmehr: morgen früh um fünf oder sechs, im grauenden Tag, in feierlicher Prozession, über den düsteren Gang, in die Dunkelheit hinein.
Wieder kommen Schritte auf mich zu.
Dann steht der Mann in der Tür, der mir das Essen bringt, die legendäre Henkersmahlzeit. Kein Gänsebraten übrigens. Er betrachtet mich von unten herauf. Sein Mund wirkt wie ein schiefgetretener Absatz. Seine Augen sind auf der Flucht,
»Levez-vous«, sagt er, »faites place, s’il vous plaît.« Der Mann deutet auf die Schreibmaschine, die mir amtliche Gunst beließ.
Ich nehme die Zigaretten von dem Tablett und gebe dem Wächter einen Wink, alles andere wieder hinauszutragen.
»Nein«, protestiert er, »Sie essen das!« Seine Menschlichkeit ist derb. »Besser so für Sie«, setzt er hinzu, als hätte er es schon einmal erprobt.
»Für was?« frage ich.
Der Aufseher schüttelt den Kopf.
»Vielleicht bin ich gerade nicht in Stimmung«, antwortet er dann, »mit Ihnen einen längeren Plausch zu halten.«
Dann setzt er sich auf einen Hocker, schiebt seine Mütze nach hinten und zündet sich eine Zigarette an.
Um ihn nicht zu verärgern, nehme ich zögernd meine letzte Mahlzeit ein. Sie schmeckt nach Angst und Maggi.
»Sie muß man zu allem anschieben«, knurrt der Mann, »besser, man hätte Sie auch zum Gnadengesuch gezwungen.« Er steht auf, betrachtet den eingespannten Bogen in der Schreibmaschine. »Aus Ihnen werde ich nicht klug«, fährt er fort, »aber einen Dachschaden haben Sie in jedem Fall.« Der Aufseher tippt an seine Mütze. »Ich weiß schon, was Sie vorhaben.« Er wirft ohne Absicht meine Manuskripte durcheinander. »Das da.«
Er drückte seine »blaue Gauloise« aus, »Es soll einmal so ein Bursche eine Kirche angezündet haben, nur damit man auf ihn aufmerksam würde.«
»Ja«, antworte ich, »Herostratos, dreihundertsechsundfünfzig vor Christus. Es war übrigens keine Kirche, sondern ein Tempel.«
»Ihnen vergehen die Feinheiten auch noch«, versetzt der Wärter. Dann betrachtet er mich erschrocken. »Wenn Sie etwas wollen?« setzt er rasch hinzu.
Der Mann steht leicht vornübergebeugt, in der Pose eines Lauschers. Dabei ist es für ihn still. Er hat nicht das geschärfte Ohr des Delinquenten. Er hört nicht, wie sich in diesen Stunden in allen Ecken und Winkeln des Hauses die Spinnen in ihren Netzen rühren und krabbeln, krabbeln. Er hört nicht, wie die Balken knistern. Er kennt auch nicht die ächzende Diskretion des alten Gemäuers, diese geschwätzige Verschwiegenheit, die im Angesicht der Guillotine den Finger auf die Lippen preßt.
»Nerven haben Sie ja. Im Krieg dabeigewesen, was?«
»Ja«, entgegne ich, »vier Jahre.«
»Dreckskrieg!« brummt er, »aber für Sie vielleicht jetzt ganz gut.« Er mustert mich mit seinen lichtgrauen Augen. »Sind trainiert, wie?«
Ich nicke.
»Ihr Freund da drüben«, sagt er und spricht im Ton des Beamten, der als kleinen Gunstbeweis seine Pflicht verletzt, »ist nicht so in Form. Der Doktor war schon wieder bei ihm. Schreikrämpfe.«
Einen Moment fürchte ich, der Anfall könnte den Termin aufschieben.
Der Wärter deutet auf meine Schreibmaschine.
»Vielleicht doch besser«, sagt er, »da sind Sie wenigstens abgelenkt. Werden Sie fertig?« fragt er.
»Ja«, antworte ich.
»Ein Buch?« will der Mann weiter wissen.
»Ja.«
»Über Ihren Fall?«
»Ja.«
»Schade«, stellt er ehrlich fest, »das hätte ich gerne mit Widmung gehabt.« Er zuckt mit den Schultern und steht mit dem Tablett unter dem Arm in der Tür. »Der Pfarrer läßt fragen, ob er kommen soll«, sagt er noch. Seine Pupillen richten sich auf mich, starr und gezielt wie der Zwillingslauf einer Jagdflinte.
»Später«, erwidere ich.
Der Aufseher nickt. Er ist ein Fetischist der Ordnung, der staatlichen wie der himmlischen.
»Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten –«, sagt er beiläufig und schließt die Tür.
Ich bin wieder allein.
Mit mir.
Mit ihr.
Mit uns.
Mit Marcelle und mir, zu zweit und doch einsam.
Einsamkeit: das ist der stumpfsinnige Ausfluß eines defekten Wasserhahns, der dumme Tropfen, der den Stein höhlt. Einsamkeit schmeckt wie der Speichel im Mund, wie die eigenen Zähne. Einsamkeit ist wie ein gläserner Mantel, hinter dem man sich versteckt, ist vielleicht die letzte Romantik unserer Zeit, die einzige Intimsphäre, vor der die Technik versagt, es sei denn, man verschleuderte sie an den Bildschirm, an den dummen Tropfen also, der das Gehirn wäscht.
In der Todeszelle bevölkert sich diese Einsamkeit mit ungeladenen Gästen: mit Geräuschen und Gedanken, die auf abgegrasten Wegen dahinhasten, bis sie sich irgendwo im Sand die – Beine brechen und dann wie auf Prothesen weiterhumpeln, quer durch die Vergangenheit, wie blind durch dieses Labyrinth.
Wieder steht man an den Verkehrsknotenpunkten seines Lebens, stolpert in die gleichen Fallen, wird zu seinem eigenen Abziehbild. Nur erkennt man es plötzlich, sieht sich unförmig in einem Spiegel besonderer Art, aufgequollen, häßlich. Man stemmt sich dagegen – und wird doch wieder genauso arrogant, gierig, oberflächlich, laut, edel, töricht, so schlichtweg menschlich, wie man war.
So eine Todeszelle ist ein Treibhaus des Was Wäre, wenn …?
Sooft ich an den letzten Weg über den grauen Gang denke, spüre ich, daß Gedanken noch viel gemeiner sind als die Wirklichkeit. Die Phantasie steigert alles, hebt es in die dritte Dimension. Meine Gegenwehr: ich schreibe.
Vielleicht stößt sich der Leser daran, daß ich gelegentlich vom Thema abgleite – ich werde versuchen, dies ab jetzt zu vermeiden, so gut ich kann. Ich will auch larmoyantem Selbstmitleid nicht viel Platz geben. Sollte sich gelegentlich ein zynischer Unterton zwischen die Zeilen schmuggeln, so erinnere ich daran, daß ich dieses Manuskript in einer ganz besonderen Lage abschließe, in der angewandter Zynismus nichts anderes ist als geronnene Melancholie. Außerdem wird man verschroben, so man altert; in den Stunden vor dem Tod ist man immer ein Greis.
Auch schon im Alter von einundvierzig.
Hiermit bin ich bei meinen Personalien, die ich der Einfachheit halber gleich aus den Gerichtsakten zitiere:
Name: Kerbach, Vorname: Paul, Autorenname: Gerhard Nobis, Alter: 41, Staatsangehörigkeit: deutsch, Vorstrafen: fehlen.
Gezeugt, geboren, getauft, geimpft in München, Sohn des Beamten Martin Kerbach und seiner Frau Georgette, geborene Fabrizius, ordentliche Vermögensverhältnisse, keine Schulden, beide umgekommen beim Luftangriff vom 21. Dezember 1944.
Vier Jahre Volksschule, 1939 Abitur des humanistischen Gymnasiums, Einberufung zum Arbeitsdienst, Mitte 1940 Abstellung zur Wehrmacht, vorwiegend Infanterie, Fronteinsatz. Verwundet, ausgeheilt. Kriegsschule, Beförderung zum Leutnant. Einsatz im Osten, verwundet. Zusammen geflickt Wieder abgestellt. Rückzug von Kiew bis Berlin. Nach Kapitulation der Reichshauptstadt russische Gefangenschaft, zuletzt Offizierslager Workuta. Entlassen als Spätheimkehrer, im Regierungsdurchgangslager Friedland eingetroffen am 2. Mai 1948.
In der Heimat, in der Heimat, da gab’s ein Wiedersehn.
Wiedersehen mit dem Gymnasialdirektor Dr. Dr. Kleber: jetzt nicht mehr im Braunhemd, sondern im weißen; Mitarbeiter des Kultusministeriums, längst entnazifiziert und befördert; Unruhe im Blick, Pathos im Ton, elegisch bis unter die Stirnglatze.
»Ach Sie, Kerbach, na, alles gut überstanden? Freut mich für Sie. Wird schon werden. Nun hinein ins volle Leben!«
Früher sagte er: Hinaus an die Front; und er berauschte sich am süßen Tod für das Vaterland. Aber das kann er heute nur noch den Schülern der Unterstufe beibringen, nicht einem Kriegsabiturienten: wie mir, einem der vielen, deren freiwillige Meldung zum Barras er bewirkt hatte, und einem der wenigen, die trotzdem wieder gekommen waren.
»Sonst geht es gut?«
Seitenblick, Händedruck, Lächeln, Ironie.
»Werden die Demokratie aufbauen, was?«
Demokratie: Konstruktion stimmt. Fundament schief, hängt nach rechts. Wartet auf den nächsten Windstoß.
Wiedersehen mit dem Kreisleiter: sitzt für eine andere Partei im Landtag, hat Warschau zerstören helfen, jetzt christlich geworden, aber gleich laut geblieben.
Wiedersehen mit dem kleinen Auer, der auf seinen Prothesen gerade zur Nachuntersuchung humpelt, weil das Versorgungsamt anscheinend befürchtet, es könnten ihm wieder richtige Beine nachwachsen. Der Dank des Vaterlands, in Holz.
Wiedersehen mit den 131ern und den 175ern, mit der grünen Front und mit der braunen Bande.
Wiedersehen mit der neuen Wehrmacht, jetzt Bundeswehr, geführt von den alten Generälen, Spezialisten für verlorene Kriege, Generation militärischer Versager, die sich auf Moltke berief und vor Hitler kuschte, aber sein Ritterkreuz weiter trägt, wenn auch ohne Hakenkreuz; alter Stiefel, neue Richtung, heraus aus der gestrigen Misere, hinein in die neue Karriere: Kerls, wollt ihr denn ewig leben?
Bürger in Uniform jetzt, modulierter Stahlhelm, gereinigter Fragebogen, gesäuberter Lebenslauf, staatspolitische Umerziehung. Saum der freien Rede leicht gezähmt, Kreuzzuggesinnung sanft getönt, die Feinde von gestern Bundesgenossen von heute (teilweise). Man ist noch gefürchtet und schon wieder gefragt, lästig mitunter, führt leicht zu Mißverständnissen, atomare Sprengköpfe deutscher Mittelstreckenraketen stehen noch unter amerikanischem Verschluß. Wird sich geben, wie die dritte Strophe des Deutschlandlieds. Die gefährliche Irrlehre des Defätismus aus der Zeit zwischen den Kasernen ist längst vorbei.
Wiedersehen also mit der Heimat, mit fremden Menschen im eigenen Land. Wiedersehen mit dem Wunderbürger zwischen Hungerödem und Entfettungspille: ein Volk, ein Haus, ein Kühlschrank!
Früher Gauschulung, heute Weekend. Einst brauner Eintopf, jetzt internationales Schlemmerlokal. Früher Träume, heute Verdauungsbeschwerden. Sie glaubten vorübergehend an Gott und sparen auf Volksaktien. Christus predigte gegen die Gewalt; die Kirchenethik verbietet nicht unbedingt die Anwendung der H-Bombe im sittlichen Sinn. Politik interessiert nicht, oder man betrachtet sie gelegentlich im Spiegel – und wenn er nicht irrt, ist der Mann, der einst im Wahlkampf das Wègfaulen seiner Hände beschwor, falls sie wieder nach einem Gewehr griffen, heute Verteidigungsminister mit beiden Ellbogen.
Wiedersehen mit der Bildung. Neubeginn nach acht Jahren gestohlenen Lebens. Man studiert, um etwas zu werden. Immatrikulation an der Universität mit sechzehn Semestern Verspätung. Hohe Aula, große Worte. Aber die Alma mater überlegt einen Numerus clausus. Gilt jedoch nicht für Spätheimkehrer.
Student Kerbach stochert im Ballast europäischer Bildung, umgeben von neuen Korpsstudenten im Dünnbierrausch, hört Vorlesungen, Literaturgeschichte? Muß erst entnazifiziert werden! Theaterwissenschaft? Nur mit Lizenz des axnerikanischen Bühnen-Officers!
Kerbach als Werkstudent. Pressevolontär Kerbach, im Vorzimmer zweier Lizenzträger. Links: Erwin Schmidt, Anstand ohne Brillanz, früher Häftling im KZ. Rechts: Dr. Schonbach, Brillanz ohne Anstand, früher Leitartikler im Signal.
Reporter Kerbach schreibt lustlos über Kohlezuteilung, Zigarettenrationen und Quarkabschnitte. Ohnedies alles Käse. Dazwischen immer wieder der Fragebogen und der Lebenslauf, mit der Hand zu schreiben, bis zum Überdruß, Schönschreibübung der Zeit, von keinem ernst genommen und von allen verlangt.