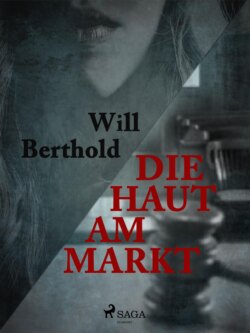Читать книгу Die Haut am Markt - Will Berthold - Страница 7
I
ОглавлениеSie stand da und sah aus wie eine steinerne Mänade, die lange Zeit im Wasser gelegen hatte. Statuen schweigen; sie aber redete mit gezacktem Mund. Die Vorstellung, diese zuckenden Lippen einmal geküßt zu haben, war absurd.
Sie war noch jung, aber das konnte man ihr nicht ansehen. Ihre Augen lagen tief, starr und dunkel in den Höhlen. Ihre Gesichtshaut schimmerte grünlich, ungesund. Sie sprach hektisch, giftig.
Ich zog mich wie immer stumm vor dem Wortschwall zurück.
In den letzten Wochen war wieder alles viel schlimmer geworden; deshalb setzte ich verzweifelt auf das Experiment, das ich für heute abend eingeleitet hatte. Sie sollte noch eine Chance haben.
Sie: damit meine ich nicht Marcelle, die ich damals noch gar nicht kannte, sondern Sybille, meine Frau.
»Ich bin ja nichts für dich«, rief sie, »ein Stück Holz höchstens!« Ihre Stimme schrubbte wie gegen ein Waschbrett. »Du hast mich auf dem Gewissen!«
Es ging weiter so. Wie jeden Tag. Ich hatte mich an diese Szenen schon so gewöhnt, daß ich mechanisch die Fenster schloß, wenn ich meine Wohnung betrat. Dann jeweils begann die Flucht vor Sybille – und meine Verfolgung.
»Keine Scham, kein Erbarmen«, tobte sie heiser, hysterisch. Sie sprach in zerfetzten Silben. Ihre Haare waren wirr. Sie hingen ihr ungepflegt in die Stirn bis zu den Augen, deren Pupillen trübe wirkten und seltsam nach innen gekehrt waren.
»Geh doch zu ihr« schrillte Sybille weiter, »du kommst ja doch nur, weil …«
Ich wich ihr noch weiter aus.
Sie folgte mir.
Ich zog mich in den Hintergrund unserer Wohnhalle zurück, ordnete sinnlos Zeitungen, sah mich hilflos nach Ablenkung um.
Der Raum hatte Stil und Geschmack; seine gekonnte Einrichtung war das Werk Sybilles, die über Sinn für Formen und Freude an Farben verfügt hatte.
»Du treibst dich mit ihr weiter herum. Überall bist du mit ihr anzutreffen, zu mir kommst du nur, wenn du etwas brauchst.« Sie trommelte mit den Fäusten gegen die Wand. »Aber diesmal werde ich Skandal machen!« Ihre Stimme überschlug sich und mündete in einen Weinkrampf. »Ich kann genauso gemein sein wie du.«
Ich ging in mein Schlafzimmer.
Ich fragte mich, wie lange ich Sybille noch ertragen könnte.
Ich mußte es.
Ich wollte es.
Ich war durch eine unheimliche Fessel für immer an Sybille gebunden: durch Mitleid, das drittstärkste Gefühl nach Liebe und Haß.
Ich kann Mitleid nicht leiden, aber Sybille hatte es nötig.
Sybille brauchte mich, aber sie haßte Mitleid.
Das war unsere Konstellation: ein Kreislauf im Leerlauf.
Ich packte hastig meine Sachen, denn ich mußte nach Paris fliegen. Sybille stand stumm im Türrahmen. Sie kam mit dünnen, schwankenden Schritten auf mich zu. Sie ging wie über ein Hochseil ohne Netz.
»Ich weiß, daß du mich nicht mehr magst. Daß du nur noch sie im Kopf hast.« Die keifende Stimme schwoll wieder an. »Du liebst Miggi, nur sie. Und dich.« Sie sprach zu schnell, mit zu hoher Stimme, im leiernden Tonfall, in der Art eines schläfrigen Kindes, das zu früh geweckt wird.
Ihre Worte schallten über die angrenzenden Villengrundstücke, aber auch unsere Nachbarn hatten sich längst an diese Auftritte gewöhnt. Nur die Kinder starrten gelegentlich noch zu uns herüber. Sie hatten es in letzter Zeit aufgegeben, nach Miggi zu fragen.
»Bitte, sei ruhig, Sybille«, sagte ich leise, vorsichtig.
Mein Koffer war gepackt. In ein, zwei Stunden begann das Experiment. Ich versuchte, die Unruhe vor mir zu unterschlagen. Sybille war schwer krank. Sie wußte es, aber sie wollte es nicht wahrhaben.
Aus der Karriere als Schauspielerin war nicht viel geworden. Seit der Geburt unserer Tochter Miggi hatte sich meine Frau in seltsamer Weise psychisch und physisch verändert. Zunächst fast unmerklich, mit langen Pausen der Erholung wie jähen Rückfällen. Sie war gereizt und nervös, sprunghaft und aggressiv, dann wieder unecht lebendig, wie aufgezogen, überdreht.
Sie ließ keinen Arzt an sich heran. Es war eine unbewußte Abwehr, eine Reminiszenz aus der Kindheit. Sybille hatte eine ganz andere Erklärung für ihre Erkrankung: Miggi war schuld, das Kind. Sie steigerte sich in Haß hinein. Die Anfälle wurden zuletzt so heftig, daß ich die Kleine in ein Internat geben mußte, um sie vor der eigenen Mutter zu schützen.
Von da ab besserte sich Sybilles Zustand merklich. Sie wirkte jetzt wie eine zwar früh gealterte, aber sonst normale Frau, die lediglich eine unweibliche Abneigung gegen Kinder hat und ihr Äußeres vernachlässigt.
Jetzt ging sie an mir vorbei, sie setzte sich auf eine Couch.
»Mußt du verreisen?« fragte sie.
»Ja, morgen, nach Paris.«
»Wirst du lange ausbleiben?«
»Höchstens drei, vier Tage«, erwiderte ich.
»Fährst du allein?« fragte Sybille.
»Ja. Das nächste Mal nehme ich dich mit«, antwortete ich hastig.
Sie zeigte sich einsichtig, betrachtete meinen Koffer, lächelte sogar; ihr Gesicht wurde jünger dabei.
»Das ist ja alles falsch«, stellte sie fest, exakt sprechend, nicht mehr wie aufgezogen. Sie nahm die Hemden wieder heraus, packte sie um. »Gib mir eine Zigarette«, bat sie dann. Sie setzte sich neben mich, lehnte sich in die Kissen zurück, schloß die Augen, als horchte sie in sich hinein.
»Es steht schlimm mit mir, nicht?« begann Sybille.
»Ja, Sybille«, entgegnete ich zögernd.
»Du solltest mich allein lassen«, fuhr sie fort, sah mich von der Seite an, ergänzte dann schnell: »Nein, ich meine nicht jetzt, sondern überhaupt.«
»Das kann und will ich nicht«, erwiderte ich.
»Du hast für mich genug getan«, antwortete sie, »ich weiß das ganz genau. Du bist ein anständiger Kerl – aber ich bin krank, ich erkenne das weit besser, als du denkst. Ich weiß auch, wie abscheulich ich bin, wenn diese Anfälle …«
Sybille war wie ein rührendes, hilfloses Kind. Ich durfte mir nicht einmal anmerken lassen, wie mich ihre Worte trafen. Ich versuchte, glaubhaft zu lügen.
»Es ist nicht so schlimm«, versetzte ich, wollte überzeugen, aber ich hörte, daß es kläglich klang.
»Doch«, erwiderte Sybille, »ich wollte schon lange mit dir darüber sprechen. Aber immer waren dann diese dummen Schmerzen im Kopf, na – du weißt schon.« Sie rückte näher an mich heran, suchte meine Augen. »Du mußt dich von mir trennen, Paul.«
»Nein«, sagte ich gepreßt.
»Doch«, fuhr sie mit Nachdruck fort, »nimm Miggi zu dir, ganz. Die Kleine soll nicht wissen, wie – wie krank ich bin.«
»Nein«, sagte ich abschließend; ich versuchte, fest auszusehen.
»Du wunderst dich vielleicht«, sagte sie, »du meinst, ich mag keine Kinder. Das hängt doch nur mit diesem Zustand zusammen. Früher war das alles ganz anders. Natürlich hänge ich an dem kleinen Gör wie jede andere Mutter.« Sybille sprach jetzt, als dozierte sie: »Man darf nicht egoistisch sein, wir zwei waren ja auch einmal Kinder und brauchten …« Sie stockte, sah mich dann voll an, setzte hinzu, als hätte sie es auswendig gelernt: »Und brauchten Liebe.« Ihre Augen wichen mir immer noch nicht aus. Ich wollte mich vor ihnen verstecken, als Sybille leise, aber deutlich hinzufügte: »Ich weiß, daß Miggi bei dir in guten Händen ist. Du hängst doch an ihr, nicht? Du mußt auch noch dafür sorgen, daß ich ihr nicht fehle.«
»Nein, Sybille«, sagte ich fest, »wir drei gehören zusammen.« Meine Worte standen auf sumpfigem Boden, über den ich vorsichtig, zögernd weiterging. »Es gäbe auch noch einen anderen Weg, Sybille.«
Wieder hatte sie die Augen eines Kindes. Die Iris wirkte groß und feucht.
»Fühlst du dich besser?« fragte ich.
Sie nickte willig. Ich spürte, wie sie sich anpassen wollte, als hätte sie etwas gutzumachen.
»Wenn ich jetzt aus Paris zurück bin«, fuhr ich fort und wagte fester aufzutreten, »habe ich viel Zeit für dich; wir gehen dann – zusammen, Sybille, begreifst du, zusammen – in ein Sanatorium und lassen unsere Nerven kurieren.«
Jetzt, dachte ich, jetzt!
Aber Sybille blieb ruhig, gelassen. Ihre Augen sahen durch das Fenster, als suchten sie ein fernes Ziel. Um ihren Mund spielte ein Lächeln, verbreitete sich wie ein Wellenring. Ihr Gesicht wirkte jetzt klar und aufgeräumt, wie der Himmel nach einem Gewitter.
»Wir beide, ganz allein«, drängte ich.
»Ja«, antwortete sie, »vielleicht würde es dir auch nicht schaden.«
Ich wagte mich noch weiter vor.
»Ich freue mich schon«, versetzte ich, »weißt du, wir suchen uns einen Platz mit viel Wald, einem See und vielleicht ein paar Bergen im Hintergrund. Es wird dann so wie damals, als wir heirateten.«
Sybille lächelte voll. Sie dachte angestrengt nach. Ich merkte, daß sie begann, an diese Zukunft zu glauben – und faßte selbst wieder etwas Hoffnung.
»Die Luft wird dir guttun. Du nimmst wieder etwas zu«, fuhr ich fort, »dann suchen wir uns einen Modesalon, kaufen ein und dann«, ich drehte sie an den Schultern leicht um, so daß sie mir ihr Gesicht ganz zuwandte, »dann sehen dir wieder alle nach – und ich werde es schwer mit meiner Eifersucht haben.«
»Ja«, entgegnete Sybille. Sie flüsterte fast.
»Keiner darf dir etwas tun, ich bin immer bei dir, auch – wenn dich der Arzt behandelt.«
Sybille blieb immer noch ruhig.
»Willst du?« fragte ich.
»Ja«, wiederholte sie. Sie fuhr mir mit der Hand durch die Haare. »Wenn ich wieder einmal Dummheiten machen sollte«, setzte sie dann hinzu, »nimmst du mich fest in den Arm.«
»Ja, immer«, entgegnete ich erleichtert.
Dann besprach Sybille Einzelheiten des Haushalts mit mir, kleine Dinge des Alltags. Ich legte den Arm um ihre Schultern, zog sie an mich; die glückliche Stimmung deutete ich als ein gutes Vorzeichen meines Experiments. Ich ließ sie los, als ob ich mich plötzlich an etwas erinnerte. Ich machte es schlecht, aber es fiel ihr nicht auf. »Du weißt doch« sagte ich, »Gerd fliegt für ein Jahr nach Amerika, zu einem Studienaufenthalt.« Ich betrachtete Sybille von der Seite, ihr Gesicht wirkte noch immer weich, gelöst.
»Stimmt, ja«, antwortete sie. »Wann fährt er denn?«
»In ein paar Tagen.«
Sybille kannte Rechtsanwalt Dr. Gerd Frey gut, er war der Freund, auf den ich mich verlassen konnte. Wir waren nebeneinander aufgewachsen, schon unsere Mütter hatten uns im Kinderwagen zusammen ausgefahren. Wir verprügelten die gleichen Nachbarskinder, küßten dieselben Mädchen und überlebten den nämlichen Krieg.
»Verabschiedet sich Gerd denn nicht von uns?«
»Doch. Heute abend«, entgegnete ich.
Sybille lächelte und nickte dabei.
»Du brauchst nicht zu erschrecken, er kommt erst nach Tisch. Aber«, ich fing ihren Blick auf und glaubte, daß ich weitergehen konnte, »eine dumme Sache, Sybille. Er hat einen Bekannten zu Besuch und wird ihn nicht los; er bat – daß er ihn mitbringen dürfe.«
»Warum nicht?«
»Gut«, entgegnete ich und verbarg meine Erleichterung. Gäste waren bei uns selten geworden; das Verhängnis, mit dem wir lebten, duldete keine Geselligkeit.
Gerds Begleiter war Professor Lex, eine Kapazität als Psychiater. Der Freund hatte mir geraten, ihn getarnt als Privatgast mit einer unbefangenen Sybille zusammenzubringen.
Sie zog sich um. Der Eifer spiegelte sich als leichte Röte in ihrem Gesicht. Sie sah gesünder und besser aus als sonst. Sie war auch noch in einer guten Verfassung, als unsere Gäste kamen.
Wir führten zu viert ein normales Gespräch. Gerd erzählte von seinen Amerika-Plänen; er hatte seinen Begleiter als Geschäftsfreund vorgestellt.
Professor Lex war groß, hager, mit auffällig gesunder Gesichtsfarbe und weißen, ganz kurz geschnittenen Haaren. Seine Diktion war knapp, sicher; seine Augen wirkten klug und kalt. Es war der Blick eines Mannes, der sein Leben lang mit Patienten zu tun hatte und deshalb alle Menschen musterte, als ob er nach ihrer Krankheit forschte.
Sybille legte eine Platte auf. Gerd und ich gingen in den Garten, um sie mit dem Professor allein zu lassen. Ich war unruhig. Gerd lenkte mich ab, so gut er konnte.
»Scheußlich«, sagte er, »aber es ist der einzige Weg, das weißt du so gut wie ich. Wir hätten schon längst …«
»Ja«, versetzte ich, »aber trotzdem. Gerade heute – sie ist so zutraulich, so arglos.«
Wir gingen in das Haus zurück. Zwischen Sybille und Professor Lex lief eine übliche Konversation. Er hatte offensichtlich seine Rolle gut gespielt. Wir saßen noch weiter zusammen, tranken Sekt, und da ganz plötzlich, ohne Anlaß oder Übergang geschah es.
Sybille verlor ihr Wort mitten im Satz, stand gehetzt auf und starrte mit wilden Augen um sich. Sie war gedrückt, verkrampft, ihr Teint wirkte fahl, sie atmete schwer.
»Sybille«, bat ich.
Sie fuhr heftig herum; ich erschrak vor ihrem Gesicht. Sie kam mir entgegen; sie streckte das Sektglas wie eine Waffe von sich.
»Du«, fauchte sie mich an, »du bist ein Schuft! Nicht nur ein Lügner, auch ein Betrüger!« Sie warf das Glas auf den Boden, faßte mit den Händen an ihre Schläfen. »Das hast du aus mir gemacht. Sieh dir’s doch an! Dein Werk! Du und Miggi habt aus mir eine Furie …!« Ihre Stimme zischte wie ein Schaumlöscher, als sie zu Professor Lex herumfuhr: »Sie sind Arzt! Meinen Sie, ich merke das nicht? Ich bin meinem Mann im Wege. Deshalb soll ich eingesperrt werden. Und Sie, Sie –«, ihre Lippen gluckerten wie ein Sumpfloch, »Sie übernehmen die kleine Gefälligkeit – und dann werden er und Miggi, die zwei, die mich am meisten hassen …«
Der Professor beugte sich leicht vor, in der Pose des Filmregisseurs, der sich die Muster des Vortages besieht.
»Sybille«, versuchte ich sie zu beruhigen. Ich suchte ihre Hand.
Sie stieß sie zurück. Sie spuckte die Worte aus wie bittere Tabletten.
»Ihr könnt mich in den Tod hetzen – aber nicht für verrückt erklären!« Sie riß sich los und stürzte hinaus. Ihre Stimme gellte durch das Haus. Die kurze Besserung war vorbei – das tägliche Martyrium setzte wieder ein.
Der Arzt nickte bedächtig, als hätte er es nicht anders erwartet. Gerd wollte mitkommen, um mir zu helfen, aber ich hielt ihn zurück.
Sybille hatte sich in ihr Schlafzimmer eingeschlossen, zunächst taub für Bitten wie Drohungen. Schließlich öffnete sie die Tür. Sie lag angezogen auf ihrem Bett, hatte die Hände hinter dem Kopf gekreuzt; sie starrte unverwandt zur Decke.
Ich setzte mich neben sie, versuchte, sie zu beruhigen. Sie hatte zum ersten Male den Verdacht ausgesprochen, daß ich sie in einem Nervensanatorium internieren wollte. Jetzt erst verstand ich, warum sie sich unbewußt gegen die ärztliche Behandlung gesträubt hatte: weil sie sich davor fürchtete.
Ich wollte es ihr ausreden, aber ich sprach gegen eine Wand, die nur das Echo meiner eigenen Worte zurückwarf. Sie mußte mir zuhören, aber sie begriff offensichtlich nichts: ihre Miene veränderte sich nicht. Aber schließlich stand sie auf, ohne mich zu beachten, nahm zwei Schlaftabletten und legte sich wieder hin. Ich löschte das Licht und wartete, bis sie eingeschlafen war.
Dann ging ich leise nach unten. Nur Gerd war noch da; er sah mir entgegen; hatte zuviel getrunken und wollte es verbergen.
»Der Professor erwartet dich morgen nachmittag«, sagte er dumpf.
»Hat er Sybille erschreckt, oder …?«
»Nein, bestimmt nicht. Sie unterhielten sich über Blumen im Garten. Professor Lex ist nicht nur eine wissenschaftliche Kapazität, sondern auch ein enormer Praktiker.«
Dann schwiegen wir beide. Keiner von uns hatte auf die vielen Fragen eine Antwort. Die Stille im Raum war ungut unwirklich.
Mitunter sind Gedanken lauter als Worte.