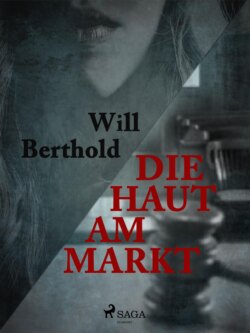Читать книгу Die Haut am Markt - Will Berthold - Страница 8
II
ОглавлениеIch hätte nicht erwartet, daß Professor Lex am nächsten Tag die gefürchtete Konsultation als gemütliche Plauderstunde eröffnen würde. Seine exklusive Praxis war im elften Stock eines Glas- und Betonpalastes, der sein Haupt wie ein Wahrzeichen zeitgemäßen Selbstbewußtseins hoch über den Dächern der Stadt trug.
Der Schreibtisch im Ordinationsraum stand schräg zwischen zwei Panoramascheiben, so daß der Arzt das Licht im Rücken hatte, das voll auf den eintretenden Besucher fiel. Der Raum war überheizt wie ein Treibhaus, fast kahl, gräßlich hell, aufdringlich sauber; die wenigen Möbel verbreiteten in dieser Hitze eine paradoxe Kälte: schwitzender Frost, dachte ich, das Betriebsklima eines gemütlosen Seeleningenieurs.
Der Professor kam mir entgegen. Er hatte die Hände in den Taschen seines Kittels und gab sich geschäftig.
»Ich bin ein alter Mann«, sagte er – es klang, als ob seine Stimme von einem Tonband käme, »ich brauche Wärme. Hoffentlich stört Sie die Temperatur nicht.«
»Nein«, erwiderte ich. Das Unbehagen spürte ich klebrig an den Händen.
Der Arzt wies mir einen Sessel an, in dem ich mir vorkam wie in einem Zahnarztstuhl, setzte sich in seinen Schattenwinkel und zündete sich eine Zigarette an.
»Ich hatte gerade einen interessanten Fall«, erzählte er. »Korsakoffsche Psychose, hoffnungslos –. Wissen Sie, Alkoholismus ist nicht nur ein Fachgebiet der Psychiatrie, sondern auch ein Spezialthema von mir. Apropos: kann ich Ihnen einen Kognak anbieten?«
»Bitte.«
Er holte zwei Gläser und eine Flasche aus der Schreibtischschublade, schenkte ein, trank mit verblüffender Schnelligkeit aus, füllte sich nach und lächelte sarkastisch.
»Es ist merkwürdig«, sagte er mit seiner knarrigen Stimme, »immer wenn ich so ein Alkoholwrack sehe, spüre ich ein Bedürfnis zu trinken.« Er stand auf und ging im Raum hin und her, mit großen, fast abgezirkelten Schritten. »Tja. Wir Psychiater gelten mitunter selbst als komisch. Sie kennen doch den Witz: Der Unterschied zwischen einem Irren und einem Arzt besteht darin, daß der eine die Gitterstäbe von innen, der andere sie von außen sieht.«
Er lachte heiser und goß den nächsten Kognak hinunter. Entweder ist mit Sybille überhaupt nichts los, dachte ich, oder es ist sehr schlimm. Ich haderte einen Moment mit Gerd, der mir diesen senilen Schwätzer als behandelnden Arzt eingeredet hatte.
Professor Lex setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, der überdimensioniert war, in der Proportion verzeichnet, wie alles in diesem Raum. Ich fuhr mit dem Handrücken über die Stirn. Der Arzt übersah es, dann räumte er die Flasche weg.
»Was Ihre Frau betrifft«, begann er ohne Übergang, »so bin ich ja von Doktor Frey einigermaßen informiert. Trotzdem muß ich Ihnen einige Fragen stellen. Wann fiel Ihnen zuerst die Veränderung ihres Benehmens auf?«
»Vor fünf, sechs Jahren«, antwortete ich.
Er blickte auf einen Zettel mit Notizen.
»Da war Ihre Frau also sechsundzwanzig?«
»Ja.«
»Dabei handelte es sich nur um temporäre Erscheinungen, sagen wir: Trübung auf Zeit?«
»Ja.«
Professor Lex sah durch mich hindurch, als wäre ich das Objekt seiner Demonstration und hinter mir säßen seine Studenten.
»Danach war der Zustand der Patientin wieder annähernd normal? Aber die Anfälle kamen wieder, in kürzeren Abständen?«
»Ja.«
»Wie die Szene, die ich gestern abend miterlebte?«
»Sie war die erste vor Zeugen.«
Er nickte, sah mich an, mit dem begütigenden Blick des Zahnarztes, der zum Bohrer greift.
»Selbstverständlich kann ich noch nichts Endgültiges sagen«, versetzte er, »doch steht für mich die Diagnose fest.«
Ich spürte mein Hemd am Körper. Ich sah sehnsüchtig zum Fenster hin, in einer Art, daß er es merken sollte.
»Ihre Frau ist eine schizoide Persönlichkeit«, sagte er sachlich, unterkühlt, »und zwar leider durch Veranlagung.«
Es war nicht mehr heiß, es war kalt, ich spürte die absurde Trockenheit schwitzender Haut.
»Kennen Sie die Familie?«
»Sybilles Vater ist im Krieg gefallen«, entgegnete ich widerwillig, »die Mutter starb kurz danach in einem Sanatorium. An Arteriosklerose, wie ich hörte. Ich habe mich nicht weiter erkundigt.«
»Aber ich«, versetzte der Professor hart. »Ihre Schwiegermutter ist zwar an Herzinfarkt gestorben, aber in einer psychiatrischen Krinik. Sie war dort wegen eines akuten Schubs von Katatonie interniert.«
Ich verstand es nicht, begriff nicht die desperate Endgültigkeit dieser Feststellung. Ich saß in meinem Zahnarztstuhl, dessen weiche Bequemlichkeit mich in dieser Situation anwiderte; ich wartete, bis die Spitze seines Bohrers den Nerv berührte. Plötzlich spürte ich die Zuckung. Auf einmal hatte ich begriffen. Schizophrenie. Wahnsinn. Vererbbar.
»Dann nehmen Sie also an«, es klang, als spräche ich mit vollem Mund, »daß Sybille an einer geistigen Störung leidet?«
»Mein Lieber«, erwiderte der Professor väterlich-überlegen, »was heißt geistiger Defekt in diesem neurotischen Zeitalter? Wir alle leiden an seelischen Störungen und tragen unsere Komplexe in den Aktentaschen mit uns. Eine psychiatrische Untersuchung ergab, daß in New York nur achtzehn Komma sechs Prozent der Bewohner geistig völlig gesund seien. Als Arzt sage ich Ihnen, daß sich gerade dieser Bruchteil, der sich total normal wähnt, aus den größten Narren addiert.«
Er lachte, stand auf dabei. Er spielt Kabarett auf meine Kosten, dachte ich und entschied mich endgültig für einen anderen Arzt.
»Schizoid in einer harmlosen Form sind wir vielleicht fast alle. Ihre Frau ist es in einem schon schlimmeren Stadium. Ich will Ihnen gar nicht verhehlen, daß es noch ärger werden kann. Ich darf mich allgemeinverständlich ausdrücken: Gewisse Symptome deuten auf eine Art Verfolgungswahn hin; das läßt auf eine Katatonie schließen.«
Im spontanen Reflex dachte ich nur an Abwehr: sag, was du willst, versperrte ich mich, es stimmt kein Wort! Du bist ein böser alter Mann mit einem Pferdekopf, der sich produzieren muß. Ich werde noch fünf Minuten Höflichkeit in diese psychologische Folterkammer investieren. Dann gehe ich stante pede zu einem anderen Arzt, der dich Zug um Zug, Wort für Wort widerlegen und deine wortreiche Eitelkeit seinerseits als pathologischen Geltungswahn entlarven wird.
»Das wiederum deutet auf eine bedenkliche Inklination zum Suicid hin; außerdem ließe sich vielleicht die Fremdgefährdung nicht ausschließen.«
Konjunktiv, dachte ich, Möglichkeitsform. Inklination: Neigung. Suicid: Selbstmord. So fein sind diese sterilen Unmenschen, so weit abstrahieren sie das Leid, daß sie es unter der wissenschaftlichen Halbwelt latinisierter Formeln ansiedeln.
»Ich bin ein alter Mann«, sagte er weiter, »es liegt mir nicht mehr, um einen Befund herumzureden. Ich bin der Diagnosen mit Zuckerguß müde. Zwar können wir mit Mitteln der modernen Medizin die äußere Erscheinungsform dieser Krankheit eindämmen: heilen können wir sie nicht.«
Er ging an das Fenster und sah hinaus. Ich zwang mich, in ihm einen Schauspieler in der Pose des Forschers zu sehen.
»Das ist der Konkurs der Wissenschaft. Wir können heute die Atomkraft freilegen, die Schallgeschwindigkeit überrunden und vielleicht auf den Mond fliegen, aber was die Therapie bei Katatonie betrifft, so sind wir nicht viel weiter als vor ein paar tausend Jahren. Der Unterschied besteht darin, daß man früher die Patienten aus Sicherheitsgründen einsperrte, während man sie heute bei den langen Intervallen zwischen den akuten Schüben dem normalen Leben eingliedern kann.«
Wie recht hat Sybille, überlegte ich, Ärzten auszuweichen, die aus einer Nervenkrise gleich ein Melodrama machen und am liebsten sofort mit Zwangsjacke und Gummizelle vorgingen.
Ich merkte, daß ich Professor Lex wieder zuhörte; ich spürte nebulos, daß auch ich schon begann, im Konjunktiv zu denken. Dann erfaßte mich der Schock eines Gedankens: Miggi. Nicht Herzinfarkt, dachte ich, Katatonie, vererbt auf Sybille, vermutlich vererbbar an Miggi. Es dauerte lange, bis ich die Frage stellen konnte.
»Meine Tochter?« unterbrach ich den Arzt mit blecherner Stimme.
»Da brauchen Sie keine Angst zu haben«, antwortete er. »Die Wahrscheinlichkeit einer Vererbung ist minimal; sie liegt statistisch etwa bei drei Prozent, wenn der andere Elternteil geistig gesund ist.«
Trost?
Nein, dachte ich, er nicht. Er ist zu kalt und zu alt, um den Takt aufzubringen, Wärme auch nur zu simulieren. Ich wollte mich gegen ihn sperren und mußte ihn doch fragen. Ich erschrak vor der hohlen Akustik des Raums.
»Was kann ich für Sybille tun?«
»Viel und wenig«, versetzte Dr. Lex; er fiel wieder in seine dozierende Manier.
Ich wußte wenig von Geisteskrankheiten; dabei hätte es bleiben sollen. Begriffe und Schlagworte purzelten durch mein Bewußtsein: paranoid, schizothym, circulär, manisch-depressiv – und dazwischen sah ich, umkreist und gehetzt, Sybille, die ich einmal geliebt hatte, die Mutter Miggis, der ich beistehen wollte, Sybille: nach der Meinung des Professors eine Dissimulantin, eine Gefahr für sich. Eine Gefahr für mich, für ihre ganze Umgebung.
Ich wollte nichts darüber hören und mußte doch alles wissen. So ging ich die Paradefälle des Professors durch: den berühmten Dirigenten, der vollkommen mit Seiner Krankengeschichte vertraut sei und sich freiwillig in die Klinik begebe, sobald er einen neuerlichen Schub befürchte, der dann nach Wochen oder Monaten entlassen, wieder am Dirigentenpult stehe, im Mittelpunkt begeisterter Ovationen. Professor Lex führte weitere Beispiele von Patienten an, die im Berufsleben zwischen den Anfällen außergewöhnlich tüchtig und doch hoffnungslos schizophren seien.
Nach seiner Meinung, die er als anfechtbar darstellte, sei es nötig, den Patienten rückhaltlos aufzuklären, an seine Krankheit zu gewöhnen, ihn mit ihr »auszusöhnen« und nach dem Schock Beruhigung in seiner Umwelt zu schaffen.
»Was übrigens die Behandlung Ihrer Frau betrifft«, sagte er, »so gäbe es zunächst weniger eine medizinische als eine psychologische Frage –« Er lächelte matt, ohne daß sich dabei der scharfe, sezierende Blick seiner Augen milderte. »Jetzt komme ich zu meinem nächsten Patienten. Das sind Sie.«
Ich wollte aufstehen und gehen, aber ich konnte mich nicht rühren. Ich sollte gleich erfahren, daß dieser seltsame Ordinationsraum bewußt als Treibhaus angelegt war, das die Gedanken und Reaktionen schneller wachsen ließ.
»Ihre Gefühle für mich treiben gegenwärtig dem Kulminationspunkt zu. Das ist die Basis, auf der wir uns verstehen werden. Unter Männern. Sie haben mich zunächst für einen Säufer, dann für einen Schwätzer, schließlich für einen Unmenschen gehalten; zuletzt wollten Sie direkt von hier weggehen, um einen anderen Psychiater zu konsultieren, der meine Diagnose umwerfen und mich als dummen Rechthaber entlarven sollte. Stimmt’s?«
Ich schwieg überrascht. Ich spürte, wie sich mein Rücken krümmte und ich mit verzweifelter Ironie darauf wartete, welche Geisteskrankheit diese Kapazität jetzt mir zuweisen würde.
Professor Lex stand auf, nahm die Brille ab und fuhr sich mit den Fingerspitzen in die Augenwinkel.
»Keine Angst«, sagte er, »Ihre Reaktionen sind völlig normal. Bevor ich in intime Bereiche vorstoße, muß ich die Erklärung vorausschicken, daß ich es unterließe, wenn ich Ihrem Freund, Doktor Frey, nicht sehr verbunden wäre. Für mich gibt es in Ihrem Fall nur eine Entscheidung.« Er setzte die Brille wieder auf und ging mit seinen abgezirkelten Schritten durch den Raum. »Wollen Sie bei Ihrer Frau bleiben – oder nicht?«
Ich gab ihm keine Antwort.
»Es hat keinen Sinn, sich an einer Lösung vorbeizudrücken, nur Um Zeit zu schinden. Ich mische mich in keiner Weise ein, das möchte ich betonen, aber fünfzig Jahre Erfahrung als Psychiater lassen mich sagen, daß ich mich an Ihrer Stelle von meiner Frau trennen würde.«
Ich war weit weg von Sybille. Der Sinn der Worte ging auch an mir vorbei. Ich war gebannt von der Härte und Kälte, die dieser Mann ausstrahlte.
»Es wäre das beste für die Patientin – und auch für Sie.«
»Sie können sich das ersparen. In einer solchen Situation ist es eine Frage des Anstands.«
»Genau das habe ich erwartet.« Der Ernst nahm seinen Worten den hämischen Beiklang. »Es ist der billigste Ausweg, sich im Glaskasten des Anstands auszustellen, als sein eigenes Denkmal, sich als edlen Mann zu feiern, der selbstlos neben seiner kranken Frau aushält und so nebenbei die schaudernde Bewunderung seiner Umwelt auf sich zieht.«
»Können wir nicht sachlich bleiben, Herr Professor?« unterbrach ich ihn gereizt.
»Ich bin sechsundsiebzig«, erwiderte er schroff, »lassen Sie mich daher bitte ausreden. Auf der Rückseite dieses Glashauses steht etwas ganz anderes. Sie sind tüchtig, erfolgreich, viel unterwegs. Sie kommen fast nie nach Hause. Sie sind immer allein. Oder fast immer. Sie sind erst vierzig, und Sie sind – kein Mönch. So haben Sie eine Begleiterin, später eine zweite – und so weiter. Zunächst sind Sie noch sehr vorsichtig, aus Rücksicht auf Ihre kranke Frau. Dann wird die Fürsorge lästig – die man nach Meinung des Facharztes ohnedies einer gelernten Krankenpflegerin überlassen sollte, so man sie sich leisten kann. Soweit ganz schön«, unterbrach sich der Professor, blieb stehen, beugte sich zu mir herab. »Aber was ist daran eigentlich so anständig?«
»Ich habe das nicht behauptet.«
»Ich weiß. Wir sprechen rein hypothetisch. Aber eines Tages muß unser Vielbeschäftigter doch wieder nach Hause – und da hängt vielleicht seine Frau, die Patientin, am Fensterkreuz, tot – kapiert?«
Bevor ich etwas sagen konnte, schnitt er mir den Einwand ab.
»Ich will gar kein solcher Pessimist sein. Der Selbstmord ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern nur eine Möglichkeit. Aber eines Tages wird unser edler Freund müde der ewigen Ausreden. Er gibt auf. Er verläßt die Kranke endgültig.«
Der Arzt nahm eine Zigarette, er sprach weiter, ohne sie anzuzünden.
»Oder es kommt die berühmte Frau, der man nur einmal begegnet. Vielleicht hat unser Freund Glück, und es stimmt sogar. Jetzt kommt die große Liebe auf dem Zenit des Lebens, das gereifte Gefühl. Was dann?« fragte er hart. »Spätestens jetzt läßt dieser Mann seine Frau fallen, zertrümmert endlich das Glashaus seines Anstands, wirft die Scherben weg – und jetzt spreche ich als Arzt: dann wäre die Chance, die Patientin soweit wie möglich einem geregelten Alltag einzugliedern, bedeutend kleiner. Jetzt käme zu der Erkrankung eine zusätzliche Enttäuschung.«
»Das kann sein«, entgegnete ich, »aber wenn es nun nicht so wäre? Wenn unser Mann sich so benähme, wie es sich gehört?«
»Dann wäre er ein Held oder ein Heiliger«, versetzte Professor Lex. »Er hätte meine volle Bewunderung.« Er lächelte knapp, rasch. »Ich meine das, wie ich es sage – aber er wäre der erste, den ich in meiner Praxis kennenlernen würde.«
Er ging an seinen Schreibtisch, lehnte sich in den Stuhl zurück. Der schroffe Ausdručk seines Gesichts löste sich. Er sah müde aus, aber menschlich.
»Es war zuviel für Sie heute«, sagte er, »das weiß ich sehr wohl. In welcher Verfassung war unsere Patientin heute morgen?«
»Ganz normal«, antwortete ich.
»Gut«, versetzte er. »Der Zwischenfall von gestern abend war für mich das Vorzeichen eines Schubs. Er kann in drei Tagen einsetzen oder in zwei Jahren. Wann immer sich der Zustand verschlechtert, rufen Sie sofort einen Nervenarzt.« Er sprach jetzt leise, als sollte mich wenigstens seine Stimme schonen. »Sie sagen selbstverständlich Ihrer Frau nichts von meiner Diagnose. Wenn Sie wollen, empfehle ich Ihnen einen anderen Arzt. Sie sollten jetzt ein paar Tage wegfahren und in Ruhe über alles nachdenken. Ich hätte Sie besser schonen sollen. Halten Sie mich nicht für hart und unmenschlich«, sagte er, als schämte er sich seiner Worte, »aber ich hasse Phrasen und Lügen. Nichts ist bei einem solchen Krankheitsbild gefährlicher als falsche Menschlichkeit.«
Er stand auf, reichte mir die Hand.
»Lassen Sie sich Zeit. Welchen Entschluß Sie auch immer fassen, teilen Sie ihn mir mit.« Fast melancholisch setzte er hinzu: »Wir Psychiater haben in der Regel mit den Angehörigen größere Schwierigkeiten als mit den Patienten selbst. So muß ich nicht nur Ihre Frau behandeln, sondern auch Sie.«
Ich stand vor dem Lift und vergaß, auf den Knopf zu drükken. Ich ging zu Fuß. Die Treppe war endlos. Mit jeder Stufe spürte ich deutlicher, daß der Professor recht hatte, daß hinter seiner Kälte Güte – und hinter seiner Güte Wissen stand.
Aber seine Diagnose mußte falsch sein, schon im Miggis willen.