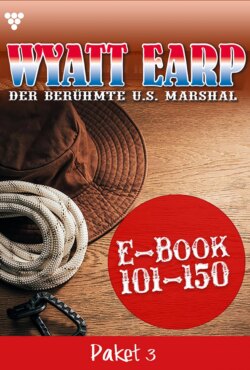Читать книгу Wyatt Earp Paket 3 – Western - William Mark D. - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMorgens klopfte es an die Tür Wyatt Earps. Es war Reverend John Walker, der Hausherr. Er sah den Marshal und Doc Holliday am Fenster stehen und die Straße durch die Gardine beobachten.
»Guten Morgen«, grüßte er.
Die beiden erwiderten seinen Gruß.
»Glauben Sie immer noch, daß etwas an Ihrer Vermutung ist?« forschte der Geistliche.
Der Marshal zog die Schultern hoch und wandte den Blick nicht von der Straße.
»Das ist schwer zu sagen, Rev, wir müssen Geduld haben.«
»Ich muß gestehen, daß Sie sehr viel Geduld haben, Marshal.«
»Sie können überzeugt sein, Rev, daß ich früher sehr viel weniger geduldig war. Im Gegenteil, ich war sogar ein ziemlich unruhiger Bursche. Aber die Zeit hat mich gelehrt, Geduld zu üben. Ich habe das Warten bei den Indianern gelernt. Der alte Häuptling Rote Wolke hat einmal gesagt: Wer nicht warten kann, kann gar nichts. – Früher habe ich über diesen Satz gelächelt. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich ihn richtig begriffen hatte.«
Der Geistliche blieb hinter den beiden stehen und blickte an ihnen vorbei auf die Straße hinunter.
»Es ist alles still in der Stadt. Ich habe nichts dagegen, daß Sie noch hier sind. Aber ich glaube, Sie vergeuden Ihre kostbare Zeit. Vielleicht braut sich inzwischen in einer anderen Stadt etwas zusammen, und Sie stehen hier bloß herum.«
»Das ist unser Risiko«, entgegnete der Marshal.
»Und wie lange gedenken Sie noch auszuharren?«
Da wandte der Missourier den Kopf.
John Walker blickte in ein hartes, tiefbraunes, markant gemeißeltes Männerantlitz, das von zwei dunkelblauen Augen beherrscht wurde.
In den Winkeln dieser gutgeschnittenen Augen saß ein kleines Lächeln.
»Diese Frage ist schwer zu beantworten, Rex. Bis jetzt habe ich es meistens gefühlt, wenn es Zeit war, aufzubrechen.«
Walker nickte. »Gut, dann will ich nicht schwächer sein als Sie und werde mich auch in Geduld zu fassen versuchen.«
Er ließ die beiden Männer wieder allein.
*
Die Galgenmänner hatten in Marana nicht zugeschlagen. Offensichtlich hatte die Bande nach der Niederlage in Casa Grande Lunte gerochen. Vergebens hatte der Marshal Earp auf den Big Boß gewartet. Die Banditen, die das Depot in Marana hatten sprengen wollen, waren kleine Tramps aus der Tombstoner Gegend gewesen, die sich die grauen Gesichtstücher der Galgenmänner hatten zunutze machen wollen.
War der Weg hinauf zum Roten See also umsonst gewesen? War das, was Wyatt Earp und Doc Holliday dort erfahren hatten, doch nicht so wertvoll gewesen, wie der Missourier zunächst angenommen hatte?
Hatte Wyatt Earp doch allen Grund zu der Annahme gehabt, daß er nun endlich den so lange gejagten Anführer der Graugesichter stellen konnte. Am Roten See war beschlossen worden, daß nach dem Überfall der Arizona-Bank in Casa Grande eine Elitegruppe der »Galgenmänner« den großen Coup landen sollte. Und diese Gruppe wollte der Big Boß selbst anführen.
Wyatt Earp vermochte nicht daran zu glauben, daß die Galgenmänner ihren Plan nun aufgeben würden. Der große Coup würde noch kommen, wenn auch nicht zu dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt.
Die Bande würde auf diesen Coup nicht verzichten. Die Tatsache, daß sie in Casa Grande aufgehalten worden waren, bedeutete für eine so große Verbrecherorganisation noch nicht allzuviel. Schon deshalb nicht, weil es ja nur untergeordnete Bandenmitglieder waren, die den Überfall durchgeführt hatten.
War es aber Marana, das dem Big Boß ins Auge stach? Oder hatte Wyatt Earp sich verrechnet? Plante der geheimnisvolle Chief der Graugesichter seinen Coup irgendwo anders zu landen?
In den beiden vergangenen Tagen hatte sich der Marshal immer wieder Gedanken über diese brennende Frage gemacht. Wo konnte die Bande zuschlagen? Eigentlich in jeder Stadt, denn in jeder Stadt gab’s eine Bank. Aber wenn der Anführer der Bande selbst mit dabei war, wenn er den Überfall zu leiten gedachte, dann konnte es keine gewöhnliche Bande sein, auf der nur zwei-, drei-, oder nur höchstens sieben- oder achttausend Dollar zu holen waren.
Hier in Marana aber lag das große Railway-Depot, vermutlich mit einer ganz beachtlichen Summe schöner blanker Dollars, die den Graugesichtern den persönlichen Einsatz ihres besten Mannes wert sein mochte. Aber leider war das ja nur eine Vermutung. Ebensogut konnte der Überfall irgendwo anders stattfinden.
Beispielsweise in Gila Bend, wo die große Cow-Bank war, auf der sehr viele Rancher ihr Herdengeld zu hinterlegen pflegten. Aber Wyatt hielt es nicht für sehr wahrscheinlich, daß die Graugesichter sich Gila Bend auserkoren hatten. Zu dieser späten Jahreszeit war nicht damit zu rechnen, daß sich eine bedeutende Geldsumme auf der Cow-Bank befand. Ebenso stand es mit der Military-Bank in Phoenix. Und die Western Union-Bank in Chandler hatte auch längst nicht mehr die Geldvorräte, die sie in den Jahren unmittelbar nach dem Kriege einmal besessen hatte.
So blieb eigentlich nur Marana in der näheren Umgebung.
Zweifellos mußten die Graugesichter von dem unsinnigen Versuch der Tramps gehört haben, einen Angriff auf das Marana-Depot zu machen. Damit verbunden war der Name Wyatt Earp, da der Marshal diesen Versuch vereitelt hatte.
Aber würde diese Tatsache nicht gerade in dem Verbrecherhirn des Big Boß den Gedanken auslösen: Jetzt ist es besonders günstig, denn wer wird auf den Gedanken kommen, daß gleich nach diesem gescheiterten Überfall ein zweiter ausgeführt wird?
Das war der Gedanke, der den Marshal seit zwei Tagen beschäftigte.
Am hellichten Nachmittag hatte er zusammen mit Doc Holliday die Stadt verlassen, um mitten in der Nacht zurückzukommen. Wenn die Bande wirklich einen Überfall auf das Railway-Depot plante, dann war es widersinnig, irgendwo in der Nähe zu warten. In diesem Fall mußte der Marshal an Ort und Stelle sein, um rechtzeitig eingreifen zu können.
Aber inzwischen waren zwei Tage verstrichen, ohne daß sich irgend etwas ereignete. Die beiden Dodger hatten sich bei dem Reverend von Marana einquartiert.
Anfangs war Mr. Walker von dem Gedanken nicht begeistert gewesen, als er sich aber näher damit beschäftigt hatte, sah er die Notwendigkeit ein. Schließlich war es ja seine Stadt, deren Wohl und Wehe auf dem Spiel stand. Und letztlich hatte der Name des berühmten Dodger Marshals doch einen so guten Klang, daß auch der Gottesmann seine Hilfe nicht versagen konnte. So hatte er die beiden Männer denn aufgenommen und oben bei sich im Hause untergebracht.
Ihre Hengste standen in dem kleinen Stall des Priesters und wurden von dem alten Neger Samuel versorgt. Der Schwarze war eine treue Seele, und der Reverend versicherte, daß man sich auf ihn verlassen könne wie auf sich selbst.
Niemand außer diesen beiden Menschen wußte, daß der Marshal Earp in Marana weilte.
Infolge der nun schon zwei Tage dauernden unablässigen Beobachtung der Straße kannten die beiden Männer schon fast jedes Gesicht, so daß ihnen ein Fremder schon auffallen mußte.
Und der Mann, der soeben auf einem grauschwarzen Wallach von Westen her in die Stadt kam, war ein Fremder.
Es war ein mittelgroßer knorriger Mensch mit hagerem, scharfem Gesicht und gebogener Nase.
Er trug braunes Lederzeug, darüber einen Waffengurt und darin tief über dem linken Oberschenkel einen schweren Revolver, in dessen Knauf ein weißes Dreieck eingelassen war.
Es war der Spieler, der diese Entdeckung machte, während der Marshal noch das Gesicht des Reiters durchforschte.
»Sehen Sie sich mal die Kanone an, Marshal.«
Wyatt Earp kam dieser Aufforderung nach. Er stieß einen leisen Pfiff durch die Zähne. »Zounds! Ein Dreieck.«
»Das will vielleicht weiter nichts bedeuten«, entgegnete der Spieler, »aber ich bin doch verdammt mißtrauisch gegen diese Dinger geworden.«
Der Marshal nickte.
»Ich kannte mal einen Mann, der ließ sich in seinem Revolverknauf einen Punkt machen. Ein anderer machte zwei Punkte hinein und ein dritter einen Strick. So kann sich dieser Mann hier ein Dreieck eingravieren lassen. Dann kannte ich auch einen Rancher, der überall das Zeichen seiner Ranch aufprägen ließ, auf dem Sattel, auf den Stiefelschäften, auf dem Waffengurt und überall, sogar auf dem Revolverknauf. Es war ein großes S. Der Anfangsbuchstabe seines Namens: Salinger.«
»Ja, ich erinnere mich an ihn. Es war James Salinger oben in Nebraska«, sagte der Spieler.
»Richtig. Ebenso kann dieser Mann zu einer Ranch gehören, deren Brandzeichen das Dreieck ist.«
»Natürlich, und der Bursche sieht ja auch ganz wie ein Weidereiter aus.«
Dennoch behielten die beiden ihn im Auge.
Der Reiter brachte sein Pferd vor der Schenke an, in der Wyatt Earp und Doc Holliday vor zwei Tagen von den Tramps überrascht worden waren, und rutschte aus dem Sattel.
Die Wirtsleute, die sich gegen den Marshal gestellt hatten, saßen mit den Banditen noch im Jail. Und der Saloon war geschlossen.
»Er wird ein paar Schritte weitergehen müssen«, meinte der Spieler.
Und das geschah auch. Der Reiter hatte von der Straße aus die nächste Schenke erspäht, die drüben an der Ecke lag.
»Schade, daß wir jetzt nicht hinuntergehen können«, meinte der Spieler.
»Ja, das ist schade, aber das würde unseren genauen Plan vereiteln. Niemand weiß, daß wir in der Stadt sind. Nur so haben wir eine Chance, daß sich die Banditen zeigen.«
Nach anderthalb Stunden erst kam der Mann wieder aus der Schenke heraus.
Er blieb einen Augenblick auf dem Vorbau stehen, und die beiden Beobachter sahen, daß er auf ihre Straßenseite blickte. Und zwar nicht auf das kleine, etwas zurückliegende Haus des Reverenden, sondern auf das Depot der Railway, das zwei Häuser weiter rechts lag.
Die beiden Dodger blickten einander verblüfft an.
Dann meinte der Spieler: »Ich verpflichte mich, den nächsten Heiratsantrag von Laura Higgins anzunehmen, wenn das nicht ein Galgenmann ist.«
»Ja, das sieht ganz so aus«, entgegnete der Marshal. »Aber was den Heiratsantrag der schönen Laura anbetrifft – ich werde Sie daran erinnern.«
Der Mann unten hatte indessen seinen Blick von dem Depot gelöst und verließ den Vorbau, um sich in den Sattel seines Wallachs zu ziehen. Langsam ritt er aus der Mainstreet hinaus nach Westen.
»Am liebsten würde ich dem Kerl folgen.« Der Marshal schob sich eine seiner langen schwarzen Zigarren zwischen die ebenmäßig gewachsenen weißen Zähne und riß unter der Fensterbank ein Zündholz an. »Ich habe das Gefühl, daß unsere Wartezeit vorbei ist, Doc.«
»Ja, das Gefühl habe ich auch.«
Es war noch keine Dreiviertelstunde vergangen, als wieder ein Fremder drüben vor der Schenke hielt. Es war ein großer dunkelgesichtiger Mann, der einen breitrandigen schwarzen, mit weißen Zacken abgesteppten Sombrero trug, einen schwarzen Anzug und ein weißes Rüschenhemd. Er mochte vierzig Jahre alt sein, hatte ein gutgeschnittenes Gesicht, und unter der breiten Krempe seines Hutes blickte blau-schwarzes Haar hervor. Er ritt einen hochbeinigen braunen Hengst mit heller Mähne, der mexikanisch aufgeschirrt war. Leuchtendrot und mit gelben Punkten besetzt war die Satteldecke.
Die beiden Dodger hatten ihn stumm beobachtet.
»Ein Mexikaner«, meinte der Marshal jetzt.
Der Reiter war unterdessen abgestiegen, warf die Zügelleinen um den Querholm und betrat den Vorbau. Wie sein Vorgänger ging er auf die geschlossene Schenke zu, dann sah er sich nach allen Seiten um.
Aber er ging nicht in die Eckschenke wie der Cowboy vor ihm. Er blieb stehen, lehnte sich an einen dicken Vorbaupfeiler – und starrte auf das Depot hinüber.
»Scheint eine unheimliche Anziehungskraft zu haben, der Laden da nebenan«, fand der Spieler. »Der Junge kann sich gar nicht von dem Anblick losreißen.«
Aber der »Junge« riß sich von dem Anblick endlich doch los. Er zog sich den Hut ins Gesicht, schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen und verließ den Vorbau.
Sehr langsam zog er sich in den Sattel und ritt weiter die Straße hinauf.
Nach wenigen Minuten kam er zurück und verließ die Stadt in der gleichen Richtung, aus der er gekommen war.
Sollte auch das ein Zufall gewesen sein?
Natürlich konnte es ein Zufall gewesen sein. Der Mann konnte aus mancherlei Grund in die Stadt gekommen sein und hatte sie wieder verlassen, ebenso der Reiter vor ihm.
Während die beiden Dodger noch darüber nachgrübelten, kam drüben links aus der in die Mainstreet mündenden Seitenstraße ein Reiter. Er preschte um die Ecke, sprang aus dem Sattel und warf seine Zügelleine um die Halfterstange. Dann reckte er sich und nahm den Hut ab, um den Staub herauszuklopfen.
Es war ein stämmiger Bursche, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt, groß, mit breiten Schultern und klobigen Händen. Er trug einen grauen Hut mit großen Schweißflecken, einen grauen, mit Flicken besetzten Anzug und ein verwaschenes blaues Hemd. Die Schöße der Jacke bauschten sich dort, wo er zwei große Revolver trug.
Langsam schlenderte er über die Straße vorwärts am Haus des Reverenden und am Generalstore vorbei. Drüben an der Ecke vor der Schenke blieb er stehen und tat, als besichtigte er da ein Pferd. Und es war ein unbedeutender Rotschimmel, der ganz sicher keine Betrachtung wert war. Der Mann stellte sich hinter ihn und blickte über seine Kruppe auf die andere Straßenseite.
Auf das Railway-Depot!
Der Gambler hatte die Arme über der Brust gekreuzt und stützte das Kinn in die Linke.
»Jetzt wird’s wirklich interessant hier. Unser Logenplatz ist gut und gern seine fünf Dollar wert.«
Der Marshal schob seine Zigarre vom rechten Mundwinkel in den linken und entgegnete: »Ich weiß nicht recht. Vielleicht täuschen wir uns. Wahrscheinlich ist es so, daß das Railway-Depot die Blicke der Leute, die in die Stadt kommen, unwillkürlich auf sich zieht. Hintereinander kommen drei Fremde nach Marana, und alle drei blicken dann auf die Bank. Glauben Sie etwa, daß sich die Elitetruppe der Graugesichter aus Leuten zusammensetzt, die einfältig genug sind, ausgerechnet das Haus anzustarren, das sie zu überfallen gedenken?«
Holliday nickte. »Weshalb nicht? Die Burschen sind doch überzeugt, daß sie völlig unauffällig handeln. Wer achtet schon auf einen Mann, der sich hier in der Stadt umsieht? Und besonders auffällig benehmen sie sich schließlich nicht.«
»Das stimmt auch wieder.«
In diesem Augenblick machten sie eine merkwürdige Feststellung. Der Bursche hatte sich an die Vorbaukante gelehnt und zog aus seiner Jackentasche einen Notizblock und einen Bleistift.
»He, der notiert sich etwas«, meinte der Spieler.
»Nein, der Mann zeichnet sich etwas auf.«
Der Bursche kritzelte eine ganze Weile auf dem weißen Papier herum, schob es dann in die Tasche zurück. Er zog sich in den Sattel und ritt durch die Gasse, durch die er gekommen war, davon.
Holliday schob beide Hände in die Hosentaschen.
»Jetzt sind Sie dran!«
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Die Geschichte gefällt mir nicht, Doc. Das ist doch ein Theateraufzug, direkt für uns einstudiert. Drei Leute kommen und stellen sich genauso, daß wir sie beobachten können.«
»Aber ich bitte Sie, wir sitzen doch so, daß wir jeden beobachten können, der sich das Depot ansehen will.«
»Trotzdem – es ist mir zu dick aufgetragen.«
Holliday mußte zugeben, daß auch ihm die Sache nicht gefiel. Aber andererseits wußte doch niemand außer dem Reverend und seinem schwarzen Diener, daß sie beide in Marana waren.
Oder hatte einer der beiden geredet?
Wyatt Earp verließ sofort das Zimmer und ging hinunter in den Flur.
Der Schwarze kam ihm aus der Küche entgegen.
»Sam, haben Sie mit irgend jemandem über uns gesprochen?«
Der Neger schüttelte den Kopf.
»Nein, Mr. Earp, das würde ich mir nie erlauben. Der Reverend hat mir verboten, darüber zu sprechen.«
»Sie sind also fest davon überzeugt, daß niemand weiß, daß wir uns in der Stadt aufhalten?«
»Ja, ich bin fest davon überzeugt, Mr. Earp.«
Als der Marshal sein Zimmer wieder betrat, sah er den Spieler in angespannter Haltung am Fenster stehen. Holliday winkte ihm mit der Linken zu.
»Rasch, kommen Sie!«
Wyatt trat eilig neben den Gefährten ans Fenster.
»Fällt Ihnen etwas auf?«
Wyatt hatte das gewohnte Straßenbild mit einem kurzen Blick überflogen. »Ja, der Planwagen drüben.«
»Er ist eben gekommen. Sie hatten gerade die Tür hinter sich zugemacht. Ein Mann stieg vom Kutschbock und verschwand drüben in der Kneipe an der Ecke. Er hat die Zugstränge der beiden Pferde ausgehakt…«
»Das läßt darauf schließen, daß er eine Weile zu bleiben gedenkt.«
»Ja, und nun sehen Sie sich mal die beiden Buchstaben auf der Plane an.«
»Ein O und ein B.«
»Ja, und nun beobachten Sie das B einmal genau. Und zwar die Stelle, wo die beiden B-Bögen in der Mitte zusammenkommen.«
»He, da ist ein Loch!« entfuhr es dem Marshal. Dann schob er sich den Hut aus der Stirn und blickte schärfer hin. Ganz deutlich sah er jetzt, daß sich etwas hinter dem Planenloch bewegte. Das Etwas war einmal heller, dann wieder dunkler.
Ein menschliches Auge!
»Na, wie gefällt Ihnen das, Mr. Earp?«
»Gar nicht«, entgegnete der Marshal und zog sich den Hut wieder in die Stirn. »Wenn es die Galgenmänner sind, dann haben sie es wieder mal raffiniert angefangen. Denn dann steckt da unten im Wagen ein Späher, der alles beobachtet. Das erinnert mich an Casa Grande. Da hatten sie ja auch einen Mann im Planwagen stecken.«
»Scheint zu den Tricks der Graugesichter zu gehören.«
Doc Holliday zog seine Uhr und warf einen Blick auf das Zifferblatt.
»Dauert wenigstens noch zwei Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit.«
Der Marshal hatte den gleichen Gedanken gehabt. Wenn es dunkel wäre, könnte man sich den Wagen einmal näher ansehen. Aber jetzt war das ausgeschlossen.
Da kam von der Straßenseite, auf der das Haus des Reverends stand, ein Mann, überquerte die Fahrbahn und blieb wie zufällig hinter dem Wagen stehen, um an seinem Stiefelschaft herumzuzerren.
»Das ist ja raffiniert«, meinte der Spieler. »Sehen Sie, daß er spricht?«
»Ja«, entgegnete der Marshal mit belegter Stimme. »Sie sind also da!«
Daran konnte es nun keinen Zweifel mehr geben. Das, was die beiden Dodger da beobachtet hatten, war ganz sicher keine Kette aufeinanderfolgender Zufälle.
Der Mann hatte sich wieder aufgerichtet und verschwand in einem kleinen Hardwareshop. Und jetzt kam drüben aus der Schenke ein Mann, der an den Pferden vorbeiging und einen Augenblick hinter dem Wagen verweilte.
»Der Kutscher?« fragte der Marshal.
Holliday schüttelte den Kopf. »Nein, der war älter.«
Der Mann kam hinter dem Wagen hervor und setzte seinen Weg quer über die Straße fort, um hinter dem Haus des Reverends in die Seitengasse einzubiegen.
»Das sind also schon sieben Leute«, rechnete der Marshal, »wenn nicht der Mann im Wagen einer der drei Kerle ist, die vorhin hier waren.«
»Also sechs oder sieben«, sagte Doc Holliday.
Eine Stunde verging. Und der Wagen stand immer noch auf der gleichen Stelle.
Allmählich senkten sich die Schatten der Dämmerung über die Straße.
Aber der Kutscher dachte nicht daran, seinen Wagen wieder zu besteigen.
Die beiden Dodger konnten nun wegen des schwächer gewordenen Lichts das Loch in dem Buchstaben auf der Plane nicht mehr beobachten.
Eine weitere halbe Stunde verging.
Eben wollte der Marshal hinuntergehen, um dem Reverenden ihre Beobachtungen mitzuteilen, als Doc Holliday ihn mit den Worten aufhielt: »Es sind doch sieben!«
Wyatt, der schon die Hälfte des Zimmers hinter sich hatte, blieb stehen und wandte sich um.
»Wieso?«
»Weil der Mexico Man zurückgekommen ist.«
Wyatt trat wieder ans Fenster. Er sah den Mexikaner neben dem Wagen halten. Eben stieg er von seinem Pferd.
»Diesmal ist er von der anderen Seite gekommen, von Osten her«, erklärte Doc Holliday.
Wenn das alles auch kein purer Zufall sein konnte, so mochten die Männer doch irgendwie anders zusammengehören, ohne nun von der Bande der Graugesichter zu sein. Noch war das nicht entschieden.
Nun sahen sie, wie der Mexikaner sein Pferd auf ihre Straßenseite hinüberführte und vor dem Haus des Reverends an die Halfterstange band. Dann überquerte er die Mainstreet und hielt auf die Schenke zu, in deren Eingang er verschwand.
Und gegenüber der Schenke an der Ecke hielten die beiden anderen; der strohblonde Bursche, der sich vorhin die Skizzen gemacht hatte, und der Mann im braunen Lederzeug, der zuerst gekommen war.
Die beiden blieben nur einen Augenblick nebeneinander, dann trennte sich der Bursche von seinem Gefährten und überquerte die Straße.
»Wie gefällt Ihnen das?« erkundigte sich der Gambler.
»Gar nicht«, entgegnete der Marshal. »Sie bauen regelrechte Sperren auf.«
»Ja, sieht ganz so aus.«
Jetzt war es schwer für die beiden Dodger, noch weitere Einzelheiten auf der Straße zu erkennen, denn es wurde dunkler und dunkler.
Als die Nacht endlich ihr schwarzes Tuch über die Stadt gebreitet hatte, verließen die beiden Wyatts Zimmer. Holliday ging hinüber in sein Gemach.
Als er zurück in den Flur kam, blickte der Marshal ihm verblüfft entgegen.
Er hätte den Georgier fast nicht wiedererkannt: Holliday trug eine schwarze Brille, die sein Gesicht völlig veränderte.
»Damned, wie kommen Sie denn daran?«
»Sie ist von Doc Lonegan aus Trinidad, Sie müssen sich doch noch an ihn erinnern.«
»Ja, sehr gut sogar. Sie haben ihm drei Kugeln aus dem Leib geholt.«
»Richtig.«
»Und? Hat er Ihnen dafür die Brille geschenkt?«
»Nein, aber seine Frau steckte sie nach der Operation versehentlich in meine Instrumententasche. Und da fand ich sie erst, als wir wenigstens sechshundert Meilen zwischen uns und Trinidad gebracht hatten. Ich werde sie ihm gelegentlich zurückgeben, wenn unser Weg wieder einmal nach Trinidad führt. Wie gefalle ich Ihnen?«
»Ausgezeichnet. Am liebsten würde ich den Reverenden fragen, ob er für mich nicht auch eine Brille hat.«
»Tun Sie das. Und lassen Sie sich möglichst auch einen anderen Hut geben, und vielleicht einen Mantel. Sie sehen, ich habe mir meinen Mantel mitgebracht.«
Holliday zog einen langen schwarzen Mantel an. Als er den Hut jetzt etwas weiter zurückschob und etwas vornübergebeugt ging, erinnerte er wirklich nicht mehr an den berühmten Spieler.
Der Reverend war sofort bereit, dem Marshal eine Brille und einen Hut zu leihen. Aber der Mantel, den er dem Missourier geben wollte, paßte nicht, er war viel zu klein.
Der Neger hatte in der Zimmertür gestanden und meldete sich jetzt: »Wenn ich Ihnen vielleicht einen Mantel von mir leihen dürfte, Marshal, es wäre eine Ehre.«
Wyatt musterte die Gestalt des Negers und stellte fest, daß der Mann nur etwa einen halben Kopf kleiner war als er. Vielleicht würde ihm ein Mantel von dem Schwarzen passen?
Er paßte. Zwar war er an den Armen etwas kurz. Aber immerhin konnte der Marshal ihn anziehen.
Die goldgeränderte Brille des Reverends machte Earp jedoch zu schaffen, da er durch ihre dicken Gläser nur schlecht sehen konnte.
»Schieben Sie sie etwas hinunter auf die Nase«, meinte Holliday, »dann können Sie über den Rand blicken.«
So maskiert verließen die beiden kurz nacheinander das Haus des Reverenden durch das Hoftor.
Doc Holliday überquerte die Straße und ging hinunter in die Schenke.
Der Mann hinter dem Tresen, der ihn vor drei Tagen noch einen Brandy verkauft hatte, erkannte ihn nicht. Der Keeper schob ihm das Glas hin und kassierte die beide Nickel, ohne auch nur einen forschenden Blick für den Fremden übrig zu haben.
Holliday sah sich vorsichtig in der Kneipe um und konnte keinen der Männer entdecken, die er oben vom Haus aus beobachtet hatte.
Aber vier von ihnen waren doch hier im Saloon verschwunden?!
Er ließ sich noch einen Brandy geben und fixierte die Umgebung schärfer.
Da sah er im Hintergrund des Schankraumes eine dunkelgrüne Portiere, die heruntergelassen war, nur ein winziger Lichtschein fiel hindurch.
Da war also ein Nebenraum, in dem sich die Männer aufhalten konnten.
Holliday zahlte auch den zweiten Brandy und ging hinaus in den Hof. Da sah er das Fenster des Nebenraumes sofort. Der typische Schein einer grünabgeschirmten Kerosinlampe fiel zu weitem, verzerrtem Rechteck auf den Hof.
Der Georgier lauschte zum Haus hinüber.
Dann nahm er eine leere Whiskytonne, brachte sie ans Fenster, stülpte sie um und stieg hinaus.
Von der Ecke aus riskierte er einen vorsichtigen Blick in den kleinen Raum.
Das Zimmer war leer!
Holliday verließ den Platz sofort, brachte die Whiskytonne zurück und ging wieder in die Schenke.
Hier hatte sich nichts verändert.
»Haben Sie ein Zimmer zu vermieten?« fragte er den Keeper mit heiserner Stimme.
Der kahlköpfige Mann wischte sich mit dem Handrücken über die Nase, zupfte den rotbraunen Schnurrbart an der Spitze nach oben und meinte schulterzuckend: »Well, wenn Sie drei Dollar ausgeben, habe ich noch ein Zimmer frei.«
»Haben Sie denn kein billigeres Zimmer?« knurrte Holliday ungehalten.
»Schon – aber die sind besetzt.«
»Nanu, heute mittag waren doch noch alle Zimmer frei.«
»So, hat meine Frau das gesagt?« krächzte der Wirt.
»Well, das stimmt, aber inzwischen…, eh, sind neue Gäste gekommen. Dann hätten Sie heute mittag mieten müssen. Tut mir leid.«
»Ach, macht nichts«, versetzte Doc Holliday und ließ sich noch einen Brandy geben. »Ich habe in Geschäften mit der Bahn zu tun, wissen Sie, Holzgeschichten.«
Es wunderte den Salooner nicht, daß ein Holzhändler sich hier aufhielt. Schließlich hatte die Railway-Company viel mit Händlern zu tun.
»Schlechte Geschäfte mit dem Verein da drüben, stimmt’s?« krächzte er.
»Ach«, winkte Holliday ab, »am liebsten hätten die Burschen die Schwellen geschenkt.«
»Das kann ich mir denken. Man kennt die Brüder ja. Sie sind da wie eine Apotheke – aber selbst wollen sie von anderen alles geschenkt haben. Nehmen Sie es nicht tragisch. Trinken Sie lieber noch einen.«
Der Schankraum war hinter der Theke in seiner Längsseite von einer Galerie überdeckt, die zu mehreren Zimmern führte.
Doc Holliday konnte den Mann nicht sehen, der jetzt oben am Geländer erschien und in den Schankraum hinunterblickte.
Der stechende Blick des Mexikaners flog über den Schankraum – und blieb an der Gestalt des Georgiers haften.
Der Mexikaner zog sich sofort von der Galerie zurück und stemmte die behaarten braunen Fäuste mit den krallenartigen Fingern auf die schweren Hirschhornknäufe seiner Revolver.
Da trat der blondhaarige Bursche aus einem der Zimmer und wollte an die Galerie gehen, um hinunterzusehen.
Mit einem raschen Griff packte ihn der Mexikaner und zog ihn zurück.
»Was gibt’s?« flüsterte der Mann.
»Augenblick«, entgegnete der Mexikaner, »ich muß erst einmal nachdenken.«
Der Bursche schwieg und blickte den anderen an. Fieberhaft arbeitete es in dem Hirn des Mexikaners.
»Hölle und Teufel«, preßte er durch die Zähne, »wo habe ich diesen Revolver schon gesehen?«
»Welchen Revolver?« forschte der Bursche.
»Ah, geh vorne an die Treppe und sieh dir den Mann an, der vorn an der Theke steht.«
Der Bursche kam nach zwei Minuten zurück.
»He, Gip, da stehen wenigstens fünfzehn Leute!«
»Aber nur ein Mann!« krächzte der Mexikaner.
»Ich verstehe Sie nicht. Sie werden doch nicht den dickbäuchigen Kerl mit dem gelben Hut meinen?«
»Nein.«
»Oder den mit dem Zylinder?«
»Nein, auch nicht.
»He, haben Sie es etwa auf den kleinen krummbeinigen Kerl abgesehen…?«
»Nein, ich meine den Mann, der hier vorne steht und Brandy trinkt. Er ist ziemlich groß und trägt einen schwarzen Hut und einen schwarzen Mantel. Den Colt trägt er links.«
Der Mexikaner achtete immer besonders auf Männer, die ihren Revolver links trugen.
»Ich weiß nicht, was du dabei findest«, entgegnete der Bursche.
Über das bronzefarbene Gesicht des Mexikaners huschte ein böses Lächeln.
»Wir werden uns die Figur einmal näher betrachten.«
*
Der Marshal hatte den Hof des Reverenden zur anderen Seite hin verlassen, um durch eine kleine Quergasse auf den freien Platz zu kommen, der hinter dem Depot lag.
Es war ein ziemlich großer und weitflächiger Platz. Nach etwa hundert bis hundertfünfzig Yards kamen kleine Häuser, die ziemlich weit auseinander standen. Marana war eine sehr kleine Stadt. Und hier hinter der Mainstreet war schon nach zwei, drei Häusern Schluß.
Im diffusen Sternenlicht vermochte der Marshal den Platz nicht gut zu übersehen. Er stand im Dunkel eines Scheunentores und blickte zur Rückfront des Depots hinüber.
Das Haus war steingefügt und ziemlich groß. Die Mauer, die hinten den Hof umgab, war ziemlich niedrig, und man konnte gut über sie wegsehen.
Alles war still.
Der Missourier rührte sich dennoch nicht von der Stelle.
Äußerste Vorsicht war geboten. Schließlich kannte er die Galgenmänner. Und wenn sich hier ihre Elite aufhielt, dann war doppelte Vorsicht am Platze.
Als er seinen Platz verlassen wollte, um an dem halbzerfallenen Zaun eines Gartens entlang auf die kleinen Häuser drüben zu gehen, sah er urplötzlich vorn an der Mauer eine Gestalt auftauchen!
Nicht etwa oben an der Straße, wo der Mann gerade hergekommen sein könnte, oder auf der anderen Seite des Depots, nein, hier vorne, vielleicht zwanzig oder fünfundzwanzig Schritt vor dem Marshal in der Mitte der Mauer, die er seit langem im Auge gehabt hatte.
Der Mann mußte also während der ganzen Zeit dort gelegen haben.
Es war ein Zufall, daß der Missourier seine Silhouette so gut sehen konnte, denn der Kopf und die Schultern des Fremden zeichneten sich von der weißen Adobewand eines der dahinterstehenden Häuser deutlich ab.
Es war ein mittelgroßer Mann, der sich jetzt nach allen Seiten umsah, ehe er wieder verschwand.
Er lag jetzt also wieder hinter der Mauer.
Wyatt blieb reglos stehen und starrte auf den Hofplatz des Depots.
Da war der Ruf des Nachtkauzes zu hören. Irgend jemand hatte den Ruf dieses Tieres täuschend nachgeahmt, aber das scharfe Ohr des Missouriers entdeckte den Betrug sofort. Zu oft hatte Wyatt den Nachtkauz in der Savanne schreien gehört, als daß er jetzt auf diesen Trick hätte hereinfallen können.
Wenige Minuten später wurde der Ruf oben von der Straße her erwidert.
Und dann entdeckte der Marshal auf der anderen Seite des Depots eine graue Gestalt, die sich dicht vor der weißen Adobewand vorwärts bewegte, bis sie ebenfalls bei der Mauer wegtauchte.
Jetzt waren also wenigstens zwei Männer hinter der Ringmauer und einer oben auf der Straße.
Wo blieb Doc Holliday?
Wyatt hatte sich mit ihm hier, vor der Scheune, verabredet. Eigentlich hatte der Missourier vorgehabt, den weiten Platz hier abzusuchen, aber sein Argwohn hatte ihn gewarnt, und so war er denn hier am Hoftor stehengeblieben.
Und seine Geduld hatte sich gelohnt. Es konnte keine Zweifel mehr daran geben, daß sich irgend etwas um das Railway-Depot zusammenbraute.
Waren es die Galgenmänner?
Wyatt beschloß, seinen Platz zu verlassen, um nach Doc Holliday zu sehen.
Er ging auf dem gleichen Weg zurück, auf dem er gekommen war. So erreichte er die Mainstreet an der Ecke neben dem Haus des Reverends.
Es war auf der Mainstreet von Marana so still wie immer um diese Abendstunde.
Drüben vor der Schenke hatten sich ein paar Reiter eingefunden, deren Pferde da abgestellt waren. Der Planwagen stand immer noch da.
Wyatt schlurfte gebückt über den Fahrdamm und stieg drüben vor dem Hardwareshop auf den Vorbau.
Umständlich zündete er sich einen Zigarrenstummel an und schlurfte dann weiter auf die Eckschenke zu.
Da blieb er wieder stehen und tat, als wenn er sich den Zigarettenstummel noch einmal anzünden müsse.
Er war jetzt neben einem der Fenster und konnte in den Schankraum sehen.
Und was er da sah, bannte seinen Blick. Unweit vom Fenster, nur etwa einen Yard entfernt, sah er auf dem Tisch eine braune, behaarte Hand liegen, die eine Zigarette hielt. Auf dem Mittelfinger dieser Hand blinkte ein großer goldener Ring mit einer hellen Platte, in die ein Dreieck eingraviert war.
Der Ring der Galgenmänner!
Wyatt hob den Blick und sah zur Theke hinüber.
Und was er da sah, faszinierte ihn nicht weniger. Doc Holliday lehnte an der Theke und hatte die Linke um sein Glas gespannt. Den Kopf hatte er etwas angehoben und blickte den blonden Burschen an, der neben ihm stand.
Mehrere Schritte hinter ihm stand der Mexikaner, der seinen Revolver gezogen hatte.
Die wenigen Leute, die in der Schenke waren, starrten zur Theke hinüber.
Das war ja eine höllische Situation! Wenn Wyatt jetzt eingriff, hatte er wohl keine Gelegenheit mehr, sich den Besitzer des großen goldenen Ringes anzusehen.
Und noch einmal zurückzugehen, und sich neben dem Fenster zu bücken, um von dort aus das Gesicht des Mannes zu erkennen, konnte er auch nicht riskieren, da er vielleicht vom Wagen aus beobachtet wurde.
Also ging er weiter auf die Schankhaustür zu und schob sie langsam auf.
Damned! Den Mann am Fenster konnte er nicht sehen, da der ihm den Rücken zukehrte.
Es war ein ziemlich großer Mann, schlank, hager und sicher noch nicht alt.
Wyatt hielt auf die Theke zu und blieb an ihrem Stammende, nicht weit von dem Mexikaner stehen.
Er winkte dem Keeper.
Der kam mit schlotternden Knien heran.
»Ja, ja, Sie bekommen gleich. Sie sehen doch…«
Da flog der Kopf des Mexikaners herum. Er schnauzte den Wirt an: »Was?«
»Nichts, Mister, natürlich nichts.«
»Das wollte ich dir auch geraten haben!«
Doc Holliday hatte den Marshal sofort gesehen.
Hatte nun der Mexikaner, der ein ungewöhnlich argwöhnischer Mensch zu sein schien, den Blick des Gamblers beobachtet oder war es Zufall? Jedenfalls warf er einen kurzen forschenden Blick in den Thekenspiegel, wo er den neuen Gast sehen konnte.
Aber ihm schien nichts Verdächtiges an dem Neuen zu sein.
Eben meinte der blonde Bursche, der sich offenbar mit Doc Holliday angelegt hatte: »Du willst also den Drink nicht für mich ausgeben, Brother?«
»Nein«, entgegnete der Spieler, »ich habe keinen Grund dazu, ich kenne dich wirklich nicht.«
»Wenn ich dir sage, daß wir uns kennen, dann bleibt’s dabei. Aber wenn du mich beleidigen willst – ich habe es dir schon gesagt – dann geht’s dir schlecht. Jetzt wirst du erst einmal mit mir hinauskommen.«
Doc Holliday schüttelte den Kopf. »Nein, warum? Draußen ist es kalt. Wenn du in meine Jahre kommst, Boy, dann bleibst du auch lieber in der warmen Schenke.«
Da stieß der Mexikaner plötzlich den Revolver vor und drückte ihn in Hollidays Rücken. »Du hast gehört, was mein Partner sagt«, krächzte er.
Wyatt lauschte dem Klang der Stimme nach. Er hatte sie schon irgendwo gehört. Aber wo?
In Costa Rica?
Blitzartig kam ihm die Erkenntnis. Er hatte die Stimme dieses Mannes in jener fürchterlichen Nacht gehört, als er in Costa Rica der Gefangene Stilwells war. Er hatte die Stimme dieses Mannes im Dunkeln gehört und das Gesicht ihres Besitzers nicht sehen können.
Jetzt war es also ganz klar: Die Galgenmänner waren in Marana.
Und drüben am Fenster saß vielleicht der Big Boß! Jener Mann, den er seit Wochen jagte!
Wyatt tippte dem Mexikaner auf den Rücken.
Wie von einer Tarantel gebissen fuhr der herum und stierte den Marshal aus böse flackernden Augen an.
»Was ist denn mit dir los, Mensch? Was fällt dir ein!«
Wyatt nahm die Hände zusammen und sagte in salbungsvollem Predigerton: »Ich verzeihe Ihnen, mein Sohn. Sie sprechen keine guten Worte. Wir, die wir zu den vierzigtausend Heiligen der Jüngsten Tage zählen, haben Mitleid mit allen sündigen Menschen. Jawohl, auch mit dir.«
»Um Himmels willen«, krächzte der Mexikaner, »ein Quäker, auch das noch! Geh zum Teufel, Mensch.«
»Aber du irrst, mein Sohn«, entgegnete der Marshal ölig, »ich gehöre nicht zu den Quäkern.«
»Dann bist du eben ein Mormone!« entschied der Mexikaner. »Es ist mir auch völlig egal. Jedenfalls hast du mich angetippt. Und dafür sollte ich dir den Schädel einschlagen.«
»Nein, mein Sohn, das solltest du nicht. Du solltest mir im Gegenteil dankbar sein.«
»Ich hoffe es nicht, mein Freund.«
Da riß der Mexikaner den linken Arm hoch und wollte dem angeblichen Prediger den Lauf seines schweren Revolvers über den Schädel ziehen.
Aber dazu kam es nicht. Ein Schuß peitschte durch den Raum.
Verblüfft blickten die Männer an der Theke sich um.
Einer der beiden Männer, die am Fenstertisch gesessen hatten, war aufgestanden. Es war ein großer, schlanker Mensch mit breiten Schultern und schmalen Hüften. Er hatte ein gutgeschnittenes Gesicht und trug einen scharfausrasierten schmalen Schnurrbart. Seine Augen waren pulvergrau und hart. Er trug einen dunkelbraunen Anzug, ein weißes Hemd und eine weinrote Samtschleife.
Noch hatte er den Revolver in der Hand, aus dessen Lauf sich ein dünner Rauchfaden kräuselte.
Es war der Mann, der den großen goldenen Ring mit dem eingravierten Dreieck trug!
Der Mexikaner krächzte: »Was ist denn los?«
»Ich habe die Absicht, meinen Brandy hier in Ruhe zu trinken, Mister«, entgegnete der Fremde.
»Hm«, knurrte der Mexikaner, »wie Sie meinen, ich bin nicht streitsüchtig.«
Er hob seinen Revolver auf, den die Kugel des anderen ihm aus der Hand gestoßen hatte, und stellte zu seiner Verblüffung fest, daß die Waffe immer noch gespannt war.
»Gefährlich, so ein Schuß«, meinte er.
Der Mann hatte sich wieder drüben am Fenster niedergelassen und trank seinen Brandy langsam aus.
Ihm gegenüber saß ein älterer Mann mit einem fuchsroten Vollbart. Er hatte ein brutales, verschlagenes Gesicht mit eingedrückter Sattelnase und kleinen Schweinsäuglein. Seine Schultern waren breit und verrieten Bärenkräfte.
Es war still geworden in der Schenke.
Da sagte der Georgier in die Stille hinein zu dem blonden Burschen: »He, Jonny, jetzt weiß ich, wo wir beide uns getroffen haben. Hahaha! Es war in Kansas City im Zuchthaus!«
»Was fällt dir ein, Mensch!«
»Doch, ich erinnere mich jetzt sogar ganz genau. Du hattest fünf Jahre wegen schweren Raubes und versuchten Totschlages abzubrummen, stimmt’s? Hahaha!«
Der semmelblonde Bandit wich ein paar Schritte zurück.
»Mensch, wie redest du mit mir?« krächzte er. »Nimm dich zusammen, sonst schlage ich dir deine Brille ein!«
»Ja, ja«, entgegnete Holliday, »so schlau warst du damals schon.«
Der Blonde wollte sich auf ihn stürzen, aber da stand drüben am Fenster der Mann wieder auf, der schon einmal eingegriffen hatte.
Wyatt wandte den Kopf kaum merklich und fixierte ihn unter halbgesenkten Augenlidern scharf. Aber es gelang ihm doch nicht, das Gesicht des anderen deutlich zu erkennen.
Die Hutkrempe warf bis zum Kinn einen dunklen Schatten auf das Gesicht des Fremden. Man sah nur seine Augen blinken. Es waren helle, kalte Augen. Und jetzt, als er die linke Hand hob, sah Wyatt wieder den Ring.
Aber er rief nicht den Blonden an, sondern wandte sich an den Keeper: »Ich bekomme noch einen Brandy!«
Aber irgend etwas in seiner Stimme schwang da mit, das den Blonden veranlaßte, von Doc Holliday abzulassen.
»Wir sehen uns noch einmal«, krächzte er dem Spieler zu und trollte sich zur Treppe zurück.
Der strähnige Bandit Jussuf Noriba ahnte sicher nicht, in welcher Gefahr er sich da gerade befunden hatte. Was hätte er wohl gesagt, wenn er gewußt hätte, mit wem er sich da eingelassen hatte!
Da rief hinten von dem Tisch des Fremden der rothaarige Mann: »Mir auch einen Brandy, Keeper!«
Beim Klang dieser Stimme wären die beiden Dodger beinahe zusammengezuckt. Sie kannten diese Stimme so genau wie ihre eigene. Und noch nach Jahren hätten sie sie wiedererkannt.
Es war die Stimme jenes Mannes, der in der Nacht oben am Roten See in den Silver Mountains für den Boß gesprochen hatte!
Also das war der Sprecher der Galgenmänner. Und somit war der Mann, der ihm gegenübersaß, der Große Boß.
Wie ein Glutstrom zuckte es durch die Brust des Marshals. Viele Wochen waren sie jetzt durch das Land gezogen. Von Stadt zu Stadt, von Kom Vo nach Costa Rica, von Tucson nach Tombstone, von Tombstone hinauf in die Blauen Berge, von dort nach Nogales, von Nogales nach Martini, dann hinauf nach Chiricahua, in die Silver Mountains und an den Roten See.
Der Marshal hatte lange Zeit den großen Bandenführer Ike Clanton für den Anführer der Bande gehalten. Aber nun stand also der richtige Mann vor ihnen, hier in diesem Raum.
Wyatt spürte seine Nerven bis in die Fingerspitzen.
Jetzt kam es darauf an, daß der Mann und auch sonst niemand hier sie erkannte!
Schließlich hatten sie oben am Roten See vor ihm und dem Halbkreis seiner Unterführer gestanden im grellen Licht des Campfeuers.
Und jetzt hatten sie als Verkleidung nur eine Brille im Gesicht!
Wyatt hatte zwar schon einige Worte gesprochen, aber da er seine Stimme etwas verstellt hatte, war er bis jetzt noch nicht erkannt worden.
Immer noch beobachtete er unter halbgesenkten Lidern den Mann drüben am Fenstertisch.
Er hatte seinen Brandy ausgetrunken und erhob sich.
Der Rotschopf, der gerade an seinem Getränk genippt hatte, folgte ihm sofort.
Die beiden verließen die Schenke.
Ich muß Ihnen folgen! hämmerte es im Hirn des Marshals.
Aber da sich sowohl der Mexikaner als auch der semmelblonde Bandit in der Schenke befanden, konnte er nicht sofort hinausgehen.
Doc Holliday ging auf die Hoftür zu.
Der Semmelblonde sah ihm nach.
Draußen neben der Tür blieb der Spieler sofort stehen.
Mit raschen Schritten folgte ihm der Semmelblonde.
Doc Holliday ließ ihn vorbei und sah, wie er in den Hof stürmte, um ihn dort irgendwo zu suchen.
Holliday kam sofort zurück und durchquerte das Lokal, um es vorn durch den Eingang zu verlassen.
Kaum hatte er den Vorbau erreicht, als sich die Tür wieder öffnete. In ihrem Rahmen erschien der Mexikaner.
Holliday, der an der Vorbaukante stand, sah sich nach ihm um.
Mit einem gefährlichen Grinsen im Gesicht trat der Mex an ihn heran. »Na, Amigo, hast du auf mich gewartet?«
»Hm.« Holliday zog die Schultern hoch. »Das will ich nicht gerade behaupten.«
»Hör zu, Amigo, du gefällst mir nicht. Ich weiß zwar nicht, wo ich dich hinstecken soll, aber du gefällst mir nicht.«
»Mach dir keine Sorgen darüber«, versetzte der Spieler gelassen, »das beruht auf Gegenseitigkeit.«
Der leichtverletzliche Südländer zuckte zusammen, als hätte ihm jemand einen Hieb versetzt.
»Was soll das heißen?«
»Ach, laß mich zufrieden.«
Holliday wollte den Vorbau verlassen.
Da griff der andere nach ihm.
Wenn es etwas gab, das der Georgier nicht vertragen konnte, dann war es das. Er nahm ganz ruhig die Hand des Mestizen von seinem Arm und blickte ihn durch die leicht vergrößernde Brille scharf an.
»Ich würde sehr vorsichtig sein an deiner Stelle, Boy.«
Ganz dicht trat der andere an ihn heran. Wie eine Flamme schlug dem Spieler der Alkoholdunst des Mexikaners entgegen.
»Dreh dich um, du Skunk, und geh langsam vorwärts, schön über den Vorbau weiter, bis du an die nächste Ecke kommst, und da gehst du in die dunkle Gasse hinein.«
Der Georgier lachte leise in sich hinein, seine Zähne blinkten.
»Weißt du, ich hatte mal eine Tante, die sagte immer: Es gibt Leute, die haben erst Ruhe, wenn sie den Deckel auf der Nase haben.«
»Den Deckel…?« stotterte der Bandit verblüfft.
»Ja, den Sargdeckel!«
Doc Holliday wandte sich um und überquerte die Straße.
Der Mexikaner zog seinen Revolver und stieß ihn nach vorn.
Da erhielt er einen harten, knackenden Schlag über den Unterarm, und die Waffe fiel ihm polternd aus der Hand.
Er warf den Kopf herum und blickte in die harten Augen des Missouriers.
Der sah ihn über den Rand seiner Brille scharf an.
»Tut mir leid, Mister, aber ich habe etwas gegen Leute, die in anderer Leute Rücken den Revolver ziehen.«
Der Mexikaner blickte ihn aus bösen Augen an.
»Was fällt dir ein, Mensch? Was hast du dir herausgenommen? Los, heb meinen Revolver auf!«
Wyatt schüttelte den Kopf. »Nein, Mister, dazu habe ich keine Veranlassung.«
Der Mexikaner war ein Mann ohne jede Beherrschung. Daß gerade er von dem Anführer der Galgenmänner für diesen Coup hier in Marana ausgesucht worden war, vermochte sich der Marshal nicht zu erklären.
Mit einem raschen Schritt kam er auf Wyatt zu, holte mit der Linken zum Faustschlag aus, wurde aber von einem blitzschnellen rechten Konter des Marshals abgefangen, der krachend gegen seine Kinnlade prallte.
Der Mexikaner ging sofort in die Knie.
Wyatt packte ihn mit der Linken ungerührt am Kragen und zog ihn hoch, schüttelte ihn und stellte ihn wieder auf die Beine.
»So, Junge, jetzt gehst du am besten schlafen.«
Der Mexikaner schob den Oberkiefer vor.
»Das wirst du mir büßen, elender Dreckskerl!«
»Nanana, keine Ausfälle, Junge. Ich bin ein eigenartiger Bursche, weißt du. Es gibt Dinge, die kann ich auf den Tod nicht ausstehen.«
»So, kannst du nicht?« Mit gespreizten Beinen stand der Mexikaner da und hatte die geballten Fäuste angehoben. »Weißt du, was ich mit dir aufstellen werde? Ich mache Kleinholz aus dir.«
Da schnellte ihm der Mexikaner nach, riß ihn am linken Arm herum und suchte ihn mit einer raschen Doublette niederzuwerfen.
Aber er hatte sich auch diesmal in dem Mann mit der goldgeränderten Brille geirrt. Ein fürchterlicher linker Haken traf ihn rechts am Jochbein, wirbelte ihn um seine eigene Achse und stieß ihn vom Vorbau herunter auf die Straße.
Gip Jallinco kauerte schwer benommen im Staub der Mainstreet und stierte auf den Vorbau, wo er den Mann mit der Brille doppelt sah.
»Also, mach’s gut«, meinte Wyatt, so als wäre nichts geschehen. Er schlenderte davon, quer über die Straße am Haus des Reverenden vorbei in die Nebengasse.
»Ja, ja.« Wyatt wandte sich halb ab und blickte die Straße hinauf. »Das hat schon so mancher gewollt, Junge. Es ist nicht ratsam, aus anderen Leuten Kleinholz machen zu wollen. So long.« Er wandte sich ab und tat, als wollte er davontrotten.
Als er am Hoftor vorbeikam, hörte er die Stimme Doc Hollidays: »Ich habe bis jetzt mit dem Colt vorn an der Ecke gewartet.«
»Dachte ich mir«, entgegnete der Marshal.
»Und jetzt?«
Wyatt zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
»Es ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe die ganze Zeit an den Kerl im Planwagen gedacht.«
»Der ist nicht mehr drin«, entgegnete Holliday.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil die Plane vorn und hinten offen ist und ich durch die Karre sehen konnte, als ich vom Vorbau ging. Er hätte auch kalte Füße gekriegt, wenn er jetzt noch in dem Wagen stünde.«
Die beiden standen hinterm Hoftor, das Wyatt zugeschoben hatte, und flüsterten miteinander.
»Und was sagen Sie zu ihm –?«
»Sie meinen den Mann, der mit dem Roten am Fenster saß? Glauben Sie, daß er der Boß ist?«
»Es hatte ganz den Anschein. Der rotbärtige Bursche ist jedenfalls der Sprecher der Graugesichter, den wir am Roten See gehört haben.«
Wyatt nickte. »Ja, ganz zweifellos. Die Stimme habe ich sofort wiedererkannt.«
Holliday zündete sich eine Zigarette an. Für den Bruchteil einer Sekunde fiel ein schwachroter Lichtschein auf sein kantiges Gesicht. Dann war es wieder dunkel. Nur der winzige Glutpunkt der Zigarette war zu sehen.
»Was haben Sie jetzt vor, Marshal?«
»Das ist mir selbst noch nicht klar. Ich weiß nicht, wie wir beiden gegen wenigstens sieben Mann in der Dunkelheit aufkommen sollen. Ganz unzweifelhaft haben die Halunken es auf das Depot abgesehen. Aber wir können uns ja schlecht dort hinstellen und aufpassen. Außerdem geht es mir ja vor allen Dingen um den Boß. Es ist bei einer solchen Bande wie einer Indianerhorde: Wenn man den Chief gefangen hat, fehlt ihr der Kopf.«
»Was halten Sie davon, wenn wir den Sheriff holen?«
»Nicht sehr viel, aber es wird uns kaum etwas anderes übrigbleiben.«
»Soll ich ihn holen?« forschte der Georgier.
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Nein. Sie gehen jetzt am besten an den vorhin vereinbarten Treffpunkt und beobachten von der Scheune aus den Platz hinter dem Depot. Ich kann mir nicht denken, daß er es wagt, das Haus von vorn aufzusprengen.«
»All right.«
Die beiden Dodger trennten sich.
Während Doc Holliday der Scheune entgegenging, an der der Missourier vorhin gestanden hatte, wandte sich Wyatt der Mainstreet wieder zu und schlenderte dem Sheriffs Office entgegen.
Durch die winzige Scheibe drang ein schwacher Lichtschein auf die Straße.
Wyatt klopfte an die Tür und öffnete.
Entgeistert starrte er auf das Bild, das sich ihm da bot.
Der Sheriff stand in der Mitte des Raumes und hatte ein Schrotgewehr in der Hand.
Wyatt sah nur seine Augen, sah die tödliche Entschlossenheit darin.
Und da brüllte auch schon der Schuß los.
Nicht den Bruchteil einer Sekunde zu früh hatte sich der Missourier zurückgeworfen und hinter der Türecke in Deckung gebracht.
Das gehackte Blei stob mit einer ohrenbetäubenden Detonation ins Freie, schlug in den Türrahmen, in die Dachpfeiler und in die Vorbaubohlen.
Aber noch hatte sich die graue Pulverwolke nicht ganz verzogen, da tauchte der Missourier hinter dem Türrahmen auf.
Der Sheriff stand mit dem Gewehr mitten im Raum und starrte ihn an. In seinen Augen stand Angst.
»Sie… sind es, Marshal?« stotterte er.
»Ja, ich.«
»Damned, ich habe Sie nicht erkannt!«
Wyatt hatte jedoch die Brille auf dem Weg zum Office abgenommen, und so hätte der Sheriff ihn eigentlich erkennen müssen.
Aber die Angst beherrschte diesen Mann.
»Es tut mir leid, Marshal, aber ich konnte ja nicht ahnen, daß Sie zurückgekommen sind.«
»Eigenartig«, antwortete der Missourier, während er die Tür hinter sich schloß und links an die Wand trat, wo er von der Straße aus nicht gesehen werden konnte. »Sie stehen hier in Ihrer Bude und schicken jedem, der in der Tür erscheint, eine Ladung Blei entgegen?«
»Nein«, dehnte der Sheriff, »aber es… Ich habe… Es ist irgend etwas los in der Stadt.«
»Ja, das kann man wohl sagen.«
»Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe Männer gesehen, die nicht in die Stadt gehören. Einen Mexikaner und zwei andere.«
»Richtig, die habe ich auch gesehen.«
»Aber Sie waren doch gar nicht hier?«
»Doch, ich war hier, drüben beim Rev. Seit vorgestern.«
»Das kann doch nicht möglich sein.«
»Doch, es ist möglich, Sheriff. Ich habe Sie auch beobachtet, die ganze Zeit über. Sie haben Ihren Raum kaum verlassen. Das nennen Sie, Ihr Amt versehen?«
Wyatt ließ sich auf einen dreibeinigen Hocker nieder.
Der Sheriff schob eine neue Rehpostenladung in den Lauf seiner Schrotflinte und knurrte: »Well, der Teufel soll diesen Job hier holen. Ich kann es Ihnen ja sagen: Ich war Hilfs-Sheriff in Dallas und in Austin und Oklahoma City. Überall war der Teufel los, aber hier ist es am schlimmsten. Seit die Railway-Company das Depot da drüben hat, streichen hier immer Gestalten herum, die einem wirklich das Fürchten beibringen können. Dabei gibt es hier nicht einen einzigen Menschen, der einem beisteht.«
»Und da Sie keinen Menschen haben, der Ihnen beisteht, haben Sie sich gedacht, die Flinte muß mir beistehen?«
»Nein, aber was soll ich tun? Ich habe gedacht, es wäre einer von diesen Fremden.«
Wyatt winkte ab. »Hören Sie, Sheriff, es sind wenigstens sieben Männer in der Stadt, die ich im ärgsten Verdacht habe, daß sie zu den Galgenmännern gehören. Und was noch wichtiger ist, einer von ihnen könnte der Anführer der Bande sein.«
Der Sheriff ließ den Kolben seiner Schrotflinte so hart auf den Boden sinken, daß der Staub aus den Dielenritzen aufstob. »Der Boß der Graugesichter?« stieß er heiser hervor.
»Ja, es hat den Anschein. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls ist da ein Mann, der einen großen goldenen Ring mit einem eingravierten Dreieck trägt. Hier, sehen Sie sich den Ring an. Er ist klein gegen den, den er trägt. Und dieser Ring gehörte einem der Unterführer der Galgenmänner.«
Das Gesicht des Sheriffs war grau geworden, wie die gemauerte Wand zum Zellengang hinter ihm.
»Sie glauben, daß der Chef der Galgenmänner hier in Marana ist?« Er vermochte ein Beben in seiner Stimme nicht zu unterdrücken.
Wyatt hatte ihn forschend angesehen und entgegnete kühl: »Ich habe Ihnen gesagt, daß ich es nicht mit Sicherheit weiß. Aber es ist durchaus möglich. Es ist ein ziemlich großer Mann, der einen gutgeschnittenen braunen Anzug und ein weißes Rüschenhemd trägt, dazu eine weinrote Krawatte und einen Waffengurt mit zwei Revolvern. Außerdem schießt er mit einem Derringer, den er mit der Rechten aus der linken Westentasche zieht. Er hat dunkles Haar und, ich glaube: graue Augen. Wie alt er ist, kann ich schwer sagen. Vielleicht dreißig, vielleicht auch vierzig. Er war bis jetzt drüben in Flimberts Saloon.«
Der Sheriff schluckte schwer. Sein Unterkiefer zitterte. Plötzlich packte er die Flinte, zog den Rehposten heraus und stellte sie zurück in den Gewehrschrank.
»Ich werde Ihnen etwas sagen, Wyatt Earp. Ich habe die Nase voll! Restlos voll! Ich will nicht mehr. Ich habe mich jahrelang unten in Dallas herumgeschlagen und dann in Austin und dann in Oklahoma City. Ich bin hierhergekommen, um meine Ruhe zu haben. Ich habe die Railway-Company nicht gebeten, hier ihr Depot einzurichten. Ich habe keine Lust, auf diesem Posten zu sterben. Als einziger Mann – für eine millionenschwere Bahngesellschaft, verstehen Sie? Wenn Sie das wollen, bitte. Bilden Sie sich etwa ein, daß Sie mit Doc Holliday hier allein gegen eine ganze Bande von kaltstirnigen Verbrechern aufkommen können? Haben Sie vielleicht geträumt, daß Sie die Elite der Graugesichter stoppen können? Sie wußten ja, was Sie hier erwartet! Weshalb sind Sie denn auch zurückgekommen?«
Mit gespreizten Beinen, geballten Fäusten und zitterndem Körper stand der verzweifelte Gesetzesmann mitten im Raum.
Wyatt hatte sich von seinem Platz erhoben. Er überragte den Sheriff um Haupteslänge und blickte ihm jetzt ruhig in die Augen.
»Ich bin zurückgekommen, weil es meine Pflicht war, Sheriff!«
»Pflicht, ja, ja, immer die Pflicht. Ich bin ihr sechzehn Jahre nachgekommen. Sie hat mich so weit gebracht, daß ich jetzt nur noch ein Nervenbündel bin. Ich will nicht mehr, Marshal Earp, verstehen Sie?« Mit der Rechten griff er an die linke Brustseite, riß sich den Stern herunter und warf ihn dem Marshal vor die Füße. »Da haben Sie Ihren Stern! Ich brauche ihn nicht mehr.«
Er packte seinen Mantel vom Haken und ging auf die Hoftür zu.
»Augenblick noch«, nagelte ihn die metallene Stimme des Marshals fest.
Der Mann blieb stehen und drehte den Kopf zurück.
»Sie haben den Stern nicht von mir bekommen, Mister.«
»Das ist mir egal, von wem ich ihn bekommen habe. Sie sind US-Marshal, und das genügt. Ich habe ihn ordnungsgemäß abgegeben.«
»Gehen Sie zum Mayor, sagen Sie ihm Bescheid! Damit er wenigstens weiß, daß Sie die Stadt ohne Schutz zurücklassen.«
Da wandte sich der Sheriff noch einmal voll um.
»Ohne Schutz?« fragte er und legte den Kopf auf die Seite. »Sie sind doch hier.«
»Ja, natürlich«, entgegnete der Marshal, »ich bin hier.« Ganz leise hatte er es gesagt, wandte sich um und ging hinaus.
Da rannte ihm der Sheriff nach, erreichte ihn vor der Tür und zog ihn ins Office zurück.
»Wyatt«, keuchte er, »verstehen Sie mich doch! Ich bin nicht mehr so jung wie Sie.«
»Sicher, Sie sind fünf Jahre älter als ich, ich weiß.«
»Und außerdem, ich habe nicht die Nerven. Ich bin kein Kerl wie Sie, ich bin… Ich kann es eben nicht!« Er rang die Hände.
Wyatt nickte und legte die Linke auf seinen Unterarm.
»Schon gut, schon gut.« Dann machte er sich von dem Zitternden los und ging quer über die Straße davon.
Der Sheriff starrte ihn mit leeren Augen nach, zerquetschte einen Fluch zwischen den Lippen, wandte sich um und rannte durch das Office davon.
Er ist nie wieder in Marana gesehen worden.
Viele Jahre später begegnete ihm Wyatt Earp drüben in San Francisco, in Kalifornien, wo er den Rausschmeißer in einer Hafenschenke abgab…
Wyatt hatte die andere Straßenseite noch nicht erreicht, als er Schüsse krachen hörte.
Sofort erkannte er das helle Singen der Sixguns des Georgiers und rannte mit weiten Schritten vorwärts.
Noch ehe er die Höhe des Railway-Depots erreicht hatte, wurde wieder geschossen. Er sah, daß die Schüsse hinten auf dem Hof des Depots gewechselt wurden.
Offenbar war der Spieler aufgestöbert worden.
Wyatt hetzte mit weiten Schritten vorwärts und hatte die Mauer noch nicht ganz erreicht, als hinter ihm ein Schuß lospeitschte und klatschend gegen die Steine der Mauer schlug, wo er abprallte und als Querschläger jaulend davonflog.
Der Marshal warf sich herum und schoß im Fallwurf zurück, genau in den Feuerschein der wieder aufblitzenden Waffe hinter ihm.
Wie ein Keulenschlag traf das Geschoß den Mann, der auf ihn gefeuert hatte.
Er torkelte zurück, stürzte nieder, suchte sich wieder zu erheben und stieß den Revolver noch einmal nach vorn.
Aber er konnte nicht mehr schießen.
Kraftlos sank sein Arm hinunter.
Wyatt kauerte am Boden, richtete sich auf und kam mit vorgehaltenem Revolver zurück.
Da knickte der Gegner wie ein Rohr im Winde zurück und fiel mit dem Hinterkopf auf die Straße.
Wyatt sah den strohblonden Burschen am Boden liegen. Er packte ihn und zerrte ihn hinüber zum Vorbau.
Der Mann war nicht tot. Keuchend rang er nach Atem.
»Wo ist der Boß?« fragte ihn Wyatt.
»Ich weiß es nicht«, krächzte der Bandit.
»Ich frage dich, wo der Boß ist, Junge.«
»Ich… weiß es… nicht…«
Da wurde drüben auf dem weiten Hof des Depots wieder geschossen.
Gellend schrie ein Mann auf.
Und dann brüllte ein anderer. »Er steht da drüben hinter der großen Regentonne! Los, durchsiebt ihn!«
Das war die Stimme des rothaarigen Mannes, der oben am Roten See in den Silver Mountains den Sprecher gemacht hatte.
Wyatt nahm dem Verwundeten die Waffen weg und rannte auf die Vorderfront des Depots zu.
Da tauchte vor ihm aus dem Dunkel des Eingangs eine Gestalt auf.
Der Mexikaner! Er riß den Revolver hoch.
Wyatt schoß gedankenschnell.
Die Kugel riß den Arm des Banditen zurück. Der Mexikaner stieß einen tierischen Schrei aus.
Es war nur einen winzigen Augenblick still, und in diese Stille hinein fiel das leise metallische Klicken eines Revolverhahns hinter dem Marshal.
Der Missourier warf sich zur Seite. Aber schon fauchte ihm der Schuß entgegen und streifte ihn sengend an der linken Wange.
Etwa sieben Yards vor sich sah der Marshal auf der Straßenmitte im schwachen Sternenschein einen Mann stehen.
Er erkannte ihn sofort an dem weiten Ausschnitt der Jacke. Das weiße Rüschenhemd leuchtete durch die Dunkelheit. Es war der Mann mit der weinroten Schleife.
Der Big Boß der Graugesichter?!
Da blitzte es in der Faust des anderen wieder auf. Haarscharf zischte die Kugel am Kopf des Marshals vorbei.
Und in ihren Mündungsschlitz hinein feuerte der Marshal.
Der schwere Buntline Spezial röhrte auf, und die Kugel sprang den anderen an.
Sein Körper bekam einen Stoß. Aber er blieb stehen!
Jetzt hatte sich auch Wyatt aufgerichtet. Er sah, daß der Arm des anderen hinuntergesunken war.
Auf sieben Yards standen die Männer einander gegenüber.
Drüben im Hof des Depots war es still geworden.
Der Mann mit der weißen Hemdbrust hatte am Boden gelegen; jetzt stand er langsam wieder auf. Reglos verharrte er sieben Yards vor dem Marshal.
Er hatte den Revolver noch in der Hand. Aber er hob diese Hand nicht.
Wie gebannt fixierte ihn der Marshal.
Da drang ein winziges Geräusch von hinten an Wyatts Ohr. Der Marshal federte herum.
In diesem Augenblick brüllte ein Schuß auf, der den Mann mit der weißen Hemdbrust niederriß.
Es war der Mexikaner!
Mit weiten Sätzen suchte er zu entkommen.
Wyatt stieß den Buntline vor und jagte ihm einen Schuß nach.
Doch die Kugel riß dem Banditen nur den Hut vom Kopf. Er hatte schon die Hausecke erreicht und verschwand hinter ihr.
Wyatt wandte sich um. Er sah, daß der andere am Boden lag.
Er lief auf ihn zu, packte ihn unter den Armen und schleifte ihn auf den Eingang des Depots.
Der Mann war tot. Sein eigener Komplice hatte ihn niedergeschossen.
Wyatt zerrte dem Desperado den großen Ring vom Finger und schob ihn in die Tasche.
Da krachte hinten im Hof wieder ein Schuß.
Wyatt kroch vorwärts und blickte vorsichtig über die niedrige Mauer.
Da sah er am unteren rechten Ende des Hofes den Spieler stehen. Auch seine spitze weiße Hemdbrust schimmerte durch die Dunkelheit.
Links hinter einem umgestülpten Wagenkasten knieten zwei Männer, die jetzt schossen.
Dann blitzten die Revolver des Gamblers auf. In einem harten Stakkato fielen seine Schüsse jetzt durch den Hof.
Wyatt schob seinen sechskantigen Buntline Special über die Mauer.
»Hände hoch!« rief er.
Einer der Banditen nahm die Hände hoch. Der andere sprang auf und schoß.
Aber eine Kugel des Missouriers riß ihn nieder.
Wyatt schwang sich über die Mauer und stürzte sich dem anderen Mann entgegen, riß ihm die Waffe aus der Hand, packte ihn am Kragen, nahm seinen Gefährten und schleppte beide über die Straße auf des Sheriffs Office zu.
Glücklicherweise war das Jail leer. Die Gefangenen, die darin gesessen hatten, waren abtransportiert worden.
So hatte der nächtliche Kampf in Marana eine unheimliche Wendung für die Desperados genommen. Drei von ihnen saßen im Jail, einer war tot, zwei waren schwer verletzt, und einer war entkommen.
Der Mexikaner!
Aber Wyatts Vermutung, daß die sieben Männer nicht allein in der Stadt gewesen waren, sollte sich bestätigen.
Als der Marshal das Office verließ, klatschte ihm drüben vom Vorbau her ein Schuß entgegen, der auf eine eiserne Krampe neben der Tür aufschlug und abprallte.
Der Marshal beobachtete die andere Straßenseite.
Drüben in der Reihe niedriger Häuser erhob sich nur ein zweigeschossiger Bau. Von dort mußte der Schuß gekommen sein.
Der Marshal blieb auf dieser Straßenseite, ging ein Stück weiter, überquerte dann erst hundertfünfzig Yards weiter westlich den Fahrdamm und ging auf der anderen Straßenseite zurück.
Als er in die Nähe des bewußten Hauses kam, blieb er stehen. Es war eine Schuhmacherwerkstatt.
Er bewegte sich langsam vorwärts und drückte gegen die Haustür. Sie gab nach. Im Hausflur herrschte völlige Dunkelheit.
Er tastete sich vorwärts.
Rechts führte eine Treppe zum Obergeschoß hinauf.
Wyatt horchte nach oben und glaubte, ein Geräusch vernommen zu haben.
Da peitschte draußen auf der Straße ein Schuß auf.
Im gleichen Augenblick waren oben Schritte zu hören, und dann quietschte eine Tür.
Der Mann war also oben im Gang gewesen und lief jetzt ins Zimmer zurück, um auf die Straße zu blicken.
Das war Wyatts Chance. Er schlich die Treppe hinauf, sah sofort die kaum angelehnte Tür. Er blickte durch deren Spalt und sah einen Mann drüben am Fenster stehen.
Es war ein Bursche von höchstens achtzehn oder neunzehn Jahren, der sich in die Fensternische gepreßt hatte und ein Gewehr in den Händen hielt.
Wyatt spannte knackend den Revolverhahn.
»Hände hoch!«
Der Bursche warf den Kopf herum und ließ vor Schreck sein Gewehr fallen.
Der Marshal trat in das Zimmer und blickte sich den Heckenschützen genauer an.
Der Bursche hatte ein gelbliches, verkniffenes Gesicht und einen zynischen Zug um die Augen. Er trug die Kleidung eines Cowboys.
Was mochte diesen halbwüchsigen Burschen veranlaßt haben, sich so zu verhalten?
Vielleicht war aus ihm etwas herauszubringen. Der Marshal hatte immer wieder die Erfahrung gemacht, daß mit jüngeren Menschen viel eher zu reden war als mit älteren.
Er blieb vier Yards vor dem Burschen stehen und fixierte ihn mit einem kühlen forschenden Blick.
»Wie heißt du?«
»Jim.«
»Nur Jim?«
»Jim Terkins.«
»Du gehörst also zu den Galgenmännern.«
Der Bursche zuckte zusammen, als der Marshal ihm diese Worte entgegenschleuderte.
»Nein!« brüllte er, und eine beinerne Blässe überzog sein Gesicht.
»Doch, Jim. Du brauchst mir nichts zu erzählen, ich weiß Bescheid.«
»Nein, das stimmt nicht, Mr. Earp!«
»Rede nicht. Wenn ein Bursche in deinem Alter verrückt genug ist, einen Sheriff niederschießen zu wollen, dann kann er nur von einer solchen Bande dazu aufgestachelt worden sein.«
»Nein, Marshal…, ich beschwöre Sie…«
»Ich habe gesagt, du sollst schweigen. Du kannst dich schon daran gewöhnen, ehe du ins ewige Schweigen eingehst.«
Der Junge riß die Augen weit auf. Hündische Angst stand in ihnen.
»Wollen Sie damit sagen…, daß ich an den Galgen komme?«
»Das wird dir wohl nicht erspart bleiben, Jim.«
Da trat der Bursche zwei Schritte vor. Er kämpfte sichtlich mit sich. Endlich rang er sich dazu durch, wenigstens zu gestehen: »Sie haben mich dazu gezwungen!«
»Wer?«
»Die anderen.«
»Junge, laß dir nicht jede Einzelheit wie mit der Leimrute rausziehen.«
Jim Terkins ließ den Kopf sinken.
»Nein, es hat ja doch keinen Zweck. Ich muß hängen. Und dann sollen sie nicht leben! Diese Schurken! Sie haben meinen Vater und meinen Bruder gezwungen, für sie zu arbeiten…«
»Wer ist der Anführer?«
»Das weiß ich nicht. Wir bekamen unsere Befehle immer von Breek.«
»Erzähle mir keine Stories, Bursche. Jerry Breek kann dir den Befehl auf uns zu schießen, nicht gegeben haben. Er sitzt nämlich irgendwo fest im Jail.«
»Nein, Breek war unser Boß. Aber…«
»Rede weiter!«
Der Bursche warf den Kopf hoch. Es brannte in seinen Augen.
»Ich kann es nicht, Marshal.«
Da trat Wyatt auf ihn zu, packte ihn an beiden Schultern und schüttelte ihn heftig.
»Rede«, befahl er eindringlich. »Vielleicht kannst du dir damit den Galgen ersparen.«
»Wirklich?« Eine flehentliche Bitte lag in diesem einen Wort.
»Rede also.«
Jim Terkins ließ den Kopf sinken und flüsterte: »Hawler ist es!«
»Hawler?« Wyatt zog die Brauen zusammen.
»Wo wohnt er?«
»Ich weiß es nicht.«
»Aber er muß sich doch jetzt hier in Marana aufhalten.«
»Ja, er ist hier.«
»Wo?«
»Im ›Sandfloh‹.«
»Ist das die schmutzige Schenke hinter der City Hall?«
Der Bursche nickte.
»Wie sieht er aus?« fragte Earp.
»Er ist kleiner als Sie, Mr. Earp, und hat schwarzes Haar und helle Augen. Er trägt einen dunklen Anzug wie Doc Holliday.«
»Wie alt ist er?«
»Etwas jünger als Sie.«
»Wer ist bei ihm?«
»Ich weiß es nicht. Heute morgen waren zwei Männer bei ihm.«
»Kennst du sie?«
»Nur den einen. Es ist Joe Halbon. Ein bulliger Mann von vielleicht vierzig Jahren. Er ist bärenstark und gefährlich.«
»Und den anderen kennst du nicht?«
Terkins schüttelte den Kopf.
»Wo ist dein Vater, und wo hält sich dein Bruder auf?«
»Sie sind beide noch draußen auf unserer kleinen Farm.«
»Wo liegt die Farm?«
»Sechs Meilen südwestlich von der Stadt.«
»Also auf dem Weg nach Avra?«
Terkins nickte. Dann warf er den Kopf wieder hoch und hob beteuernd die Hände.
»Mr. Earp, wir haben noch nicht lange mit den Grauen zu tun. Sie kamen eines Tages auf unsere Ranch und forderten von meinem Vater, daß wir mit ihnen arbeiten müßten. Sie drohten, wenn wir uns weigerten, würde unsere Ranch auflodernd in Flammen aufgehen.«
Wyatt überlegte einen Augenblick, dann entgegnete er.
»Ich werde feststellen, wie weit das, was du mir gesagt hast, der Wahrheit entspricht.«
Er packte den Burschen am Arm und führte ihn hinüber ins Jail, wo er ihn in eine Zelle sperrte.
Als der Marshal aus dem Bureau trat, sah er drüben in der Mündung einer Gasse Doc Holliday stehen.
Der Spieler winkte ihm zu und deutete nach rechts hinüber, wo der »Sandfloh« lag, eine winzige Spelunke, die sie bis jetzt kaum beachtet hatten.
Sollte Holliday Hawler und seine beiden Kumpane bereits entdeckt haben?
Wyatt deutete ihm mit Zeichen an, daß er durch den Hof in die Schenke kommen werde.
Der Gambler nickte und verließ sofort seinen Platz in der Gassenmündung, um sich gegenüber der Schenke aufzubauen, womit er die Aufmerksamkeit der Banditen natürlich auf sich lenkte.
Hawler, Halbon und der Kreole Simeon Portega standen hinter den Fenstern der Schenke und starrten auf die Straße hinaus.
Hawler hatte die Fäuste in die Taschen geschoben.
»Seht euch bloß an, wie der da drüben steht! Er weiß Bescheid.«
Der schwere Halbon schüttelte den Kopf.
»Ich glaube es nicht. Das bildest du dir nur ein, Haw.«
Der Kreole schwieg.
Da stampfte Hawler mit dem Fuß auf.
»Ihr müßt verrückt sein, wenn ihr das nicht merkt! Glaubt ihr denn, er steht da drüben, um die Wolken zu zählen?«
Da wurde im Hintergrund der Schenke lautlos die Hoftür geöffnet. Nur der Mann hinterm Tresen, der alte Billinger, sah den Missourier eintreten.
Wyatt legte warnend den Finger auf den Mund.
Der Keeper nickte.
Da stieß Hawler seinen Kumpan Halbon an.
»Los, wir gehen hinaus und machen ihn fertig, ehe der Marshal dazukommt.«
»Der Marshal ist schon da!« drang es da schneidend an die Ohren der drei Banditen.
Hawler fuhr sofort herum. Aber er erstarrte in der Bewegung, als er in den beiden vorgestreckten Händen des Missouriers die Revolver sah.
»Hände hoch!«
Wyatt gab dem Keeper einen Wink, den drei Banditen die Revolver abzunehmen.
»So, und jetzt raus hier!«
Auf dem Vorbau blieb Hawler stehen.
»Wo wollen Sie uns hinschleppen, Earp?«
»Das fragst du noch, Bandit?« rief ihm Doc Holliday spöttisch entgegen. »Natürlich ins Hotel Du Nord zum Galadinner.«
Die beiden Dodger verließen das Office wieder. Aber diesmal durch die Hoftür, um nicht wieder von einem Heckenschützen überrascht zu werden.
So viel also stand fest: die Galgenmänner waren mit einem bedeutend größeren Aufgebot nach Marana gekommen, als der Marshal angenommen hatte. Und sie waren auch nicht neu hier in der Gegend. Wie sich jetzt herausstellte, waren schon seit einiger Zeit ihre Unterführer hier tätig. Dieser Terkins beispielsweise mußte schon seit langem hier »wirken«.
Wer war der Tote drüben in dem kleinen Leichenhaus? War er wirklich der Anführer der Graugesichter?
Die beiden Dodger gingen durch den Hof eines Mietstalles auf die Mainstreet zurück und hielten auf das winzige Totenhaus zu.
Es war, wie in den meisten Städten, eine alte ausgediente Scheune, in die auf einen umgekippten Wagenboden die Toten gelegt wurden. Es war dunkel in dem kleinen Raum.
Der Marshal riß ein Zündholz an.
Entgeistert starrten die beiden auf den leeren Wagenkasten, auf den sie selbst vor einer halben Stunde den Toten hingelegt hatten. Er war verschwunden!
Wyatt riß noch ein Zündholz an und sah sich in dem kleinen Raum um.
Nichts! Die Scheune war völlig leer.
Holliday kippte den Wagenkasten vorsichtshalber um. Aber auch darunter war der Körper des Toten nicht verborgen.
Die beiden verließen den Schuppen und gingen auf einem Umweg in das Haus des Reverenden zurück.
Der kam ihnen zusammen mit dem Neger an der Tür entgegen. Der Gottesmann rang die Hände.
»Um Himmels willen, Marshal! Das ist die fürchterlichste Nacht, die ich je erlebt habe! Wie viele sind denn schon tot?«
»Ein einziger ist tot.«
»Wie konnten Sie ihn denn töten, Mr. Earp! Ich beschwöre Sie…«
»Seien Sie still!« fuhr Holliday ihn an. »Der Marshal hat ihn nicht getötet. Einer seiner eigenen Banditen hat auf ihn geschossen.«
»Kennen Sie den Mann?«
»Nein. Ich kenne ihn nicht. Höchstwahrscheinlich ist es der Führer der Graugesichter«, entgegnete der Missourier schroff.
Wyatt war weiter in den Flur hineingegangen und stand schon an der Treppe.
»Was soll denn nun werden?« rief ihm der Reverend nach.
»Das wird sich finden. Jedenfalls ist der Angriff auf das Railway-Depot abgeschlagen, und die Bande sitzt drüben im Jail.«
»Die Bande? Die Graugesichter sitzen im Jail… Da haben Sie dem Sheriff ja eine schwere Aufgabe aufgebürdet«, meinte der Reverend.
Wyatt nahm die Brille aus der Tasche und gab sie ihm zurück. Den Mantel des Negers hängte er über den Treppenpfosten.
»Ich habe ihm überhaupt keine Aufgabe aufgebürdet, Mr. Walker. Niemand in dieser Stadt wird ihm mehr eine Aufgabe geben.«
»Um Himmels willen, ist er etwa lebensgefährlich verletzt? Oder gar tot…«, stammelte der Geistliche.
»Nein«, entgegnete Holliday brüsk, »er ist geflohen. Er hat dem Marshal den Stern vor die Füße geworfen. So sieht es in Ihrer sauberen Stadt aus, Mr. Walker.«
Die beiden gingen hinauf in ihre Zimmer und holten ihre Sachen.
Als sie zurückkamen, trat der Reverend ihnen noch einmal entgegen. »Ich habe mich dumm ausgedrückt, Gentlemen. Ich meinte es natürlich nicht so. Wir sind alle jetzt kopflos durch die furchtbaren Ereignisse.«
»Schon gut«, antwortete der Marshal.
»Wo wollen Sie hin?«
»Wir werden weiterreiten.«
Da umspannte der Reverend mit beiden Händen den rechten Unterarm des Marshals.
»Mr. Earp, bitte, verzeihen Sie«, preßte er heiser hervor. »Ich war so erregt. Sie müssen es verstehen. Ich bin kein Mann, der mit dem Revolver umgehen kann. Und… ich weiß, daß ich unkluge Worte gesprochen habe. Sie müssen großherzig genug sein, mir zu verzeihen. Das alles hat mich furchtbar schockiert. Es ist abscheulich von dem Sheriff, daß er Sie und die Stadt im Stich gelassen hat. Ich habe es mir gerade überlegt, das heißt, der schwarze Samuele hier hat es mir noch einmal deutlich vor Augen geführt: Ohne Sie hätte es in der Stadt fürchterlich werden können. Sie haben nicht nur das Depot der Railway gerettet, sondern ganz Marana! Ich möchte nicht wissen, wie die Galgenmänner hier gehaust hätten, wenn Sie ihnen freien Lauf gelassen hätten.«
Wyatt blickte forschend in die hellen Augen des Geistlichen. Er konnte den Mann verstehen. Es war nicht jedem gegeben, in einer solchen Nacht eiserne Nerven zu behalten.
»Bitte, bleiben Sie doch«, bat der Priester. »Wohin wollen Sie jetzt in der Dunkelheit reiten?«
Der Marshal wechselte einen Blick mit dem Georgier und nickte dann.
»Schon gut, Rev. Dann bleiben wir bis morgen. Immerhin ist einer der Banditen entkommen. Und wir finden in der Morgenfrühe seine Fährte höchstwahrscheinlich besser als jetzt in der Nacht.«
Der Angriff auf das große Railway-Depot in Marana war abgeschlagen.
Aber das Geheimnis um den Toten blieb.
Keiner der Männer im Jail wollte ihn kennen.
Der Rotschopf war zwar nicht lebensgefährlich getroffen, doch so schwer verwundet, daß er vernehmungsunfähig war. Und von ihm allein hätte man schlüssige Auskunft bekommen können.
Hatte der Mexikaner die Leiche des Anführers verschwinden lassen?
Wyatt Earp hatte die Stadt schon im Morgengrauen verlassen wollen. Aber die Suche nach dem Toten hielt ihn noch in Marana fest.
Es war gegen halb neun, als Doc Holliday aus dem Hof des Schmiedes kam und dem Marshal zuflüsterte: »Da ist irgend etwas nicht in Ordnung.«
»Haben Sie mit dem Schmied gesprochen?«
»Ja, es ist ein mürrischer Bursche. Vielleicht fünfzig. Irgend etwas verheimlicht der Kerl.«
Wyatt Earp betrat die Schmiede allein.
Der Blacksmith, ein bärtiger, rußiger Mann mit kahlem Schädel und grüner Lederschürze, trat ihm entgegen. Muffig fragte er: »Was suchen Sie hier, Mr. Earp?«
»Ich suche einen Toten.«
»Einen Toten? Ich habe mir schon gedacht, daß Doc Holliday auch irgend so etwas suchte…«
»Ach, das haben Sie sich gedacht. Wie kamen Sie darauf?«
Der Schmied merkte, daß er sich verplappert hatte.
Plötzlich griff er nach einem glühenden Eisenhaken, der in der Esse lag und riß ihn hoch.
Gedankenschnell riß der Marshal den linken Fuß hoch und traf den Schmied am Unterarm.
Die Eisenstange flog durch die ganze Werkstatt und schlug auf den Treppenstufen zur Wohnung krachend auf.
Metallen drang die Stimme des Marshals an das Ohr des Schmiedes.
»Wo ist er?«
Der Schmied senkte den Kopf. »Ich habe nichts damit zu tun… Heute nacht ist ein Mann zu mir gekommen und hat ihn gebracht…«
»Wo ist er?« wiederholte der Marshal seine Frage mit erhöhter Lautstärke.
Der Schmied wagte nicht mehr aufzublicken.
»Der Mann kam in der Nacht und schleppte ihn hierher!«
»Wo ist er?«
Der Schmied deutete über die Schulter.
»Im Stall. Er liegt in der Futterkammer.«
»Kommen Sie mit.«
Der Schmied schüttelte den Kopf.
»Nein, ich komme nicht mit.«
»Sie kommen jetzt mit.« Wyatt packte ihn am Arm und zog ihn auf die Hoftür zu.
Da stockte der Fuß des Blacksmith. Er sah Doc Holliday im Hof stehen.
»Er ist ja auch da.«
»Ja, Sie werden doch nichts dagegen haben? Kommen Sie!«
Sie gingen mit dem Schmied durch den Stall in die Futterkammer.
Hinter einer Futterkiste lag der Leichnam in eine Decke geschlagen.
Wyatt blickte auf ihn nieder und fragte den Schmied: »Kennen Sie den Mann?«
Der schüttelte mürrisch den Kopf. »Nein, ich habe ihn nie gesehen.«
»Weshalb haben Sie mir nicht gesagt, daß er hier liegt?«
»Weil… weil… ich Angst hatte!«
»Ja, das ist eine gute Ausrede, Blacksmith.«
Unverwandt blickte der Missourier in das bleiche Gesicht des Toten.
Und plötzlich hatte er ein ganz eigenartiges Gefühl, das ihm sagte: Dieser Mann ist nicht der Chief der Galgenmänner.
Doc Holliday, der bis jetzt geschwiegen hatte, schüttelte den Kopf und sagte leise: »Nein, das ist er nicht.«
Wyatt blickte ihn verblüfft an. »Wie kommen Sie darauf?«
»Ich habe über den ganzen Überfall nachgedacht. Es waren sicher einige Männer vom Roten See dabei – aber nicht der Chief. Wenn er dabeigewesen wäre, hätte das Ganze ein anderes Gesicht gehabt.«
Der Marshal nickte. »Das glaube ich auch.«
Es blieb einen Augenblick still. Dann wandte sich der Missourier an den Schmied: »Da Sie sich so heiß bemüht haben, den Toten zu verbergen, haben Sie jetzt die Aufgabe, für seine Bestattung zu sorgen.«
»Ja, das werde ich! Denn ich habe keine Lust, mich von den Galgenmännern…«
Wyatt packte ihn am Arm. »Ihren Kommentar können Sie sich sparen, Blacksmith…«
Sie verließen das Anwesen des Schmiedes und suchten den Mayor auf.
Es war ein alter Mann mit runzligem Gesicht, der in einer Quergasse eine Sattlerwerkstatt führte.
Der alte Joe Henderson machte ein unglückliches Gesicht, als der Marshal bei ihm auftauchte.
Wyatt unterrichtete ihn davon, daß er im Post Office eine Drahtnachricht nach Tucson aufgegeben habe. »Noch heute werden zwei Männer kommen, die die Gefangenen abholen werden.«
Der greise Bürgermeister von Marana nickte.
»Es ist gut, Earp.«
Es war dem Alten anzumerken, daß er froh war, nicht weiter mit der Sache beschäftigt zu werden.
Der Kampf um das Depot von Marana war zu Ende.
Die Graugesichter hatten eine schwere Schlappe erlitten.
Wyatt Earp suchte noch einmal den schwerverletzten rothaarigen Mann auf, der oben am See in den Silver Mountains den Sprecher der Maskenmänner abgegeben hatte.
Der Mann machte jetzt einen frischen Eindruck und schien sich schon erholt zu haben.
»Sie wissen, wer der Tote ist, den der Mexikaner versucht hatte wegzuschaffen?« fragte Wyatt ihn.
Der Rote schwieg beharrlich.
Da schickte ihm der Marshal einen eisigen Blick zu.
»Damit wir uns verstehen, Mister, wenn Sie aus diesem Bett aufstehen können, dann nur, um den Weg zum Galgen anzutreten.«
Da riß der Bandit die Augen auf.
»Zum Galgen? Nein, dazu haben Sie kein Recht!«
»Dieses Recht benötige ich nicht. Der Richter hat es. Er wird Sie hängen.«
Wie viele Banditen, so schreckte auch dieser Mann vor der furchtbaren Strafe, die ihm da drohte, zurück. Durch die schwere Verwundung war auch sein Widerstandswille sehr geschwächt. Und so knurrte er jetzt: »Ich werde nicht an den Galgen kommen. Ich habe niemanden ermordet.«
»Trotzdem werden Sie an den Galgen kommen. Sie können sich ja bei Ihrem Boß dafür bedanken, der Sie hierhergeschickt hat und im letzten Augenblick ausgestiegen ist.«
»Ja, ich weiß«, entfuhr es dem Rotbärtigen. »Er ist immer im allerletzten Augenblick ausge…« Jäh brach er ab.
Zu spät aber hatte er seinen Fehler bemerkt. Jetzt wußte Wyatt, daß seine Vermutung ihn nicht getrogen hatte: Der Mann, der beim Kampf um das Depot sein Leben gelassen hatte, war nicht der Anführer der Graugesichter!
So sollte denn die Jagd nach diesem unheimlichen Mann erneut weitergehen?!
Der Marshal sog die Luft tief durch die Nase ein und wandte sich um. Mit schweren Schritten verließ er das Haus, in dem der Verwundete untergebracht worden war.
Als Wyatt Earp und Doc Holliday in ihren Sätteln saßen, um die Stadt zu verlassen, stand der Reverend neben dem Neger in der Hoftür und blickte finster vor sich hin.
Wyatt bedankte sich mit kurzen Worten noch einmal für das Quartier.
Der Neger sagte leise: »Fare well, Marshal!«
Auch dem Spieler schickte er einen Gruß zu.
Da hob der Reverend den Kopf.
»Auch ich wünsche Ihnen einen guten Weg, Mr. Earp. Ebenso Ihnen, Doktor. Sie dürfen es mir nicht übelnehmen, daß ich kein frohes Gesicht machen kann bei diesen furchtbaren Dingen, die sich hier zugetragen haben.«
Wyatt blickte ihn verwundert an.
»Wer hat das denn erwartet, Mr. Walker? Glauben Sie, wir fänden diese Dinge angenehm? Aber wenn wir den Banden nicht den Kampf ansagen, dann werden sie schlimmer und wachsen von Tag zu Tag. Sie haben ja gesehen, wie schwer es ist, eine solche Bande niederzuringen.«
Der Reverend schüttelte den Kopf. »Sie werden sie nicht niederringen, Mr. Earp. Diese Organisation ist zu stark, zu groß, zu weit verbreitet…«
Mit diesen wenig ermutigenden Worten bedacht, hatten sich die beiden Dodger auf den Weg gemacht.
Da aus den Gefangenen nichts weiter herauszubringen gewesen war, blieb ihnen nichts anderes übrig, als dem Mexikaner zu folgen. Er allein stellte jetzt noch die Verbindung zur Spitze der Bande dar.
Immerhin hatte der Verbrecher Gefolgstreue genug seinem Clan gegenüber bewiesen, indem er die Leiche des Anführers dieses Coups hatte beiseite schaffen wollen.
Er allein war nun entkommen.
Und seine Fährte mußte doch zwangsläufig zu dem großen Boß führen, der im letzten Augenblick ausgestiegen war.
Wichtig war für Wyatt Earp jetzt die Tatsache, daß sich der Bandenführer nicht drüben irgendwo fern in New Mexico oder gar jenseits der Grenze in Mexiko selbst aufhielt, sondern hier in der Nähe. Da der Überfall auf die Arizona-Bank von Casa Grande und der Überfall auf das Railway-Depot von Marana in so kurzen Zeitabständen aufeinander gefolgt waren, war anzunehmen, daß sich der Chief der Banditen irgendwo zwischen diesen beiden Städten befand. Und zwischen diesen beiden Städten lag Wymola, und da lag auch die einst durch ein blutiges Indianergefecht berüchtigt gewordene Stadt Red Rock.
Auf diese Stadt ritten die beiden Dodger zu.
Es war gegen halb zwölf, und aus dem Dunstschleier der Erde stieg die Sonne, um ein warmes Licht auf die Savanne zu werfen.
Als Doc Holliday mit der Linken in die Tasche griff, um sein Zigarettenetui hervorzunehmen, sah der Marshal, daß er ein breites Pflaster unter dem Handgelenk trug.
»Sie sind verletzt worden?«
Der Spieler winkte ab.
»Nicht so wichtig.«
Wyatt, der den sengenden Streifschuß an seiner Wange schon längst vergessen hatte, griff nach Hollidays Arm und schob die Manschette zurück.
Da sah er zu seiner Verblüffung, daß rechts und links unter dem Pflaster ein breiter, von einer blutigen Kruste bedeckter Riß hervorsah.
»He, das ist ja eine fingerlange, dicke Wunde. Ich wußte gar nicht, daß Sie verletzt worden sind.«
»Ach, wozu sollte ich Sie damit noch aufhalten.«
»Das sieht ja aus wie ein Messerriß.«
»Genau das ist es auch.« Holliday schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen und riß am Daumennagel der linken Hand das Zündholz an.
In die erste Rauchwolke hinein sagte er, ohne den Blick vom Weg zu wenden. »Es war der Mexikaner. Bevor Sie die Schießerei vorn am Depot hatten, war er bei der Mauer. Die beiden anderen müssen mich an der Scheune entdeckt haben. Sie kippten den Wagen um und beschossen mich von da aus. Ich achtete zu sehr auf sie und widmete dem Gassendurchgang zu wenig Aufmerksamkeit. Da war der Bandit plötzlich vor mir, sprang mich an und riß das Messer hoch, um es mir in die Brust zu stoßen. Ich konnte ihn abwehren und stieß ihn zurück. Da warf er sich zur Seite und sprang auf die Mauer zu, während ich mich vor den Kugeln der anderen in Sicherheit bringen mußte. Als ich in einer Gefechtspause nach dem Mexikaner sehen wollte, hatte er sich längst über die Mauer davongemacht. Er tauchte dann ja vor dem Depot bei Ihnen auf.«
So hatte sich also der Mexico Man als der gefährlichste Bandit von Marana erwiesen.
Wo war er hingeritten?
Holliday meinte, während er die Zündhölzer in die Tasche zurückschob: »Schade, daß wir Luke Short nach Tombstone zurückschicken mußten. Wir hätten ihn in der vergangenen Nacht bestimmt gebrauchen können.«
»Ja, das habe ich ein paarmal gedacht; aber es ist wichtig, daß in Tombstone einer nach dem Rechten sieht.«
»Leider.«
Sie ritten eine Weile schweigend weiter.
Die Savanne vor ihnen stieg langsam an und war von Büschen leicht durchsetzt. Die Sonne hatte jetzt die Nebelschwaden ganz vertrieben. Ein klarer tiefblauer Dezemberhimmel lag über dem Land.
Da meinte der Spieler plötzlich: »Es ist sonderbar, in ein paar Wochen haben wir Weihnachten, und ich hatte gedacht, daß wir dann längst wieder in Dodge wären.«
»Ja«, entgegnete der Missourier, »das hatte ich auch gedacht. Ich habe Masterson von Tombstone aus noch einen Brief geschrieben, daß ich Anfang Dezember bestimmt wieder daheim sein würde.«
Der Marshal dachte daran, daß der weite, lange, anstrengende Ritt sicher nicht nur die Gesundheit seines Gefährten strapazierte, sondern auch seine Geldmittel sehr geschwächt haben mußte.
»Was ich noch sagen wollte, Doc – ich kann nicht verlangen, daß Sie mich noch weiter begleiten. Schließlich verdienen Sie ja nichts dabei.«
Der Georgier lachte leise in sich hinein.
»Verdienen Sie etwas dabei?« fragte er, ohne den Marshal anzusehen.
Wyatt zog die Schultern hoch. »Ich bekomme schließlich meinen Lohn.«
Holliday schüttelte seinen Kopf. »Das nennen Sie Lohn? Hundert Dollar? Das ist eine Schande für dieses reiche Land. Ich bin ganz sicher, daß die Leute in diesem Lande sich eines Tages schämen werden, einem Mann wie Wyatt Earp eine so schändliche Besoldung gezahlt zu haben. Für diese lumpigen Kröten schlagen Sie Tag für Tag Ihr Leben in die Schanze, nur, um dem Gesetz hier Bahn zu brechen.«
Wyatt hielt die Zügel an und stützte sich aufs Sattelhorn.
Auch Doc Holliday hatte sein Pferd angehalten. Die beiden Männer blickten einander an.
»Doc«, sagte der Marshal mit belegter Stimme, »wir reiten noch nach Red Rock. Und wenn wir den Mexikaner da nicht finden, dann machen Sie sich auf den Heimweg. Ich kann es nicht verantworten, daß Sie so lange mit mir reiten. Sie verdienen nichts. Wir haben in keiner Stadt so viel Muße, daß Sie an irgendeinem Spieltisch Ihre Barschaft etwas auffrischen könnten, und dauernd geraten Sie durch mich in Teufels Küche. Ich will das alles nicht. Ich kann es gar nicht verantworten, daß Sie Ihr Leben dauernd für mich in die Schanze schlagen.«
Der Spieler lachte klirrend, wandte den Kopf und blickte über die Savanne nach Westen. Es war eine unendliche Traurigkeit in seiner Stimme, als er jetzt sagte: »Es ist doch völlig egal, Wyatt, wohin ich reite und wo ich gerade bin. Meine Zeit ist sowieso bemessen, scharf bemessen, Marshal Earp. Glauben Sie, ich wüßte nicht, wie es um mich steht? Der Dorn in meiner Brust frißt und frißt sich unaufhaltsam weiter vor. Wenn es auch eine Zeitlang gutging und ich es leicht überwinden konnte – so hat sich doch nichts geändert.«
Wyatt betrachtete den Freund voll tiefsten Mitleides. Er wußte genau, daß es nicht leicht war, die schweren Anfälle zu überwinden, die den todgeweihten Mann immer wieder packten. Nur mit eiserner Energie und einem unerhörten Willen konnte der Georgier vor der Welt verbergen, was in ihm vorging.
Vor Jahren hatte er sich als blutjunger Arzt oben in Boston die Krankheit von einem Patienten geholt, der ihn mehrmals in seiner Praxis aufgesucht hatte. Nur wegen dieser Krankheit hatte er seine so hoffnungsvoll begonnene Karriere aufgegeben und war in den Westen gezogen, um nun ruhelos als Spieler durch die Staaten zu ziehen. Seit einiger Zeit nun ritt er mit dem Marshal Earp, ohne irgendeinen Lohn dafür zu bekommen, teilte er jede Gefahr wortlos und fraglos mit dem Freund.
Anfangs hatte er nur den Tod gesucht. Wyatt wußte genau, daß es nicht das Gesetz war, für das Holliday kämpfte; er kämpfte für den Freund. Aber konnte es ein Mensch verantworten, einen anderen als Beschützer ohne jede Entlohnung mit sich reiten zu lassen?
Der Marshal besaß nicht die Geldmittel, daß er einen Mann, der mit ihm ritt, hätte bezahlen können.
So konnte es nicht weitergehen. Ganz sicher waren die Geldmittel des Georgiers erschöpft. Es war Wyatt lange nicht aufgefallen, daß Holliday viel weniger rauchte als früher und nur noch selten einen Brandy trank. Das tat er ganz sicher nicht aus Gesundheitsrücksichten, denn dieser Begriff war dem Doktor Holliday fremd geworden. Er tat es ganz einfach, weil sein Geld zur Neige ging.
»Nein, Doc, so geht es nicht weiter. Ich habe zwar noch ein paar Dollars in der Tasche. Aber damit ist nichts geholfen.«
Der Spieler winkte ab. »Beruhigen Sie sich, Marshal. Red Rock ist eine hübsche kleine Stadt. Und ich habe gehört, daß es da zwei wunderbare Spielsalons gibt, in denen sich schon ein paar Dollars machen lassen werden. Außerdem – wie stellen Sie sich das vor? Jetzt bin ich wochenlang hinter diesem geheimnisvollen Chief der Galgenmänner hergeritten und will nun auch wissen, wie sein wahres Gesicht aussieht.«
Wyatt schüttelte den Kopf. »Nein, Doc«, entgegnete er ernst. »Es kann noch lange dauern, ehe ich diesen Mann gestellt habe, wenn es mir überhaupt gelingt, ihn zu stellen. Er ist bedeutend gefährlicher, geschickter und vorsichtiger, als ich geglaubt habe.«
Doc Holliday schnipste seine halbgerauchte Zigarette mit einer überlegenen Geste – so als hätte er noch hundert Stück davon in der Tasche – von sich in den gelben Sand der Savanne. Hochaufgerichtet saß er im Sattel, nahm mit der Linken die Zügelleine hoch und hob die Rechte ein wenig an. »Ich bin überzeugt davon, Marshal, daß Sie ihn stellen werden.«
Wyatts Kopf sank auf die Brust herunter. Ganz leise versetzte er: »Dann sind Sie der einzige Mann, der diese Überzeugung hat.«
Holliday lachte leise. »Das stimmt nicht ganz, Marshal. Es sind zwei Leute davon überzeugt. Der eine heißt John Holliday, und der andere Wyatt Earp.«
Der Marshal blickte auf. In seinen Augenwinkeln stand eine stille Freude. Dann reichte er dem Freund die Hand entgegen, die Holliday herzhaft drückte.
Wortlos ritten sie weiter dem fernen Red Rock entgegen.
*
Red Rock:
Eine Westernstadt reinsten Wassers. Zwei Dutzend graubrauner Kistenholzhäuser und etwa ebenso viele Scheunen, eine winzige Kirche, eine City Hall und eine Menge Corrals um die Stadt herum.
Wyatt Earp und Doc Holliday hatten die Dunkelheit abgewartet, um einem eventuellen Beobachter nicht gleich aufzufallen.
Aus einem großen Saloon, der an der rechten Straßenseite lag, drang das hämmernde, wenig melodiöse Geräusch eines Orchestrions, vermischt mit johlenden Männerstimmen und dem girrenden Kreischen einer Frau.
Wyatt blickte den Spieler an.
»Ist das einer Ihrer feinen Saloons, Doc?«
Der Georgier zog die Schultern hoch. »Ich weiß es nicht, Marshal, ich habe noch nicht hineingesehen.«
»Und die Geräuschkulisse, wie gefällt die Ihnen?«
»Die interessiert mich nicht.«
Die beiden ritten langsam weiter.
Vor einem kleinen Holzbau hing in die Straße hinein ein Schild, das von einem flackernden Windlicht beleuchtet wurde. Es trug die Aufschrift SHERIFF.
Die beiden Dodger stiegen von den Pferden. Doc Holliday blieb zwischen den Hengsten an der Halfterstange stehen, während der Marshal das Bureau betrat.
Vor dem Schreibtisch standen zwei Männer und sprachen mit dem Sheriff, der offenbar sehr aufgeregt war.
»Jetzt laßt mich mit eurem Kram in Ruhe, ich habe schließlich noch andere Sachen zu tun. Drüben in Marana waren in der letzten Nacht die Galgenmänner.«
Verblüfft horchte Wyatt auf. Wie konnte diese Nachricht schon bis hierhergedrungen sein?
Die beiden Männer stülpten ihre Hüte auf und schoben an ihm vorbei dem Ausgang zu.
Der Marshal konnte den Sheriff jetzt sehen. Es war ein kleiner mickrig wirkender Mann mit spitzem Gesicht, langer Nase und schmalem, dünnem Mund, der über einem eckigen Kinn wie ein Strich wirkte. Seine Augen waren dunkel und wurden von einem kleinen Klemmer bedeckt. Sein Haar wirkte wie eine zottige graue Perücke. Hätte dieser faltige, struppige Mensch nicht links auf seiner Jacke den sechszackigen Stern getragen, so wäre Wyatt nie auf den Gedanken gekommen, einen Sheriff vor sich zu haben.
Und das also war der Gesetzesmann von Red Rock? Ein unbehaglicher Gedanke. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, daß die Stadt nicht eben einen guten Ruf hatte und also einen guten Gesetzesmann brauchte.
Wyatt trat an die Schreibtischkante heran und grüßte den Sheriff.
Der sah auf, nahm den Klemmer von der Nase und zog den rechten Mundwinkel hoch, während er durch die Nase einsog.
»Was wollen Sie?«
»Ich hätte gern eine Auskunft.«
Der Sheriff schüttelte den Kopf. »Daß manche Leute meinen Laden immer wieder mit einem Auskunftsbureau verwechseln. Hier gibt’s keine Auskunft, Mister. Und jetzt lassen Sie mich zufrieden. Ich mache nämlich jetzt hier Schluß.«
Wyatt nahm seinen Hut ab und stützte sich mit beiden Händen auf die Schreibtischkante.
»Ich hätte gern gewußt, woher man hier schon in Red Rock von dem Überfall in Marana weiß, Sheriff.«
Der kleine Gesetzesmann blickte forschend in das Gesicht des Fremden.
»Hören Sie, Mister, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Lassen Sie mich zufrieden. Sie sehen, daß ich schon meine Papiere zusammenpacke. Ich muß irgendwohin.«
»Das kann schon sein, Sheriff. Dennoch hätte ich gern eine Auskunft auf meine Frage.«
Da packte der Sheriff seine Papiere, schob sie in eine Lade und klappte sie zu. Dann erhob er sich. Von der lächerlichen Höhe von einsachtundfünfzig aus blitzte er den Mann, der ihn um mehrere Kopfeslängen überragte, gallig an.
»Hören Sie, Mann. Ich habe Ihnen gesagt, daß ich keine Zeit habe. Mein Name ist Jeff Bitters, merken Sie sich das.«
Was denn, dieser Zwerg sollte Bitters sein, der berühmte Sheriff, der vor sieben Jahren hier auf der Mainstreet die Hancover-Brothers zur Strecke gebracht hatte? Wyatt richtete sich wieder auf, nahm seinen Hut und stülpte ihn sich auf den Kopf.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Bitters. Mein Name ist Earp. Ich komme von Marana…«
Der Sheriff hatte sich gerade seinen Waffengurt umgeschnallt, warf jetzt aber den Kopf hoch und nahm den Zwicker von der Nase, um den Marshal zu fixieren.
»Wie ist Ihr Name?« fragte er mit schiefgelegtem Kopf und krächzender Stimme.
»Earp, Wyatt Earp.«
Der Sheriff ließ den Waffengurt zu Boden gleiten, trat nahe an den Tisch und lehnte sich weit darüber.
»Sie sind Wyatt Earp? Der Marshal aus Dodge City?«
»Ja.«
»Dann kommen Sie tatsächlich von Marana! Ich habe nämlich von der Sache gehört. Sie sollen dort aufgeräumt haben in der vergangenen Nacht.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ein Mann, der hier in der Stadt war, erzählte es.«
»Es war wohl nicht zufällig ein Mexikaner?«
»Doch, wie kommen Sie darauf?«
Wyatt griff mit dem Fuß nach einem dreibeinigen Hocker und ließ sich schwer darauf nieder.
»Wo ist der Kerl?« preßte er durch die Zähne.
»Ich weiß es nicht. Er war drüben bei Gingers in der Bar, er müßte längst weg sein.«
»Kommen Sie.« Wyatt stand auf und ging hinaus.
Der Sheriff folgte ihm sofort. Er sah mit einem raschen Blick den Spieler bei den Pferden stehen.
»He, Sie sind bestimmt Doc Holliday.« Er wies mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf ihn.
Der Georgier nickte. »Ja, ich bin’s, auch wenn Sie nicht direkt auf mich zeigen.«
Der Marshal hatte inzwischen die Straße überquert und öffnete drüben die Tür der Schenke.
Sie war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Mit raschem Blick überflog der Missourier die Gaststube: Der Mexikaner war nirgends zu sehen.
Jetzt langte Bitters hinter ihm an, zwängte sich an ihm vorbei und trat an die Theke. Er fragte den Keeper: »Du, Jack, hast du den Mex gesehen, der heute mittag hier war?«
»Gesehen? Ja, heute mittag habe ich ihn gesehen. Er ist doch längst weg.«
Der Sheriff wies mit dem Daumen auf den Marshal, der in der Tür stand. »Da ist ein Freund von ihm, der hätte gern noch mit ihm gesprochen.«
»Tja, er ist weg.«
Bitters nickte und tat, als wolle er gehen. Dann wandte er sich noch einmal um.
»Schade, Jack, du hattest dich wieder so gut gemacht seit deiner Entlassung aus dem Zuchthaus.«
Der Keeper erbleichte. »Was soll das heißen, Sheriff«, stammelte er.
Da fauchte ihn der Sheriff mit plötzlich vorgestrecktem Raubvogelkopf an. »Du sollst die Wahrheit sagen, Kerl.«
Jack zog den Kopf ein und sah sich vorsichtig nach allen Seiten um. Dann beugte er sich vor und zischelte: »Er hat ein anderes Zimmer hier genommen. Gleich neben der Schankstube zu ebener Erde.«
Der Marshal wandte sich sofort um und trat auf den Vorbau.
Das Zimmer, das neben der Schankstube lag, hatte ein Fenster zur Straße hin. Und kein Licht.
Der Sheriff durchquerte sofort den Schankraum und ging in den Flur.
Die Tür zum Nebenzimmer war verschlossen.
Der kleine Bitters ging zwei Schritte zurück, hob den Stiefel und rammte die Tür ein. Das Zimmer war leer!
Bitters ging zurück an die Theke.
»Die Bude ist leer, Jack.«
»Dann ist er weg.«
»Wohin?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wo hatte er seinen Gaul?«
»Bei uns im Hof.«
Bitters ruderte durch die Tische zur Hoftür und stand eine Minute später im Stall.
Ein buckliger Peon war damit beschäftigt, auszumisten.
»Wo ist das Pferd des Mexikaners?«
Der Peon tat, als hätte er nicht gehört.
Da nahm der Sheriff seinen Revolver aus dem Halfter und spannte ihn.
Sofort richtete sich der Peon auf und hob die Hände.
»Er ist weggeritten.«
»Wann?«
»Vor zwei Stunden.«
Der Sheriff stieß ihm die Waffe auf die Brust.
»Auch wenn du ein Schmiergeld bekommen hast, Dreckskerl, wirst du mir die Wahrheit sagen. Wann ist er weggeritten?«
»Vorhin…«
»Ich habe gefragt, wann!«
»Ich… kann es nicht genau sagen. Vor ein paar Minuten, Sheriff.«
»Ah!« machte der Sheriff, sicherte seine Waffe und schob sie ins Halfter zurück.
Da wurde das Hoftor etwas aufgeschoben und der Marshal tauchte auf.
Bitters sah ihn sofort.
»Ach, Sie kommen schon von der richtigen Seite, aber leider auch zu spät, Marshal. Der Vogel ist schon ausgeflogen.«
»Schon lange?«
»Nein, er ist erst vor ein paar Minuten verschwunden. Höchstwahrscheinlich hat der Halunke Sie gesehen.«
»Ja, das kann gut sein. Er hat vielleicht an dem dunklen Fenster seines Zimmers gesessen und Ihren Laden drüben beobachtet. Nichts einfacher als das.«
Bitters stieß durch die lückenhaften Zähne: »Was werden Sie jetzt tun?«
»Gibt es ein Boardinghouse in der Stadt?«
»Nein, aber ein Hotel«, entgegnete der Sheriff.
»Ist es der hellerleuchtete Laden oben links in der Straße?«
»Ja, was wollen Sie denn dort? Glauben Sie, daß er sich da einquartiert hat?«
»Nein, aber er ist noch in der Stadt.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil ein Mexikaner seinen Sattel nie im Stich läßt.«
Der Sheriff blickte den Marshal verdutzt an. Er wandte sich dann um und ging in den Stall zurück. Als er herauskam, meinte er: »Damned, von Ihnen kann man noch eine Menge lernen! Der Bursche hat tatsächlich seinen Sattel zurückgelassen.«
*
Gib Jallinco hatte ein paar Stunden auf seinem Lager geschlafen, erhob sich und zündete die Lampe an.
Er trat ans Fenster, blickte auf die Straße und sah ganz zufällig drüben den Mann ins Sheriffs Office gehen. Es war nur eine kurze Sekunde, in der er gegen das helle Licht, das aus dem Office drang, die Konturen des Mannes sehen konnte.
»Wyatt Earp!« Jallinco wandte sich sofort um und löschte die Lampe, packte seinen Hut, seine Jacke, seinen Waffengurt und verließ das Zimmer.
Draußen im Hof drückte er dem Peon zwei Dollarstücke in die Hand, packte in Windeseile seinen Gaul, zog sich auf seinen ungesattelten Rücken und verließ den Hof durch das Tor, das auf eine Seitengasse hinaus mündete.
Er lauschte zur Mainstreet hinauf und wandte sich dann nach links, um die Gasse hinunterzureiten.
Da scheute sein Pferd plötzlich und stieg vorne hoch.
Als es wieder auf allen Hufen stand, hörte der Mexikaner jenes metallische Geräusch, das nur der gespannte Hahn eines Revolvers verursachen kann.
Er wollte zur Waffe greifen. Da aber drang eine klirrende Stimme an sein Ohr: »Laß die Hände oben, Mex.«
»Holliday!« entfuhr es dem Banditen.
»Ganz richtig. Und jetzt steig ab.«
Der Mexikaner blieb auf dem Pferderücken sitzen.
»Ich habe gesagt, du sollst absteigen«, forderte Holliday ihn auf.
Der Bandit rutschte von dem Pferderücken und versuchte abermals seine Hand dem Revolver zu nähern.
»Laß die Hände in Schulterhöhe, sonst wird’s kalt um dich, Boy, wie um deinen Freund drüben in Marana, der jetzt in der kalten Erde liegt. Ich kann dich gegen die helle Straße genau erkennen.«
»Was wollen Sie von mir, Holliday?«
»Das wirst du schon erfahren. Dreh dich um.«
Der Mexikaner wandte sich um. Plötzlich aber zuckte sein linker Absatz hoch, und die großen Sternradsporen trafen das Pferd unten in den Weichen.
Das Tier stieg hoch, schlug nach allen Seiten aus und tänzelte hin und her.
Der Mexikaner hatte sich sofort zur Seite geworfen und hastete die Gasse hinunter.
Doc Holliday folgte ihm sofort. Aber er mußte vorsichtig sein, da jetzt die Schritte des Mexikaners verklungen waren. Höchstwahrscheinlich kauerte der Bandit irgendwo am Boden und lauerte auf ihn.
Wie eine Katze bewegte sich der Gambler links auf einen Vorbau vorwärts.
Aber es blieb alles still.
Er lauschte in den Gang hinein.
Weit konnte der Mexikaner nicht gekommen sein. Sein Pferd stand oben mitten auf der Straße.
Da – hastige Schritte links am Vorbau!
Holliday sprang sofort über das Geländer auf die Straße.
Da aber war der Outlaw links in einer Parallelgasse verschwunden.
Als Wyatt Earp den Hof verließ, sah er sofort das Pferd in der Gasse stehen.
Er zog seinen Revolver und sprang zurück in die Tornische.
Aber in der Gasse war alles still.
Bitters stand rechts neben ihm.
»Hölle«, flüsterte er, »sieben Jahre ist in diesem Kaff nichts losgewesen, da kommen Sie, schon kommt man nicht mehr zu Atem.«
Die beiden schlichen die Gasse hinunter und mußten feststellen, daß der Mann schon verschwunden war.
Wyatt nahm das Pferd am Zügel und führte es über die Straße. Als er an seinen beiden Hengsten vorüberkam, bemerkte er, daß der Georgier verschwunden war. Er blieb stehen und sah sich um.
Da von dem Spieler nichts zu sehen war, nahm er die beiden Hengste mit und brachte sie zusammen mit dem Pferd des Mexikaners in den Stall des Sheriffs.
Bitters schloß die Stalltür und löschte die kleine Laterne.
»Und wo geht es jetzt hin?«
»Sie können hierbleiben, Sheriff. Ich gehe hinüber ins Hotel.«
»Hierbleiben? Sie haben Humor. Glauben Sie, Jeff Bitters würde schlafen, wenn Wyatt Earp kämpft? Nein, Marshal, ich habe jahrelang darauf gewartet, Ihnen einmal zu begegnen, und jetzt stehen Sie im Kampf gegen die Graugesichter. Glauben Sie etwa, daß ich die Gelegenheit, Ihnen beizustehen, vorüberlassen würde?«
Wyatt wußte nicht, wie er das ungute Gefühl in seiner Brust deuten sollte, als der kleine wackere Sheriff mit ihm hinaus auf die Straße ging.
Sie gingen auf das Hotel zu.
Es war ein ziemlich großer zweigeschossiger Holzbau mit einer pompösen, hellgestrichenen Fassade.
Wyatt öffnete die Tür zur Halle und trat an die Rezeption.
Der Sheriff deutete mit dem Kopf auf ihn und erklärte dem Mann hinter dem Pult: »Das ist Wyatt Earp. Ich weiß zwar nicht, was er hier will, aber tun Sie, was er sagt.«
Der Mann schluckte, schob sich seine dickglasige Brille zurecht, nickte und sah den Marshal fragend an.
»Kann ich das Gästebuch sehen?«
»Natürlich, Marshal.« Es zuckte in dem Gesicht des Mannes auf, als er mit dem rechten Arm unter den Rezeptionstisch griff.
Da schnellte die Linke des Marshals vor und umspannte seinen Unterarm. Er riß die Hand hoch – und Bitters, der die Szene verblüfft beobachtet hatte, sah, daß der Brillenmensch einen vierschüssigen Cloverleaf in der Rechten hielt.
»Synders!« kläffte Bitters, »sind Sie wahnsinnig geworden!«
Theodore Synders schien regelrecht in sich zusammengefallen zu sein. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Er ließ den Kopf hängen. Die Brille rutschte ihm aus dem Gesicht und zerschlug am Boden.
»Synders!« fauchte der Sheriff, rannte um das kleine Pult herum und packte ihn am rechten Arm. »Was soll das bedeuten? Ich verlange eine Erklärung!«
Synders antwortete nicht.
»Geben Sie sich keine Mühe mit ihm«, meinte der Marshal, »ich weiß schon Bescheid.«
Der Sheriff blickte den Missourier verständnislos an.
»Sie wissen Bescheid, aber ich nicht.«
»Vielleicht ist es auch nicht nötig. Tun Sie mir einen Gefallen und bringen Sie den Mann hinüber ins Jail.«
»Los, Synders, kommen Sie.«
Wyatt nahm das Gästebuch vom Bord, wo er es sofort entdeckt hatte – denn nur deshalb war ihm der Griff unter den Rezeptionstisch verdächtig vorgekommen – und schlug es auf.
Heute hatte sich kein neuer Gast eingetragen. Gestern zwei und vorgestern auch zwei Leute. Wyatt blickte die Namen durch.
Aber Namen sind Schall und Rauch. Er hatte auch gar nicht ernsthaft damit gerechnet, daß ihm das Gästebuch Aufschluß darüber geben könnte, ob hier vielleicht der Boß der Graugesichter abgestiegen war.
Kannte er den Mann doch gar nicht!
Wußte er doch immer noch nicht, wie er hieß, wie er aussah, wo er herkam!
Er preßte die Lippen aufeinander und ging mit weiten Schritten auf die Treppe zu, die ins Obergeschoß führte.
In diesem Augenblick fiel draußen auf der Straße ein Revolverschuß.
Wyatt wandte sich sofort um und tigerte auf den Eingang zu, stieß ihn auf und sah mitten auf der Straße einen Mann liegen. Ein zweiter flüchtete drüben auf eine Häuserlücke zu.
»Stehenbleiben!« brüllte der Marshal.
Aber der Mann hetzte weiter.
Da jagte ihm der Marshal eine Kugel nach.
Sie traf den Flüchtenden ins linke Bein und ließ ihn zusammenknicken.
Wyatt ging auf ihn zu und schleppte ihn zurück.
Der Mann, der auf der Straßenmitte lag, war der kleine Sheriff Jeff Bitters. Reglos lag er mit dem Gesicht im Staub der Mainstreet.
Und niedergeschossen hatte ihn anscheinend der zweiunddreißigjährige Hotelangestellte Theodore Synders.
Der Marshal hatte ihn entwaffnet und spannte seine Linke um das Gelenk des Outlaws.
Dann waren von der Gassenmündung her rasche Schritte zu hören.
Wyatt zog mit der Rechten den anderen Revolver aus dem Halfter, ließ die Waffe aber sofort wieder zurückgleiten. Denn der Mann, der da herankam, war Doc Holliday.
Er wechselte einen kurzen Blick mit dem Marshal, sah Synders an und ließ sich dann neben dem Sheriff nieder, wandte ihn auf den Rücken und horchte an seiner Brust.
Als er sich wieder aufrichtete, sagte er leise: »Er ist tot.«
Synders Kopf fiel auf die Brust herunter.
»Nein«, keuchte er, »das ist nicht meine Schuld! Lieber Gott, das nicht!« Der kräftige Mann war dem Weinen nahe.
Wyatt packte ihn und führte ihn zum Jail hinüber, stieß ihn in eine Zelle und warf die Gittertür zu.
»Du mußt dich eine Weile gedulden, bis der Doktor kommt und nach deinem Bein sieht, Bandit.«
Der Mann humpelte auf die Gitter zu, spannte beide Fäuste um die Stäbe und keuchte: »Mr. Earp, ich gehöre ja gar nicht dazu. Ich bin nur getrieben worden. Verstehen Sie mich doch, ich bin doch kein Mörder!«
Wyatt, der das Licht in der linken Hand hatte, blickte ihn eiskalt an.
»Du wirst hängen, Bandit. Du bist ein Sheriffsmörder!«
»Aber ich habe doch gar nicht… Ich war es gar nicht…« Wyatt kehrte ihm den Rücken zu und verließ das Office.
Als er auf die Straße hinaustrat, kam ihm Doc Holliday entgegen und hielt ihm einen Derringer hin.
»Ist das die Kanone, die Sie ihm abgenommen haben?«
»Drinnen habe ich ihm einen Cloverleaf weggenommen. Und dieses Eisen da verlor er jetzt auf der Flucht.«
»Soll er damit den Sheriff erschossen haben?«
»Ja, eine dritte Waffe hat er nicht.«
»Hier«, sagte Holliday.
Der Marshal hielt die Hand auf.
Holliday öffnete die Läufe der kleinen Waffe. Zwei Patronen fielen in die Hand des Marshals.
Wyatt Earp blickte verblüfft auf die Geschosse.
»Dann hat er gar nicht geschossen! Er ist doch nicht der Mörder!«
Holliday schüttelte den Kopf und blickte zur Front des Hotels hinauf. »Nein, er nicht.«
Drüben schleppten zwei Männer den leblosen Körper des tapferen kleinen Sheriffs fort.
Wyatt blickte ihnen nach. Hatte er sich auch in der Person des Mörders geirrt, insofern hatte seine Ahnung ihn also auch diesmal nicht getrogen: Da hatte der kleine Bitters seinen Mut mit dem Leben bezahlen müssen. Der erste Sheriff seit langer Zeit, der ihnen beigestanden hatte. Und wieder wehte den Missourier der Atem des Schicksals an. Der Vorfall hatte ihm gezeigt, wie nahe auch er selbst immer am Tod vorüberschritt.
»Ich habe das Gefühl, daß es hier eine ziemlich lebhafte Stadt ist«, meinte Doc Holliday und sah sich in der Straße um. Seine Augen suchten den Spielsaloon. »Schade, ich dachte, ich könnte da unten ein paar Stunden am grünen Tisch sitzen.«
Wyatt Earp ging auf das Hotel zu.
Auch der Georgier setzte sich in Bewegung; er ging nach altbewährter Manier um das Haus herum, um es durch seinen rückwärtigen Eingang zu betreten.
Wyatt traf in der Halle den Besitzer des Hauses und sprach mit ihm.
Der Mann war den ganzen Tag nicht im Haus gewesen, sondern hatte sich bei seiner Schwester aufgehalten, deren Mann Geburtstag gefeiert hatte.
»Ich kann Ihnen leider keine Auskunft geben, Mr. Earp. Ich weiß nicht, wer heute gekommen ist. Und was mit Synders los ist, begreife ich nicht.«
Wyatt suchte sämtliche Zimmer durch.
Ein Kaufmann aus Louisiana wohnte in Nummer drei: Ein etwa sechzigjähriger dickleibiger Mann, der kaum etwas mit der Bande zu tun haben konnte.
Schräg gegenüber in Zimmer vier wohnte eine Frau.
Daneben in sechs fand er einen Mann, der mit seinem siebenjährigen Sohn auf der Reise nach Flaggstaff war. Sie kamen aus Nogales.
In Zimmer fünf wohnte ein junger Mann, der gestern gekommen war und morgen weiter wollte. Er war vielleicht einssiebzig groß, trug einen gutgeschneiderten, karierten Anzug und hatte die Manieren eines Gentlemans. »Ich arbeite für eine Landmaschinenfabrik in Los Angeles«, erklärte er dem Marshal.
Nein, auch dieser Mann machte nicht den Eindruck, als ob er zu den Galgenmännern gehörte.
Und doch mußte der Mann hinterm Rezeptionstisch einen Grund gehabt haben, zur Waffe zu greifen!
Ted Synders selbst war doch absolut unverdächtig gewesen und hätte keinen Grund gehabt, den Marshal aufzuhalten, wenn er nicht irgend jemanden hätte schützen wollen. Einen Mann, vor dem er Angst hatte.
Wyatt verließ das Haus durch die Hoftür und sah sich Doc Holliday gegenüber.
»Nichts?« forschte der Spieler.
Wyatt schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Unwahrscheinlich«, meinte der Georgier.
Wyatt wandte sich dem Hotelbesitzer zu.
»Und über den Zimmern gibt es kein Geschoß mehr?«
»Nein, das Dach ist ganz flach. Sie können es gern besichtigen.«
»Und hinter der Fassade, kann man da hineinkommen?«
»Eigentlich nicht.«
Wer hatte den Sheriff niedergeschossen?
Wenn der Schuß nicht vom Hotel gekommen war, mußte er von dem Nachbarhaus aus abgegeben worden sein.
Und in diesem Haus wohnte der Mayor. Es war ein Mann von fünfzig Jahren, der einen ehrbaren Eindruck machte und zusammen mit seiner Frau und sieben Kindern von einem Drugstore lebte.
In dem anderen Haus, das das Hotel flankierte, lebte ein Ehepaar, das sich um seinen kranken Sohn sorgte, der seit Wochen am Gelben Fieber litt.
»Der Sheriff ist in den Rücken geschossen worden«, preßte der Marshal durch die Zähne. »Also muß der Sheriff von dieser Straßenseite aus gefallen sein.«
»Und Synders kann nicht eine dritte Waffe bei sich geführt haben?« forschte der Georgier.
»Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich habe ihm in der Hotelhalle den Cloverleaf weggenommen, und draußen verlor er den Derringer bei der Flucht.«
»Er könnte doch aber einen dritten Revolver bei sich gehabt und ihn dann weggeworfen haben.«
»Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube es nicht.«
Sie gingen langsam die Straße hinunter.
Plötzlich blieb der Marshal stehen und schlug sich gegen die Stirn. »Bin ich denn wahnsinnig!« Er wandte sich um und lief in weiten Sätzen zurück auf das Hotel zu, stieß die Tür auf, schob ein paar Leute, die ihm im Weg standen, zur Seite, hastete die Treppe hinauf, warf die Tür zu dem Zimmer des jungen Mannes auf, der angeblich im Auftrag einer Landmaschinenfabrik reiste.
Das Zimmer war leer.
Wyatt lief ans Fenster, stieß es auf – und sah, daß das Dach hier nur wenig zur Regenrinne abfiel, durch die man mit wenigen Schritten hinter die Fassade kommen konnte.
Er stieg hinaus und schob sich über das Dach vorwärts hinter die Fassade.
Wyatt sah ein künstlich eingelassenes Fenster, das zur Verzierung der Fassade gehörte. Es war glaslos. Und von hier aus hatte man einen guten Blick auf die Straße.
Hier konnte der Mordschütze gestanden haben.
Wyatt wandte sich um und ging zurück.
Zimmer für Zimmer suchte er ab.
Aber der junge Mann war verschwunden.
Zusammen mit Doc Holliday suchte er eine volle Stunde das Hotel und dessen Umgebung ab.
Vergeblich!
Wyatt blickte die Mainstreet hinunter.
»Sie haben recht, es ist wirklich eine sehr unterhaltsame Stadt.«
Sie schlenderten langsam über den Vorbau weiter. Als sie den großen Spielsaloon erreicht hatten, blieben sie stehen und lauschten dem Getöse des unablässig johlenden und stampfenden Musikkastens.
Die beiden blickten durch eines der Fenster in den vollbesetzten Schankraum.
Die Leute in dem Saloon schienen sich um die Vorgänge draußen auf der Straße nicht im geringsten zu kümmern.
Und doch war es sicher auch hier längst bekannt geworden, daß der Sheriff ermordet worden war.
Plötzlich legte der Marshal seine Linke auf den Jackenärmel des Georgiers.
»He, sehen Sie sich den Mann drüben an der Theke an.«
Doc Holliday, der die Gäste an den Spieltischen gemustert hatte, wandte den Kopf und stieß einen leisen Pfiff durch die Zähne.
»Zounds! Ist es möglich!«
Es war ein großer, schlanker Mann, breitschultrig, schmalhüftig. Er trug einen schwarzen Stetson, einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Samtschleife. Seine Weste schimmerte silbern und war mit schwarzen Stickereien besetzt. Um die Hüfte trug er einen breiten Waffengurt, der an beiden Seiten zwei schwere Revolver hielt. Der Mann hatte ein gutgeschnittenes, vielleicht ein zu glattes Gesicht, dunkle Augen und trug auf der Oberlippe einen scharfausrasierten schwarzen Schnurrbart.
Nur zu gut kannten die beiden Dodger diesen Menschen. Sie hätten ihn überall, nur nicht hier erwartet.
Der berüchtigte Tombstoner Gangster Kirk McLowery!
Die beiden Dodger blickten einander verblüfft an.
»Phi!« machte der Spieler. »Was sucht der denn hier?«
Die Gedanken im Hirn des Marshals schossen hin und her wie elektrische Funken.
Kirk McLowery in Red Rock!
Was hatte das zu bedeuten? Führte die Spur etwa wieder zu den Clantons zurück?
Vor einer Stunde war hier auf der Mainstreet ein Gesetzesmann erschossen worden! Noch kannte niemand den Mörder. Zwar war der Mexikaner flüchtig und auch der junge Mann aus dem Hotel – aber da an der Theke des Spielsaloons stand der gefährliche Tombstoner Desperado Kirk McLowery! Der Bruder jener beiden Männer, die vor zwei Jahren bei dem mörderischen Gefecht im Tombstoner O.K. Corral ihr Leben gelassen hatten. Und er war gefährlicher als seine Brüder! Klüger, verschlagener, gerissener und auch viel härter. Ein Mann, der durchaus die Ambitionen und Fähigkeiten zu einem großen Bandenführer besaß!
Er war es gewesen, der vor Wochen mehrmals den großen Ike Clanton aufgesucht hatte, um ihn zu bewegen, in die Stadt zu kommen.
Sollte er mit den Galgenmännern zu tun haben? So abwegig wäre dieser Gedanke nicht. Schon mehrmals hatte der Marshal ihn im Verdacht gehabt, ein führender Mann der Graugesichter zu sein. An jenem Morgen oben in Tucson war er schließlich auch in der Nähe gewesen, als der Steuereinnehmer aus seinem Haus entführt worden war.
Kirk McLowery! Welch eine Überraschung!
Gebannt standen die beiden Dodger vor dem bis zur unteren Hälfte mit Buntpapier beklebten Fenster und starrten auf den hochgewachsenen schwarzen Mann an der Theke.
In diesem Augenblick verließ einer der Gäste den Saloon und trat auf den Vorbau.
Wyatt griff ihn sofort am Arm.
Der Mann schrak sichtlich zusammen. Er war vielleicht sechzig Jahre alt und hatte einen starken Schnauzbart. Aus mißtrauischen Augen musterte er den hochgewachsenen Mann, der da vor ihm stand.
»Was wollen Sie von mir?«
»Ich habe nur eine Frage, Mister. Haben Sie gehört, daß der Sheriff erschossen worden ist?«
»Nein!« Der Alte zog die Brauen zusammen. »Der Sheriff? Das kann doch nicht wahr sein!«
»Doch, es ist wahr –. Sie können weitergehen, Mister.«
Kopfschüttelnd trottete der Mann davon und hielt auf das Sheriffs Office zu.
»Also wissen die da drinnen noch nichts«, meinte der Spieler. »Ein Wunder wäre es übrigens nicht bei dem Lärm, den diese alte Totenmühle da verursacht.«
Mit brennenden Augen starrte der Marshal auf den breiten Rücken Kirk McLowerys. Was suchte dieser Mann hier in der Stadt?
Ausgerechnet in jener Stadt, in der der Marshal den Boß der Galgenmänner vermutete.
Hier von diesem Red Rock aus wäre sowohl der Überfall in Casa Grande als auch der Coup in Marana gut zu dirigieren gewesen.
Die Lippen des Missouriers sprangen auseinander.
»Ich kann es nicht glauben«, preßte er durch die Zähne.
Holliday ließ seinen Blick durch den großen zweiteiligen Saloon schweifen. Aber er konnte keinen Mann mehr entdecken, der ihm bekannt war.
»Und doch ist er nicht allein hier«, sagte er leise vor sich hin.
»Nein, das nehme ich auch nicht an«, entgegnete der Marshal. »Trotzdem müssen wir hinein.«
Holliday nickte, schob seine beiden Revolver weiter nach vorn über die Oberschenkel und warf dem Gefährten noch einen kurzen Blick zu. Dann ging er an der Frontseite des Hauses entlang bis an die Ecke und war gleich darauf verschwunden.
Wyatt wußte, daß er sich auf den Freund verlassen konnte. Er würde in Kürze hinter der rückwärtigen Schankhaustür bereitstehen.
Wyatt wartete noch zwei Minuten, dann ging er auf die Tür zu, öffnete sie und trat ein.
Der Musikautomat hämmerte gerade den scheußlichen uralten »Song of the Prärie«. Die teilweise schon angetrunkenen Gäste sangen mehr oder weniger richtig und laut mit. Links auf einem Podest tanzten zwei grellgeschminkte Girls mit wenig anmutigen Bewegungen dazu.
Wyatt Earp blickte nur auf den schwarzgekleideten Mann an der Theke, auf Kirk McLowery.
Der starrte in den Spiegel. Er hatte den Marshal sofort gesehen. Aber kein Muskel an ihm zuckte.
Plötzlich flog seine linke Hand zum Revolver, riß die Waffe gedankenschnell hoch, stieß sie zur Seite, und der Schuß fauchte los.
Mitten in das Herz des Musikautomaten hinein.
Mit einem kläglichen Jaulen röhrte das Orchestrion sein Leben aus.
Auch Wyatt Earp hatte seinen Revolver in der Hand, den großen schweren 45er Buntline Special mit dem sechskantigen Lauf.
Er hatte im gleichen Augenblick wie Kirk McLowery gezogen. Als er jetzt sah, daß der Desperado seine Waffe mit einem Handsalto wieder zurück ins Halfter fliegen ließ, ließ auch der Missourier die Waffe zurück in den Lederschuh gleiten.
Der »Cowboy« aus dem San Pedro Valley starrte unverwandt in den Spiegel.
Es war plötzlich merkwürdig still in dem großen Spielsaloon geworden.
Die Männer blickten zur Tür und auf McLowery.
Der kahlköpfige Keeper ging in Deckung, und der Alte, der ihm geholfen hatte, Gläser zu spülen, wollte durch den Perlenvorhang verschwinden.
»Was ist los, Billy?« kam es da spöttisch über die Lippen des Outlaws. »Weshalb verkriechst du dich? Bleib ruhig hier, sonst verpaßt du noch etwas.«
Die Luft in der Schenke war zum Schneiden dick.
Unendlich langsam drehte der Desperado sich um, stützte sich mit den Unterarmen auf die metallbeschlagene Thekenkante und zog den rechten Fuß an, so daß sein Absatz hinter die Fußleiste hakte. Er blickte über die Köpfe der Männer und sah dann zum Eingang hin.
»Welche Überraschung! Der große Wyatt Earp! Männer vom Red Rock, verrenkt eure Hälse, es lohnt sich: Da in der Tür steht der berühmte Marshal Earp! Hoffentlich wißt ihr die Ehre zu schätzen.«
Wyatt kam langsam von der Tür an die Theke heran.
Die anderen Gäste, die sich da aufgehalten hatten, huschten nun davon. Die Girls hatten sich schon lange vorher kreischend davongemacht.
Kirk McLowery lehnte sich weiter nach links, so daß er sich nur noch mit den Ellbogen auf die Thekenkante stützte. Die ganze Länge des Schanktisches befand sich jetzt zwischen den beiden Männern.
Da griff Kirk in seiner ruckhaften Art blitzschnell nach zwei Gläsern, füllte sie zur Hälfte und schob das eine mit einer geschickten Rutschpartie über die ganze Länge der Theke dem Marshal zu.
Wyatt blickte dem Desperado in die Augen.
»Das ist in der Tat eine Überraschung, Kirk McLowery.«
»Freut mich, daß wir beide einmal der gleichen Ansicht sind. – Wie steht’s mit dem Drink?«
Der Marshal überhörte diese Frage. Er beobachtete die Männer, die sich von der Theke abgesetzt hatten. Aber keiner schien zu dem Desperado zu gehören. Er konnte nicht alle Gesichter der Leute an den Tischen sehen; das war schlecht, denn so konnte er auch nicht feststellen, ob irgendwo eine McLowery-Clique steckte.
Kirk nahm mit spitzen Fingern ein silbernes Zigarettenetui aus der Tasche und zog eine Zigarette hervor, die er sich in den Mundwinkel schob. Ohne den Blick von dem Missourier zu lassen, schnarrte er: »Gib mir Feuer, Ted.«
Von dem Tisch, der der Theke am nächsten stand, erhob sich ein Mann. Er war mittelgroß, hatte ein eingefallenes, unangenehmes Gesicht und trug einen dunklen Tuchanzug, der ihm absolut nicht stand.
Er kam rasch auf den Desperado zu, riß ein Zündholz an und hielt es ihm an die Zigarette.
Kirk sog die Flamme in den Tabak und zischte dann: »Verschwinde!«
Der Mann trottete zu seinem Tisch zurück.
Mit einem raschen Blick hatte der Marshal die Gesichter der drei anderen Männer, die da saßen, überflogen. Er kannte sie alle nicht.
Es waren stoppelbärtige, zerfurchte, kantige Gesichter. Das also waren Kirks Leute.
Der Bandit hatte den Mann bewußt zu sich bestellt, um dem Marshal gleich von vornherein klarzumachen, wie stark seine Position war. Damit jedoch konnte er einem Mann wie dem Missourier nicht imponieren.
Während er ein paar dicke weißblaue Rauchwolken vor sich hin paffte, näselte der San Pedro Valley Man: »Ich schätze, Sie sind nicht zufällig in der Stadt, Marshal.«
»Da täuschen Sie sich nicht, McLowery. Ich suche einen Mann.«
»Ja, das dachte ich mir. Wyatt Earp sucht immer einen Mann.« Plötzlich warf er den Kopf hoch und blickte über die Asche seiner Zigarette hinweg auf den Marshal.
»Haben Sie ihn gefunden?« fragte er rasch.
»Das wird sich gleich zeigen.«
Es schien dem Missourier, als ob ein Schatten über das Gesicht des Desperados flöge. McLowery nahm den linken Ellbogen von der Theke und griff mit der Hand nach seinem Glas, das er langsam anhob.
»Vergessen Sie nicht den Drink, Mr. Earp.«
Wyatt griff mit der Rechten nach dem Glas, ohne hinzusehen, hob es an und nahm einen Schluck davon. Als er es auf die Theke zurückstellte, stieß der Bandit eine blecherne Lache aus.
»Er ist ein argwöhnischer Mann, der Marshal Earp! – Ja, Boys, von ihm könnt ihr eine Menge lernen. Der schluckt doch längst nicht alles.«
Die Stille, die im Raum herrschte, war unheimlich.
Die zum äußersten angespannten Nerven der Männer schienen zerspringen zu wollen, als plötzlich das Orchestrion sein vorhin so gewaltsam unterbrochenes Stampfen jaulend wieder aufnahm.
Der Revolver flog in die Hand des Banditen.
Noch einmal brüllte die schwere Waffe auf. Dann verstummte das Orchestrion mit einem Wimmerlaut, der den Männern bis ins Mark drang.
Kirk hatte seinen Colt wieder ins Halfter fliegen lassen und wandte den Kopf zur Seite.
Der Tabaksqualm zog dabei dicht an seinen Augen vorbei.
»Ich darf doch nicht etwa annehmen, daß Sie mich gesucht haben, Marshal?« fragte er mit triefendem Hohn in der Stimme.
»Nein, Kirk McLowery, diesmal hatte ich Sie nicht gesucht – aber ich scheine Sie gefunden zu haben.«
Eine steile Falte grub sich zwischen die schwarzen Brauen des Outlaws.
»Ich höre heute etwas schlecht.« Mit einem Ruck flog sein Kopf herum und er blickte seine Leute an. »Oder habt ihr ihn verstanden?«
Sie schüttelten nur die Köpfe.
»Na also, da hören Sie es. Die Jungs beteuern Ihnen wortreich, daß auch sie Sie nicht verstanden haben.« Wieder wandte sich Kirk an seine Männer: »Ich habe das Gefühl, Boys, daß wir unserem alten Freund Wyatt Earp ein paar Drinks spendieren sollten. Was meint ihr dazu?«
Die Männer nickten nur. Keiner wagte es, etwas zu sagen.
Kirk lehnte wieder mit beiden Ellbogen auf der Theke. Jetzt hob er die linke Hand und schnipste zweimal damit.
Da standen die vier Männer am ersten Tisch auf und bauten sich in dem Gang zwischen dem Tisch und der Theke nebeneinander auf.
Kirk hob die Hand wieder, schnipste erneut, und zu Wyatts Verblüffung erhoben sich von dem nächsten Tisch noch drei Männer, die sich so aufbauten, daß sie in den Lücken hinter den ersten vier standen.
»Na, Marshal, wie gefällt Ihnen das?« erkundigte sich der Desperado hämisch.
»Ich habe nichts anderes erwartet, McLowery. Im Gegenteil, eigentlich wundere ich mich, daß Sie nur sieben Leute bei sich haben.«
Ein Funkeln stand in den Augen des San Pedro Valley Mans, und der Zorn trieb eine dunkle Glutwelle über sein Gesicht.
»Wollen Sie mich beleidigen, Wyatt?« stieß er plötzlich unbeherrscht hervor und erinnerte damit den Marshal an seinen älteren Bruder Frank, der auch in dieser ungezügelten, abrupten Art gesprochen hatte. »Falls Sie die Absicht haben, mich zu beleidigen, Earp, werde ich ungemütlich.«
Der Marshal stand hochaufgerichtet da. Er war sicher noch einen halben Kopf größer als der San Pedro Valley Cowboy.
»Die Galgenmänner sind in der Stadt.«
Die Männer im Saloon zuckten zusammen.
Und im schärferen Ton fuhr der Missourier fort: »Vor einer Stunde ist draußen auf der Mainstreet der Sheriff von Red Rock ermordet worden!«
Diese Nachricht schlug im Schankraum wie eine Granate ein.
Die Männer sprangen von den Tischen auf und wollten hinaus.
Da zeigte der Tombstoner Desperado seine gefährliche Sonderklasse. Er stieß sich von der Theke ab, verstellte den Männern den Weg und zog den Revolver.
Die drei Schüsse, die er abgab, rissen fingerlange Löcher in die Decke. Der Stuck bröckelte herunter auf die Hüte der Männer.
»Bleibt nur hier, Leute. Es besteht kein Grund dazu, unruhig zu werden. Von euch hat ja niemand den Sheriff erschossen.«
Mit diesem Bluff überragte Kirk seinen Bruder Frank noch bei weitem und reichte damit an den großen Ike Clanton heran. Der hatte wie kein zweiter in der Gegenwart des Marshals aufzutrumpfen und das Ruder an sich zu reißen versucht.
Aber der Marshal blieb völlig unbeeindruckt.
»Lassen Sie Ihre Revolver in den Halftern, McLowery. Niemand hier interessiert sich für Ihre Schießkünste.«
Der Desperado zog seine linke Augenbraue hoch in die Stirn, und um seine Mundwinkel zuckte ein spöttisches Lächeln.
»Nicht?« fragte er leise.
Und schon flog der rechte Revolver in seine Hand.
Zwei Schüsse brüllten auf. Der erste löschte einen Wandleuchter, und der zweite zersplitterte die große Lampe in der Mitte des Spielsaals.
Zum dritten Schuß kam der Bandit nicht mehr. Die Hintertür des Schankraumes hatte sich unmerklich geöffnet.
In einem nur etwa handbreiten Spalt erkannte der Marshal die Gestalt Doc Hollidays.
Als Kirk McLowery seinen Colt gezogen und auf die Lampe gerichtet hatte, zog auch der Spieler einen seiner Revolver.
Der Schuß stieß dem Desperado die Waffe aus der Hand.
Und wieder zeigte sich die Sonderklasse des Tombstoner Outlaws. Obgleich er tödlich erschrocken sein mußte, zuckte nicht ein Muskel in seinem Gesicht.
Er blickte auf seine leere Hand und wandte dann den Kopf nicht zurück, sondern dem Marshal zu.
»Doc Holliday, nicht wahr? Ich hätte es mir denken können. Man wird vergeßlich mit der Zeit.« Er wandte den Kopf und blickte jetzt zu der Tür, die etwa zehn oder elf Yards entfernt sein mochte.
»Hallo, Doc! Immer noch gut bei Schuß, muß ich zugeben. Ich habe schon immer gesagt, daß ich eines Tages mit Ihnen auf der Straße stehen werde. An dem Tag, an dem Sie meine Brüder Frank und Tom niederschossen, schwor ich es mir. Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben – ich hätte im Augenblick Zeit.«
Wyatt sah, daß einer der Leute McLowerys die Hand dem Revolverkolben an seiner rechten Hüfte näherte.
Aber auch Doc Holliday hatte es gesehen.
»Ihre Freunde scheinen an diesem Spaß nicht interessiert zu sein, Kirk«, meinte er mit unverhohlenem Spott. »Der kleine krummbeinige Bursche da drüben beispielsweise ist lebensmüde genug, schon jetzt die Hand zum Revolver zu schieben.«
Kirk blickte zur Seite. »Ed, nimm die Pfote von der Kanone! Bist du verrückt?«
Der krummbeinige Bursche trat zwei Schritte vor. Es war ein scheußlich anzusehender Mann mit pockennarbigem Gesicht, zerschlagener Nase und wildem Stoppelbart.
»Ich kann die Stimme nicht hören, Kirk. Sagen Sie ihm, daß er still sein soll, sonst lernt er mich kennen!«
Der kleine Bursche hatte sich gefährlich aufgeplustert.
Da brach die Lache des Georgiers klirrend an sein Ohr. Doc Holliday öffnete die Tür ganz und trat in den Schankraum.
»Was ist denn mit dieser Vogelscheuche?« fragte er.
Ed Bompee stieß den Unterkiefer vor und krächzte McLowery an: »Sagen Sie ein Wort, Kirk, und es gibt keinen Doc Holliday mehr.«
Aber dem Desperado imponierte der Mut seines Gefolgsmannes nicht.
»Geh auf deinen Platz zurück, du Idiot«, wies er Bompee zurecht. »Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast.«
»Ich mache ihn fertig!«
»Ich habe gesagt, du sollst dein Maul halten. Er ist Doc Holliday, verstanden! Ehe du eine Hand zum Revolver gebracht hast, schießt er dir ein Monogramm in den Bauch.«
Diese Worte des San Pedro Valley Cowboys waren weniger ein Beweis dafür, daß Kirk McLowery die wahre Gefährlichkeit des Schützen Holliday weit besser einzuschätzen wußte, als etwa der kleine giftige Bompee – sondern sie entsprangen mehr dem Ärger darüber, daß der kleine Mann sich in den Vordergrund spielen und den Mutigen markieren wollte.
Kirk nahm seine Zigarette aus dem Mundwinkel, ließ sie auf den Boden fallen und zertrat sie mit der Stiefelspitze.
Und was jetzt kam, war ganz typisch für ihn.
Wyatt Earp kannte keinen anderen Mann, der sich das in dieser Situation herausgenommen hätte:
Kirk wandte sich langsam um, stemmte beide Ellbogen auf die Theke und rief dem Keeper halblaut zu: »Einen Brandy für mich, aber ein bißchen schnell. Einen Brandy für den Marshal und einen für den Doc. Die drei aus der guten Flasche, klar? Und von dem Fusel da gießt du meinen Leuten einen Drink ein.«
Verblüfft blickte der Marshal auf den Desperado.
Mit ungeheurer Geschicklichkeit verstand es dieser flexible Mann immer wieder, sich aus brenzligen Situationen herauszuwinden.
Aber der Marshal war nicht gesonnen, sich bluffen zu lassen.
»Kirk McLowery!« rief er mit schneidender Stimme.
Der Bandit blickte nur in den Spiegel.
»Was gibt’s, Marshal?«
»Ich habe gesagt, daß die Galgenmänner in der Stadt sind. Und daß der Sheriff erschossen worden ist.«
»Na und?« Kirk zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen. »Was habe ich damit zu tun? Seien Sie doch nicht so ungemütlich. Überall, wo Sie auftauchen, verbreiten Sie Eiseskälte. Verdammt noch mal, es ist draußen gerade kalt genug! Verderben Sie mir nicht meinen Drink.«
Er hob das Glas und kippte es in die Kehle.
»McLowery!« rief der Marshal.
Da wirbelte der Bandit zur Seite – und hatte seinen zweiten Revolver in der Faust.
»Lassen Sie mich endlich zufrieden, Earp«, zischte er.
»Der Junge wird nervös«, kam es da von Hollidays Lippen.
Kirk warf den linken Arm zur Seite – und ein Schuß zerschmetterte den riesigen Thekenspiegel in tausend Scherben.
Der Bluff verfehlte seine Wirkung nicht.
Kirk schob den Colt ins Halfter zurück, gab Ted einen Wink, den anderen, den ihm der Spieler aus der Hand geschossen hatte, aufzuheben, schob auch diesen in den Lederhandschuh und lehnte sich wieder auf die Theke.
Da trat Wyatt an ihn heran.
»Sie waren in Tucson, als der Steuereinnehmer von den Galgenmännern entführt wurde, Kirk McLowery. Sie haben in Tombstone mit Galgenmännern zu tun gehabt, und auf Ihrer Ranch oben im San Pedro Valley habe ich auch Galgenmänner gefunden. Einer von ihnen hat mich aus der Fallgrube Ihres Großvaters herausgeholt.«
Da schlug der Desperado eine blecherne Lache an.
»Was wollen Sie eigentlich von mir, Earp?« Der Desperado hatte dabei mit einer theatralischen Geste seine Arme erhoben, wobei sein Jackett vorn weit auseinanderging. Da sah Wyatt links in seinem Hosengurt einen Revolver stecken, auf dessen schwarzem Schaft ein in Elfenbein eingelegtes Dreieck zu sehen war.
Das war genauso ein Revolver, wie ihn der Mann getragen hatte, der als erster der Graugesichter nach Marana gekommen war!
Wyatt trat auf Kirk zu und griff blitzschnell nach der Waffe.
Zu spät suchte der Desperado den Missourier davon abzuhalten.
Wyatt hielt die Waffe in der Hand und legte sie auf die Theke.
»Wem gehört dieses Schießeisen?«
Kirk McLowery machte keineswegs den Eindruck, als ob er sehr erschrocken wäre.
»Ich bin Ihnen keine Antwort auf diese Frage schuldig. Aber ich bin ein Gentleman und werde infolgedessen reden. Ich habe den Colt beim Poker gewonnen. Da, diese Schleiereule, die sich da hinter der Theke zu verkriechen sucht, ist sogar Zeuge. Stimmt’s?«
Der Wirt nickte. »Ja, Mr. Earp, das stimmt. Mr. McLowery hat den Colt vorgestern hier von einem Mann gewonnen.«
»Von welchem Mann?«
»Ich weiß nicht, wie er heißt.«
»Wie sah er aus?«
»Ich kann es nicht genau sagen. Er war nicht ganz so groß wie Mr. McLowery, und er hatte…«
»… zwei Ohren und zwei Augen, eine Nase und einen Mund«, höhnte der San Pedro Valley Man. »Mensch, halt den Marshal nicht mit diesen Phrasen auf. Er will wissen, wie der Mann aussah. Sag ihm, daß er einen zerzausten, zottigen Schnurrbart unter der Nase hängen hatte, daß er abgetragenes braunes Lederzeug und einen verbeulten Hut trug. Ich glaube, er hieß Jim oder Joe oder Jack. Ich weiß es nicht.«
Wyatt tauschte einen raschen Blick mit Doc Holliday.
Der verließ die Schenke unbemerkt durch die Tür, durch die er hereingekommen war.
»Sie halten sich also schon mehrere Tage in der Stadt auf?« forschte der Missourier.
Kirk zog die Schultern hoch. »Ja, weshalb nicht. Haben Sie etwas dagegen? Hören Sie, Earp, ich bin nicht Phin Clanton. Sie können mit mir nicht umgehen wie mit ihm.«
Der Marshal überging diese Anspielung.
»Der Bursche, dem dieser Revolver gehörte, ist ein Galgenmann. Ich habe ihn in Marana gesehen. Er muß zwei dieser Waffen besessen haben. Eine trug er noch im Halfter.«
»Na und?« Kirk McLowery zündete sich in Ruhe eine neue Zigarette an.
Da spannte der Marshal urplötzlich seine Linke um das Handgelenk des Desperados und riß den Arm nach vorn.
»Suchen Sie nicht, mir auszuweichen, Kirk! Sie wissen genau, was ich meine. Es kann eine ganze Reihe von diesen Revolvern geben. Sie können den Wirt zu seiner Aussage bestochen haben. Das Dreieck hier auf dem Revolverlauf ist das Zeichen der Graugesichter.«
In den Augen des Banditen blitzte es auf. War es Zorn – oder war es Schrecken?
Wyatt beschloß, noch einen Schritt weiterzugehen.
»Ich habe etwas gefunden, was Sie verloren haben, Kirk.«
»So –?«
Wyatt nahm den Ring aus der Tasche, den er dem toten Galgenmann in Marana von der Hand gestreift hatte.
Kirk blickte auf den Ring.
Wyatt starrte gespannt in das Gesicht des Desperados.
Aber entweder vermochte sich der Outlaw so meisterhaft wie ein Schauspieler zu beherrschen, oder der Ring sagte ihm wirklich nichts.
»Das soll ich verloren haben? Habe das Ding nie gesehen.«
Der Marshal hatte vorhin plötzlich ein sonderbares Gefühl in der Magengrube gehabt; deshalb hatte er dem Georgier zugeblinzelt, daß er wieder hinausgehen sollte.
Es war besser, wenn einer von ihnen das Haus von außen unter Kontrolle hielt. Schließlich waren sie ja allein hier in der Stadt. Der einzige Mann, der ihnen beigestanden hatte, lag jetzt aufgebahrt im Totenhaus.
Wyatt Earp wußte jetzt genau, daß der Georgier die Hintertür der Schenke zwar einen Spaltbreit offengelassen hatte, aber nicht mehr dahinter stand, sondern vorn auf dem Vorbau wachen würde. Es war klar, daß Kirk McLowery nicht so leicht zu überführen war.
Wenn der Mann mit den Graugesichtern zusammenhing, ja, einer ihrer Führer, wenn nicht gar der Boß war, dann durfte man ihn unter keinen Umständen weiter auf freiem Fuß lassen. Aber wie sollte man ihn mit den sieben Männern im Rücken überwältigen?
Dazu gab es nur einen Weg.
Wyatt nahm ein Geldstück aus der Tasche und warf es klimpernd auf das Thekenblech.
»Was soll das?« krächzte McLowery.
»Das ist für den Whisky, den ich getrunken habe.«
Dunkle Röte überzog das Gesicht des Outlaws.
»Wyatt Earp, ich habe Ihnen den Drink spendiert. Und nicht einmal den haben Sie ausgetrunken. Es gibt also nichts für Sie zu bezahlen.«
»Ich lasse mir von Ihnen keinen Drink spendieren, McLowery.«
Der Bandit stieß die Hand zum Revolver.
Aber zu spät.
In der linken Faust des Missouriers blinkte der Revolver.
»Hände hoch! Auch ihr anderen da!«
Wyatt nahm aus dem rechten Halfter auch den anderen Revolver.
Der kleine krummbeinige Mann hatte die Hände nur etwa in Brusthöhe genommen.
Da spannte der Marshal die Hähne. »Hände hoch!« donnerte er.
Die Banditen hatten die Hände jetzt alle in Schulterhöhe.
Ein böses Lächeln stahl sich um die Mundwinkel des Cowboys aus dem San Pedro Valley.
»Das schaffen Sie doch nie, Earp. Bilden Sie sich etwa ein, daß Sie uns festnehmen können?«
»Reden Sie nicht.«
Ohne sich umzudrehen, rief der Missourier: »Luke! Sind Sie mit Ihren Leuten draußen? Dann klopfen Sie gegen das Fenster.«
Vorne wurde mit einem Revolverlauf gegen eine der Scheiben geklopft.
Kirk McLowery warf den Kopf zur Seite.
»All right, das war nicht schlecht, Earp. Ich wußte wirklich nicht, daß das lange Ungeheuer auch hier in der Stadt ist.«
»Sie wissen noch so manches nicht.«
»Und was haben Sie jetzt mit uns vor?«
»Sie kommen ins Jail…«
Als der Georgier um das Haus herumgegangen war, sah er an der Ecke des Saloons einen Mann stehen. Einen Mann im karierten hellen Anzug.
Holliday, der nur noch etwa vier Schritt von ihm entfernt war, nahm seinen Revolver hoch und spannte klickend den Hahn.
»Ah, da ist ja der Landmaschinen-Boy! Das trifft sich gut, ich brauche gerade eine Schaufel.«
Der Bursche flog entgeistert herum.
»Laß die Hände oben, Junge«, mahnte ihn der Spieler.
»Wie steht’s mit einer Schaufel? Du kommst doch von der Farmergerätefabrik aus Los Angeles.«
Der Mann schnappte nach Atem. »Ich verstehe nicht…«
»Das ist doch leicht zu verstehen. Ich brauche eine Schaufel, um einen toten Galgenmann einzuscharren.«
»Einen… toten… Galgenmann?« stotterte der Bursche.
»Richtig.«
»Aber… ist er denn schon tot?«
Holliday lachte leise in sich hinein. »Nein, Boy, noch lebst du. Aber du wirst sterben, weil du ein Sheriffsmörder bist.«
»Ein Sheriffsmörder? Nein, ich habe ihn nicht ermordet.«
»Du nicht, wer denn?« Pfeilschnell schoß dem Burschen die Frage des Spielers entgegen.
»Es muß Gip Jallinco gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, aber…« Jäh brach er ab; aber er hatte zu spät seinen Fehler eingesehen.
Der Mexikaner heißt also Gip Jallinco, dachte Holliday und erinnerte sich, daß er diesen Namen schon einmal gehört hatte. Jallinco war vor ein paar Jahren ein berüchtigter Grenzräuber. Und dieser Verbrecher hatte sich jetzt eine führende Position bei den Galgenmännern erworben.
Er also hatte Sheriff Bitters erschossen!
»Nimm die Hände hoch, Junge!« Holliday kam näher und zog dem Landmaschinenboy einen Derringer aus der Tasche, tastete ihn nach weiteren Waffen ab und zwang ihn, auf den Vorbau zu gehen.
»So, Kleiner, hier bleibst du stehen. Die Hände kannst du runternehmen. Aber wehe, wenn du eine krumme Bewegung machst! Dann kommst du nicht mehr dazu, mir die Schaufel zu liefern.«
Kaum waren sie auf dem Vorbau, als der Spieler die laute Aufforderung des Marshals an den angeblich hier draußen stehenden Luke Short vernahm.
Holliday klopfte sofort mit dem Revolverlauf auf eine der Fensterscheiben.
Es dauerte nicht sehr lange, da wurde die Tür geöffnet, und Kirk McLowery trat heraus.
Er sah die beiden Männer im Dunkel neben der Tür stehen und ging weiter auf die Straße.
Seine sieben Genossen folgten ihm.
Als der Marshal in der Tür erschien, blickte er verblüfft auf den Burschen im graugewürfelten Anzug.
»Ach, der ist auch da! Nicht schlecht… Komm, Junge, schließ dich gleich an.«
Wenige Minuten später saßen neun Männer im Gefängnis von Red Rock.
Während der Landmaschinenboy mit hängendem Kopf auf einem Schemel hockte und McLowerys Männer betreten auf den Pritschen herumsaßen, stand der Bandit aus dem San Pedro Valley aufrecht in der Mitte seiner Zelle und hatte die Daumen hinter seinen jetzt leeren Waffengurt gehakt.
»Und was soll daraus werden, Earp?« preßte er heiser durch die Zähne.
»Das werden Sie schon erfahren, McLowery.«
»Wessen beschuldigen Sie mich?«
Ein feines Lächeln spielte um die Lippen des Missouriers. Der Mann aus dem San Pedro Valley war wirklich gerissen. Aber doch nicht gerissen genug, um den Missourier schlagen zu können.
»Sie sind festgenommen wegen öffentlicher Ruhestörung und Mißbrauch von Schußwaffen. Sie haben die Leute drüben in dem Saloon mit Ihrer verrückten Knallerei gefährdet und erschreckt.«
Verblüfft blickte der Desperado in die Augen des Marshals.
»Damned!« stieß er durch die zusammengepreßten Zähne. »Sie sind wirklich ein Wolf!«
*
Die beiden Dodger standen auf dem Vorbau des Jails und blickten die Straße hinunter.
»Gip Jallinco«, sagte der Marshal. »Gut, jetzt kennen wir wenigstens seinen Namen. Wir werden ihn finden.«
Der Georgier hatte sich eine seiner langen russischen Zigaretten angezündet. Als er das Zündholz auf die Straße schnipste, meinte er: »Jetzt wüßte ich noch gern, wie der Tote in Marana hieß.«
»Das haben wir gleich«, entgegnete der Marshal, ging ins Jail zurück und holte den Landmaschinenboy aus der Zelle. Er brachte ihn hinaus auf die Straße und schob ihn vor sich auf die Vorbaukante.
»Hör zu, Junge. Ich habe noch eine Frage an dich.«
»Ich habe Ihnen bereits zuviel gesagt«, krächzte der höchstens neunzehnjährige Junge.
»Nein, du hast mir noch nicht genug gesagt. Wie heißt der Boß?«
Der Bursche senkte den Kopf.
»Ich weiß es nicht.«
»Das ist schade. Und wie hieß der Mann, der den Coup in Marana geleitet hat?«
»Auch das weiß ich nicht.«
»War es der Boß?«
Der Bursche schüttelte den Kopf.
»Hör zu, Junge. Mir fehlen noch genau drei Namen: der des Chiefs, der des Mannes, der den Coup in Marana geleitet hat – und dein eigener Name.«
Da warf der Junge den Kopf hoch. »Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich bin nicht der Boß.«
»Nein, das habe ich auch nicht angenommen. Wie ist es nun mit den Namen?«
»Ich heiße Larkin, Theodore Larkin.«
»Das ist ja ein russischer Name.«
»Ja, meine Eltern waren Russen.«
»Seit wann bist du bei der Bande?«
»Seit einem Monat.«
»Seit einem Monat?« forschte der Marshal argwöhnisch.
»Ja.«
Da nahm Doc Holliday, der nicht für lange Verhandlungen war, sondern den kurzen Prozeß liebte, beide Revolver aus den Halftern und drückte ihre Läufe dem Burschen in den Rücken.
»Schade, Larkin, daß du jetzt sterben mußt, ohne mir die Schaufel geliefert zu haben.«
Der Bursche begann zu zittern. »Ich habe die Wahrheit gesagt! Ich bin erst seit einem Monat bei der Crew. Ich arbeite tatsächlich für eine Fabrik, die Ackergeräte bestellt. Vor etwas mehr als einem Monat hat mich einer der Galgenmänner in die Hand bekommen.«
»Wo war das?« forschte der Marshal.
»Oben in Flaggstaff.«
»In Flaggstaff?« Der Marshal vermochte seine Überraschung nicht zu verbergen. Sollte das Gebiet dieser Verbrecherbande sich tatsächlich so weit nach Norden erstrecken? Das wäre eine erschreckende Erkenntnis gewesen.
»Ja, es war oben in Flagstaff. Wir haben gepokert. Ich war leichtsinnig und verlor eine ganze Menge. Und weil ich nicht zahlen konnte…«
»Verstehe«, entgegnete der Marshal, »da haben sie dich erpreßt. Wer war es?«
»Das kann ich nicht sagen.«
Holliday spannte die Hähne der Revolver. »Rede, Junge.«
»Harvey Daniels.«
»Das ist der Mann, der in Marana den Coup leitete«, setzte der Marshal rasch hinzu. Es war ein Klopfen auf den Busch. Aber es hatte einen unerwarteten Erfolg.
Der Bursche warf den Kopf hoch. »Woher wissen Sie das?«
»Du hast es mir ja eben gesagt. Daniels ist also der Anführer?«
»Ja – er ist einer der Freunde des Boß’.«
»Wer ist der Boß?«
Der Bursche blickte dem Marshal in die Augen.
»Ich weiß es nicht. Ich kenne seinen Namen nicht.«
»Hast du ihn einmal gesehen?«
»Nein.«
»All right, wie du willst. Und seinen Namen kennst du auch nicht?«
»Nein.«
Wyatt hatte das Gefühl, daß Larkin log. Er führte ihn ins Jail zurück.
Kirk McLowery stand immer noch mitten in seiner Zelle.
»Sagen Sie, wollen Sie uns tatsächlich hier im Dunkeln hocken lassen, Earp?«
»Daran müßten Sie doch gewöhnt sein, Kirk«, entgegnete Wyatt, nahm die Lampe mit und verschloß die Bohlentür zum Office.
*
Sie waren nicht sehr viel weitergekommen.
Im Jail von Red Rock saß Kirk McLowery mit sieben Banditen aus der Tombstoner Gegend. Was er mit den Graugesichtern zu tun hatte, und ob er überhaupt etwas mit ihnen zu tun hatte, konnte im Augenblick nicht klargestellt werden.
Wyatt hatte ein ungutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Kirk McLowery war einer der gefährlichsten Banditen, denen er bisher im Westen begegnet war. Und seiner alten Taktik folgend, hatte Earp bis heute vermieden, Männer wie Ike Clanton und diesen Kirk McLowery einzusperren, ehe ihnen nicht eine bestimmte schwere Schuld nachgewiesen werden konnte.
Aber der Marshal mußte diesen Gip Jallinco finden. Und dabei konnte ihn Kirk McLowery nur stören.
So lange jedenfalls mußte er im Jail bleiben.
Der junge Larkin gehörte jedenfalls zu den Graugesichtern. Wenn auch nicht viel aus ihm herauszuholen gewesen war, so doch das: daß der Tote von Marana nicht der Chief der Galgenmänner war.
Und das war nicht bedeutungslos. Der Große Boß lebte also noch und war auf freiem Fuß. Immer noch mußte mit ihm gerechnet werden.
Die beiden Dodger hatten die Nacht im Hotel verbracht.
Als Doc Holliday erwachte, fielen die Strahlen der aufgehenden Sonne schon durch seine zugezogenen Fensterläden.
Der Georgier erhob sich, rasierte sich sorgfältig, wusch sich und zog sich an. Als er hinunter in die Hotelhalle kam, trat ihm der Marshal schon entgegen.
»Sie waren drüben?« fragte der Gambler den Gefährten.
»Ja, es ist noch alles in Ordnung. Nur der Bursche, der hier an der Rezeption stand, hockt in seiner Ecke und jammert.«
»Lassen Sie ihn jammern. Das gibt sich auch.«
Der Hotelinhaber trat auf sie zu und deutete auf einen sauber gedeckten Tisch am Fenster.
»Es steht alles bereit, Gentlemen.«
Die beiden hatten erst wenig von ihrem Frühstück verzehrt, als Doc Holliday, der von seinem Platz aus die Straße in südlicher Richtung überblicken konnte, plötzlich die Serviette hochnahm und seinen Mund abwischte, ehe er ausrief: »Entweder sehe ich jetzt Gespenster, oder da kommt tatsächlich ein alter Freund von Ihnen!«
Wyatt erhob sich und trat hinter den Spieler.
Durch die nicht ganz geschlossenen Gardinen sah er unten in der Mainstreet einen Reiter auf einem schwarz-weißen Pferd näherkommen.
Es war ein Indianer.
Er hatte blauschwarzes Haar, das von vielen feinen Silberfäden durchzogen war. Sein bronzebraunes Gesicht war markant geschnitten und wirkte edel. Nur wenige Merkmale der indianischen Rasse waren darin zu finden. Es schien das Gesicht eines Südländers zu sein.
Der Indianer trug helles Lederzeug, ausgefranste Leggins und hatte nur ein Gewehr im Scabbard und ein Messer im Gurt. Auf seiner roten Jaccarilladecke war ein großes schwarzes gelbgerändertes C eingestickt.
»Cochise!« entfuhr es dem Marshal.
Die beiden verließen das Hotel und traten auf die Straße.
Den Indianerhäuptling schien der Anblick Wyatt Earps nicht zu überraschen. Er hielt sein Pferd an, stieg ab und kam auf den Marshal zu.
Die beiden Männer blieben einen Augenblick stumm voreinander stehen. Dann streckte der Marshal dem Häuptling die Hand hin.
»Ich freue mich, den Sheriff Earp zu treffen.«
»Die Freude ist auf meiner Seite, Cochise. Aber ich sehe, daß Cochise nicht sehr überrascht ist.«
»Nein, ich bin nicht überrascht, denn ich wußte, daß Sie hier sind.«
»Sie kommen von Marana?« forschte der Marshal ahnungsvoll.
»Ja.«
»Und?«
»In der vergangenen Nacht ist das Bahndepot überfallen worden.«
Der Häuptling sagte es ruhig ohne Hast, ohne jedwede Erregung.
Verblüfft starrten die beiden Dodger ihn an.
»Das Depot ist überfallen worden?«
»Ja.«
»Von…«
»Ja, von den Männern mit den grauen Gesichtern.«
»Wie ist das möglich?« entfuhr es dem Marshal.
Holliday sagte sofort: »Dann war der Angriff Daniels nur eine Finte.«
»Genau«, entgegnete der Marshal. »Der graue Chief befürchtete also, daß wir in der Nähe waren, und hat uns getäuscht. Es ist ihm voll und ganz gelungen.«
»Ja, er hat mit ganz wenigen Leuten das Depot gesprengt und völlig ausgeräumt«, bestätigte der Indianer.
Hochaufgerichtet stand der Marshal von Dodge City vor dem Häuptling und blickte an ihm vorbei in die grellen Strahlenbündel der Morgensonne, die in die Mainstreet von Red Rock fielen.
»Dann hat er den größten Coup gelandet, den je ein Bandenführer im Westen gelandet hat…«
Cochise nickte.
»Ja, das ist anzunehmen. Ich habe noch in der Nacht von einem meiner Späher davon erfahren. Ich war unten bei Avaco, um einen sterbenden Freund zu besuchen.«
Wyatt blickte den Indianerhäuptling versonnen an.
»Weiß Cochise, wohin sich die Graugesichter gewandt haben?«
»Ja, sie sind nach Süden geritten.«
»Und ihre Zahl? Kennt er auch die?«
»Ja, es waren fünf Männer.«
»Jetzt wüßte ich noch gern, ob auch Jallinco bei ihnen war.«
Der Indianer sagte ohne jede Bewegung: »Wenn Wyatt Earp den Mexico Man meint, so kann ich ihm sagen, daß er nicht dabei war.«
Der Marshal war verblüfft über die Antwort des Indianers. Er hatte die Frage eigentlich gar nicht an ihn gerichtet, sondern mehr sich selbst gestellt.
»Cochise kennt den Mexikaner?«
»Ja, ich kenne Gipsy Jallinco. Er hat sich vor mehreren Wintern an der Grenze Mexikos herumgetrieben. Grenzgelder einkassiert und ganze Wagenzüge überfallen. Nein, er war nicht bei den fünf Männern.«
»Er ist gestern abend hier in Red Rock gewesen«, erklärte der Marshal.
»Dann habe ich ihn heute im Morgengrauen gesehen. Er ritt auf einem hellen Pferd und hielt scharf nach Süden zu.«
Die beiden Dodger waren wie elektrisiert.
»Kann sich Cochise daran erinnern, wie weit es von der Stadt entfernt war?«
»Ja, es war ungefähr die Strecke, die die weißen Männer achtzehn Meilen nennen.«
Cochise streckte dem Marshal die Hand zum Abschied entgegen.
»Mein kranker Bruder wartet auf mich. Als mir mein Späher sagte, daß der Sheriff Earp gestern in Marana gewesen sei, entschloß ich mich, in diese Stadt zu reiten, um ihm von dem Überfall in Marana zu berichten.«
»Ich danke dem großen Häuptling der Apachen und hoffe, daß auch ich ihm einmal einen Dienst erweisen kann.«
Ein feines Lächeln spielte in den Augenwinkeln des Indianerfürsten. »Wyatt Earp hat mir schon mehr als einen Gefallen erwiesen.«
Nach diesen Worten wandte er sich um, ging auf sein Pferd zu, stieg auf und ritt im gestreckten Galopp zurück.
Doc Holliday schüttelte den Kopf.
»Das ist der eigenartigste Mann, der mir je über den Weg gekommen ist.«
Der Missourier nickte.
»Ganz sicher ist er ein sonderbarer Mensch. Aber auch ein großer Mann, und ein guter Mann.«
»Da war doch einmal ein General«, fand der Georgier, »der behauptete, daß nur ein toter Indianer ein guter Indianer sei. Auf Cochise trifft diese Behauptung jedenfalls ganz und gar nicht zu…«
Eine Viertelstunde später stellte Wyatt Earp fest, daß Jallincos Pferd aus dem Stall des Sheriffs gestohlen worden war!
Sofort verließen die beiden Dodger Red Rock und ritten nach Süden. Die große Fahrtstraße hinunter nach Tucson hatten sie westlich liegen lassen und folgten jetzt einem schmalen Weg, der nur wenig benutzt wurde und daher vom Flugsand er Savanne fast völlig bedeckt war.
Nur eine einzige Spur erkannten sie. Es war die Fährte eines huflosen Pferdes. Der Marshal deutete auf die Spur und meinte: »Hier ist Cochise geritten.«
Und nach einer halben Stunde hielt er seinen Falbhengst an und blinzelte in die Ferne.
»Da drüben läuft eine Fährte, die auch noch nicht sehr alt ist. Warten Sie, ich werde sie mir ansehen.«
Während der Georgier langsam weiterritt, sprengte der Marshal in östlicher Richtung davon, bis er den schmalen dunklen Streifen im Sand erreicht hatte, der sich in südlicher Richtung durch die Prärie zog.
Es war die Fährte eines einzelnen Reiters.
Wyatt stieg ab und kniete an der Erde nieder. Aufmerksam beobachtete er die Hufspur.
Das Pferd hatte einen ungleichmäßigen Tritt.
Jallinco mußte es sich in Red Rock beschafft haben. Der linke Hinterhuf wurde nach außen gesetzt.
Ein verräterisches Zeichen!
Er winkte dem Georgier, und gemeinsam folgten sie der Spur.
Es war am späten Nachmittag, als die Fährte aus der Ebene eine Hügelkette hinanstieg.
Der Marshal hielt seinen Falben wieder an.
»Den Gefallen können wir ihm nicht tun.«
Der Georgier blinzelte zu dem Kamm der Hügel hinauf.
»Nein. Also? Sie rechts, und ich links?«
Der Missourier nickte.
Sie nahmen die Zügelleinen hoch und trennten sich.
Während der Marshal nach Osten ritt, sprengte der Georgier hinüber nach Westen, um nach einer Dreiviertelmeile einen Halbkreis nach Süden zu beschreiben.
Der Marshal hielt den Kurs nach Osten und wandte sich dann ebenfalls in südlicher Richtung.
Doc Holliday hatte die Fährte gefunden.
»Sie läuft da drüben durch die Kakteenfelder. Er hat sich keine Minute aufgehalten und schien es sogar sehr eilig gehabt zu haben, denn die Hufeindrücke sind hier nur halb und flüchtig.«
Da das Gelände jetzt unübersichtlich war, beschloß der Marshal, doch nicht direkt auf der Fährte zu reiten.
Sie hielten sich, der eine links, der andere rechts, vierzig, fünfzig Yard von der Spur entfernt und ritten weiter nach Süden.
Kurz vor sechs Uhr tauchten in der Ferne in einer Talmulde die Bauten einer großen Ranch auf. Die beiden Dodger hielten ihre Pferde an.
Der Georgier wandte den Kopf und blickte auf das kantige Profil des Marshals, das jetzt Unmut widerspiegelte.
»Glauben Sie, daß er da Quartier gemacht hat?« forschte der Gambler.
Wyatt nahm seine lederne Zigarrentasche hervor, die er noch vom Vater hatte, schob sich eine Zigarre zwischen die Zähne und zündete sie an.
»Die Geschichte gefällt mir nicht«, sagte er, während er die Ranch fixierte.
»Eben.« Doc Holliday stützte sich mit beiden Händen auf sein Sattelhorn und starrte ebenfalls auf die Ranch. »Was mir insbesondere nicht gefällt, ist die Tatsache, daß der Halunke genau auf die Ranch zugeritten ist. Er scheint sie also zu kennen. Vielleicht sind es Freunde von ihm, die da leben.«
»Leider ist das nicht ausgeschlossen.«
»Vielleicht wäre es am besten, ich ritte in einem Bogen um die Ranch herum, um festzustellen, ob er weitergeritten ist.«
»Ja, aber bis dahin ist es dunkel geworden.«
»Das wäre vielleicht nicht das schlechteste. Im hellen Tageslicht können wir sowieso nicht auf die Ranch reiten.«
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Nein, wir werden es uns einfacher machen. Wir warten, bis es dunkel geworden ist, und dann reitet einer von uns auf den Hof, während der andere ihn sichert.«
»Auch das ist ziemlich riskant.«
»Ja, riskant ist es auf jeden Fall, was wir auch unternehmen.«
»Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, bis morgen früh zu warten und dann um die Ranch herumzureiten. Finden wir seine Spur, dann wissen wir, daß er weitergeritten ist.«
»Ja, aber wenn dem so ist, dann hat er vierundzwanzig Stunden Vorsprung. Und das ist eine Menge.«
»Ja.«
Holliday deutete nach Westen hinüber. »Da führt der Fahrweg von der Ranch zur Overlandstreet hinüber. Er hat die Ranch ganz bestimmt gekannt, sonst wäre er über die Overlandstreet geritten.«
Es war immer noch nicht sicher, ob die Fährte überhaupt von dem Mexikaner verursacht worden war. Aber da Cochise ihn im Morgengrauen etwa achtzehn Meilen vor Red Rock von der schmalen Fahrstraße nach Süden aus gesehen hatte, war es sehr gut möglich, daß es Jallincos Fährte war.
»Wir warten, bis es dunkel geworden ist, dann statten wir der Ranch einen Besuch ab«, sagte der Marshal.
Es war unnötig, dem Georgier zu erklären, um welche Art von Besuch es sich handelte. Doc Holliday wußte Bescheid. Zu oft hatte er zusammen mit dem Marshal derartige »Besuche« unternommen. Sie hatten den Vorzug, daß sie keiner Einladung bedurften, und den Nachteil, daß sie gefährlich waren.
Sie ließen sich oben am Hügelkamm in einer Mulde nieder und warteten die Dunkelheit ab.
Als unten im Tal auf der Ranch die Lichter aufflammten, zogen sie sich in die Sättel und ritten langsam weiter.
Sie ließen die Pferde etwa hundertzwanzig Yard von den Bauten entfernt hinter einem Gebüsch stehen und gingen zu Fuß weiter.
So kurz nach Einbruch der Dunkelheit war die beste Zeit zu einem solchen Besuch, da dann auf einer Ranch fast immer noch gearbeitet wurde und nicht die Stille des Feierabends herrschte, in der Schritte allzu leicht auffallen konnten.
Als sie bis auf dreißig Yards an den großen Scheunenbau herangekommen waren, sahen sie, daß um das ganze Anwesen ein hoher Stacheldrahtzaun gezogen war, den man oben von den Hügeln aus nicht hatte sehen können.
Der Marshal wandte sich nach dem Georgier um und flüsterte:
»Das ist bestimmt kein angenehmer Mann, dem diese Ranch gehört.«
Der Spieler nickte nur.
Wyatt Earp hatte schon oft die Erfahrung gemacht, daß es nicht die besten Menschen waren, die hohe Stacheldrahtzäune um ihre Anwesen zogen. Wie ja überhaupt der rostige Stacheldraht, der sich in den Siebziger Jahren im Westen wie Unkraut verbreitete, nichts Gutes mit sich gebracht hatte.
Der Zaun war wenigstens vier Yards hoch und machte ein Hinüberkommen einfach unmöglich. Doc Holliday griff in die hintere Innentasche seines Jacketts und nahm eine kleine, scharfe, englische Zange daraus hervor.
Knips, knips, knips!
Die Geräusche wären kaum zu hören gewesen, wenn nicht das feine schwirrende Singen in den hartgespannten Draht gewesen wäre.
Plötzlich geschah das, was der Marshal befürchtet hatte. Hinten vom Hof her kam mit wildem kläffendem Gebrüll ein kalbsgroßer Hund herangeschossen.
Er blieb drinnen am Zaun vor den beiden Männern stehen und schrie sich die Kehle fast heiser, wollte sich überschlagen vor Wut. Und plötzlich entdeckte er die Lücke, die den Zaun schon zur Hälfte teilte. Er setzte aus dem Stand zum hohen Sprung an – und prallte mit dem Missourier zusammen.
Wyatt riß beide Arme hoch. Er hatte die Hände gefaltet und schlug sie dem Tier ins Gesicht.
Schwer betäubt fiel der Hund zurück.
Der Marshal packte das Tier und schleppte es ein Stück zur Seite.
Währenddessen hatte der Georgier weitere Drahtstränge durchgekniffen. Er war gerade damit beschäftigt, einen starken Mitteldraht zu bearbeiten, als der Marshal ihn anstieß.
»Los, wir müssen hinüber oder verschwinden.«
»Natürlich müssen wir hinüber«, entgegnete der Georgier völlig gelassen.
Wyatt nahm einen Anlauf und sprang.
Sirrr! Der Mann aus Georgia hatte den starken Mitteldraht zerschnitten. Ohne große Anstrengung stieg er über die jetzt nur noch kniehohen unteren Drähte in den Hof.
Sekunden später waren sie im Dunkel der Scheunenwand verschwunden.
Keinen Augenblick zu spät, denn vorn um die Scheunenecke bogen jetzt mehrere Männer.
»Barry!« brüllte einer von ihnen. »He, Barry, wo steckst du denn?«
»Erst kläfft das blödsinnige Vieh sich die Lunge aus dem Leib – und dann läßt es nichts mehr von sich hören. Ach was, wir schaffen den Wagen noch weg, laden die Strohballen rauf, und dann wird gegessen.«
Es war ein großer, herkulisch gebauter Mann, der so geantwortet hatte. Wyatt Earp konnte ihn von seinem Platz aus deutlich sehen.
Die Cowboys verschwanden wieder.
»Wie lange mag der Hund mit dem Knuff zu tun haben?« forschte der Georgier.
»Das ist schwer zu sagen.« Es widerstrebte dem Mann aus Missouri einfach, das große Tier zu töten.
Er schlich sich wieder zu der Einbruchstelle im Zaun zurück, stieg hinüber und fand den Hund noch betäubt am Boden liegen. Er nahm sein Halstuch ab und zog einen ledernen Riemen aus der Tasche, mit dem er ihm die Beine zusammenband.
Jetzt war der große Wolfshund unschädlich.
Der Marshal ging zur Scheune zurück und sah, daß Doc Holliday seinen Platz bereits verlassen hatte.
Unten am anderen Ende der Scheune konnte er seine geduckte Gestalt gegen den hellen Sand des Bodens schwach erkennen.
Geduckt kroch er vorwärts. Plötzlich erhielt er einen Schlag über den Kopf, der ihn vorwärtstaumeln und in die Knie knicken ließ.
Glücklicherweise hatte die starke Metallplatte, die im Hut des Marshals angebracht war, die Hauptkraft des Hiebes abgefangen und gebrochen.
Wyatt warf sich noch instinktiv zur Seite, und der schwere Körper des Mannes, der ihm nachgesprungen war, prallte neben ihn auf den Boden.
Der Marshal richtete sich auf. Er merkte, daß seine Glieder bleischwer waren.
Dennoch warf er sich auf den Gegner und stieß ihm das Gesicht in den Sand.
Der Mann wollte brüllen. Da aber hatte ihn der Faustschlag des Marshals an der Schläfe getroffen. Aus Leibeskräften hatte der Missourier zugeschlagen.
Noch schwer benommen kniete er neben dem Betäubten, rang nach Atem und sah sich um. Den Revolver hatte er jetzt in der linken Hand.
Wo war Doc Holliday?
Wie kam der Mann hierher?
Sie waren also überfallen worden.
Wyatt richtete sich auf und lief bis zu der Ecke.
Der Mann, der da gekniet hatte, war verschwunden. Also hatten sie Doc Holliday schon in ihrer Gewalt!
Wyatt lief weiter, kam um die Hausecke herum und prallte da mit einem Mann zusammen. Er torkelte einen Schritt zurück und riß einen furchtbaren Uppercut hoch, der den anstürmenden Mann genau unter der Kinnspitze traf und ihn wie einen Sandsack zu Boden fallen ließ.
Keuchend lehnte der Marshal an der Mauer und versuchte klar zu denken. Sein Schädel brummte noch fürchterlich von dem Hieb.
Wo war der Spieler?
Wyatt lief geduckt weiter an der Scheunenwand entlang auf die Hoffront zu.
Da sah er im allerletzten Augenblick die Schulter und den Arm eines Mannes, der da an der Ecke stand.
Der Marshal hatte keine Zeit zu verlieren. Er mußte einen Trick riskieren.
»Pssst!«
Der Mann zuckte zusammen, wandte sich um und kam näher.
»Komm her!« flüsterte Wyatt.
Der Mann kam auf Zehenspitzen näher.
Als er bis auf drei Yard herangekommen war, hechtete der Marshal ihm entgegen und wuchtete ihm einen Rechtshänder auf die Herzspitze, der ihn mit einem Röcheln zurücktaumeln und niedergehen ließ.
Wyatt sprang ihm sofort nach und preßte ihn an die Erde.
Aber das war unnötig. Der Mann war kampfunfähig und nicht mehr bei Besinnung.
Wyatt richtete sich an den Brettern der Scheune wieder auf und blickte auf den Hof.
Damned! Wenn nur das Hämmern im Schädel nicht gewesen wäre…
Da hörte er links neben sich von der Frontseite der Scheune ein knackendes Geräusch und dann einen schweren Fall.
Er duckte sich nieder und sah einen Mann auf die Erde zuschleichen.
Er stieß den Revolver vor – und sah die helle Hemdbrust des Mannes durch die Dunkelheit schimmern.
Doc Holliday!
Da war der Gambler heran. »Wyatt?« flüsterte er.
»Ja, ich bin’s.«
»Zounds! Ich konnte Sie nicht warnen. Die Burschen kamen blitzschnell zurück. Es waren die gleichen Kerle, die vorhin um die Ecke kamen. Sie müssen uns bemerkt haben. Es war nur ein Bluff, den der Vormann da losgelassen hatte. Sie waren plötzlich da.«
»Und – haben Sie sie nicht erwischt?«
»Nein, sonst wäre ich schwerlich hier. Über mir ragte ein Balkon vom Obergeschoß aus der hölzernen Holzwand. Wie ich ihn erreicht habe, weiß ich nicht. Jedenfalls hing ich plötzlich daran, machte einen Klimmzug und saß wie ein Affe oben drauf. Die Brüder liefen dann an der Wand entlang geduckt unter mir her. Dann kamen Sie! Ich sah, wie der Mann Ihnen nachsprang und richtete schon den Revolver auf ihn. Da hatten Sie ihn aber schon beim Wickel. Ich wartete, ob noch einer käme. Dann ließ ich mich herunter und lief auf diese Seite um das Haus herum.«
»Und Sie haben da einen erwischt.«
»Einen? Insgesamt drei. Ich glaube, ich habe mir eine Revolverschale zerschlagen.«
»Sechs Mann also«, meinte der Marshal. »Damned, das geht nicht gut. Wir müssen ihnen sofort die Schnäbel stopfen!«
Blitzschnell machten sie sich an die Arbeit.
Aber als sie den Mann erreichten, den der Marshal zuerst niedergeschlagen hatte, war der schon verschwunden.
Holliday entdeckte ihn plötzlich.
»Da, auf der Hofmitte! Er ist noch schwer benommen und torkelt auf das Ranchhaus zu!«
Der Marshal setzte sofort mit Riesensätzen hinter ihm her.
Der Cowboy mußte das Geräusch gehört haben, wandte sich um und stieß einen heiseren Schrei aus.
Da war Wyatt Earp schon bei ihm und riß ihn mit einer blitzschnellen Doublette wieder, packte ihn und zog ihn zurück zur Scheune.
Oben am Ranchhaus wurde jetzt die Tür aufgestoßen, und der Lichtschein zweier heller Kerosinlampen fiel über den Vorbau bis in den Hof.
»He, was ist denn da los? Jim, was war das? Barry? Wo ist der Hund?«
Die polternden Schritte des Mannes auf der Verandatreppe drangen über den ganzen Ranchhof.
»Barry! Jim! Hölle und Teufel, wo steckt ihr denn, ihr Halunken?«
Die beiden Dodger standen an der Scheunenecke und hatten ihre Revolver in den Fäusten.
»Wir dürfen ihn unmöglich näherkommen lassen«, zischelte der Gambler. »Die Brüder drüben hinter der Scheune bleiben nicht still. Die Knebel halten nur eine Weile vor.«
Der Mann vom Vorbau war jetzt bis auf dreißig Schritte an die Scheunenecke herangekommen.
Da verließ der Marshal seinen Platz und ging auf ihn zu.
»Weiß der Teufel, Boß, wo der Hund ist«, sagte er.
Das war ein gewaltiges Wagnis!
Holliday hielt den Atem an und hatte in jeder seiner vorgestreckten Fäuste einen seiner Revolver. Seine Augen flogen hin und her über den Hof.
Der hemdsärmelige Mann, auf den der Marshal zuging, war stehengeblieben.
»Ich weiß nicht, wo das Vieh steckt«, knurrte er.
Der Missourier war jetzt ganz dicht an den Rancher herangekommen.
Plötzlich preßte er ihm die linke Hand auf den Mund, drückte ihn an sich heran und stieß ihm den Revolver in den Rücken.
»Kein Wort, Mister!«
Der Rancher war zu Tode erschrocken.
»Es besteht noch kein Grund zur Beunruhigung«, flüsterte der Marshal weiter. »Mein Name ist Earp. Ich bin hier, weil ich einen Mann namens Jallinco suche, einen Mexikaner. Ich weiß, daß er auf die Ranch geritten ist. Ich weiß auch, daß er ein Galgenmann ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er mit Ihnen befreundet ist. Denn er hat die Ranch geradewegs angesteuert. Jallinco hat oben in Red Rock einen Sheriff erschossen. Er wird dafür hängen, und wenn ich ihm bis in die Wüste Estacado folgen müßte! Jetzt liegt es bei Ihnen, ob Sie mir helfen wollen oder nicht, Mister. Da drüben an der Scheune habe ich einige Ihrer Leute festgesetzt. Rechnen Sie also nicht darauf, daß die Ihnen helfen. Und den scharfen Hund habe ich auch auf Eis gelegt.«
Wie zu Stein erstarrt hing der Rancher zwischen den Armen des Marshals.
Wyatt führte ihn zur Scheune hinüber. Da sah der Farmer, daß der Marshal nicht allein war.
»Das hier ist Doc Holliday. Er wird jetzt eine Weile auf Sie aufpassen. Und wenn Sie klug sind, schweigen Sie. Ich werde Sie jetzt freigeben. Bei dem geringsten Laut, den Sie von sich geben, sind Sie ein toter Mann.«
Der Rancher war schweißnaß vor Schreck. Jetzt blickte er von einem zum anderen. »Ich möchte etwas sagen«, flüsterte er.
»Reden Sie leise«, mahnte ihn der Marshal.
»Sie haben gesagt, Sie suchen einen Mann namens Jallinco. Ich kenne keinen Mann, der so heißt.«
»Er ist ein Mexikaner. Ich weiß nicht, wie viele Namen er sonst noch führt«, entgegnete der Missourier. »Fest steht, daß er auf Ihre Ranch geritten ist.«
»Das muß ein Irrtum sein. Auf meiner Ranch war noch niemals ein Mexikaner.«
Doc Holliday schob dem Rancher einen seiner Revolver auf die Herzspitze.
»Daß Sie bei Ihrem Alter und im Angesicht des Todes noch lügen mögen, Mann!«
»Ich habe nicht gelogen.«
Wyatts Gesicht war jetzt dicht vor dem des Ranchers.
»Der Mexikaner ist auf diese Ranch geritten. Er ist heute angekommen.«
Im schwachen Sternenlicht konnte der Missourier das Gesicht des Ranchers nur undeutlich erkennen. Dennoch sah er jetzt eine Doppelfalte in seiner Stirn stehen.
»Heute? Das ist doch ganz ausgeschlossen. Heute ist nur ein einziger Mann auf die Ranch gekommen. Und das war Dave Cordoba.«
»Cordoba?« wiederholte der Marshal. »Well, ich sage ja, daß Jallinco sich eine Menge Namen zugelegt haben kann.«
Der Rancher schüttelte den Kopf und flüsterte:
»Nein, diesen Mann kenne ich seit fast sieben Jahren. Er hat drüben in Port Latur das Post Office und die größte Wells Fargo Station in der ganzen Umgebung.«
Die beiden Dodger wichen verblüfft einen Schritt zurück.
»Was sagen Sie da?« entfuhr es dem Marshal. »Die Wells Fargo Station und das Post Office von Port Latur? Es hat die modernsten Einrichtungen von ganz Arizona, ich habe davon gehört. Und dieser Mann, dem wir folgen, soll der Postmaster von Port Latur sein?«
»Ich kann Ihnen nichts anderes sagen«, entgegnete der Rancher. »Wenn Sie wirklich Wyatt Earp sind, dann müßten Sie wissen, daß ich die Wahrheit sage.«
»Well, Ihre Leute haben uns hier angegriffen. Einer von ihnen tat, als habe er uns nicht bemerkt, ging mit seinen Leuten zurück, und dann fielen sie über uns her.«
»Darüber können Sie sich nicht wundern. Höchstwahrscheinlich haben Sie irgendwo den Zaun zerschnitten, denn sonst könnten Sie unmöglich in den Ranchhof gekommen sein. Er ist von allen Seiten mit dem hohen Stacheldraht umgeben.«
»Wir haben etwas gegen Leute, die Stacheldraht lieben«, entgegnete der Marshal.
»Well, das kann schon sein. Ich mag die Leute auch nicht, die Stacheldraht um ihre Ranch ziehen. Aber bei mir war es notwendig. Zweimal haben mich die Indianer überfallen, und siebenmal ist die Ranch von weißen Banden gebrandschatzt worden. Und da Sie gerade von den Galgenmännern gesprochen haben: Ihretwegen habe ich den Zaun gezogen. Sie waren vor drei Monaten hier, hielten sich hier drei Tage auf, haben mir sieben Pferde gestohlen, meine ganzen Vorräte verbraucht und meine Leute verprügelt. Als sie endlich wieder abzogen, schwor ich mir, die Ranch mit einem gewaltigen Zaun zu umgeben. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie ihn durchschnitten haben.«
Holliday beschloß, es ein Rätsel für den Mann bleiben zu lassen.
Log der Rancher, oder sagte er die Wahrheit?
»Mein Name ist Anderson, John Anderson. Ich lebe hier mit meiner Frau, meiner Schwester und sieben Cowboys.«
»Nanu? Wir haben es hier nur mit sechs Leuten zu tun gehabt«, meinte der Marshal.
»Ja, das kann sein. Der andere ist ein alter Bursche. Wenn Feierabend ist, schläft er wie ein Murmeltier.«
Konnte Wyatt dem Mann vertrauen? Zu viel hatte er in der letzten Zeit mit den Galgenmännern erlebt. Er beschloß, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Aber die Erwähnung von Port Latur hatte ihn doch aufhorchen lassen. Sollte dieser einfache Viehzüchter sich eine solche Story aus den Fingern gesogen haben? Kaum anzunehmen.
»Und wenn Sie wirklich Wyatt Earp sind, dann kann ich Ihnen noch etwas sagen. Ich bin vor sieben Jahren in Santa Fé mit Ihrem Bruder Morgan zusammengetroffen. Er war damals Sheriff von Santa Fé. Es war kurz vor Weihnachten, da kamen die Cornwalls in die Stadt. Ich weiß nicht, ob Sie von der Geschichte gehört haben. Morg hatte eine fürchterliche Schießerei. Seine Leute waren unterwegs, und er stand ziemlich allein da.
Ich war mit dem Alten, der jetzt schnarcht, und einem der Männer, die Sie überwältigt haben, gerade auf der Straße, und wir konnten Ihrem Bruder auch beistehen.«
Wyatt erinnerte sich daran, daß Morgan ihm die Geschichte einmal erzählt hatte.
»Ja, ich habe davon gehört.«
Es war einen Augenblick still, dann sagte der Rancher: »Tut mir leid für Sie, daß Morgan nicht mehr lebt. Ich weiß, daß die Clantons ihn umgebracht haben…«
Die Erinnerung an den toten Bruder überwältigte den Missourier.
Düster sagte er: »Sie können Ihre Leute losbinden, Mr. Anderson. Es tut uns leid, daß wir hier so eindringen mußten.«
Der Rancher schüttelte den Kopf.
»Das macht nichts. Sie hatten ja Grund zum Argwohn. Schließlich konnten Sie nicht wissen, daß es kein Galgenmann war, dem Sie folgten, sondern Mr. Cordoba.«
»Ja, ja«, sagte der Marshal.
Der Rancher hob den Kopf und blickte ihn fragend an.
»Oder glauben Sie mir nicht?«
»Doch, Mr. Anderson, ich glaube Ihnen.«
Wenige Minuten später waren die Cowboys wieder auf den Beinen. Man ging zusammen zum Ranchhaus. Während zwei von den Leuten den Zaun wieder flickten, saßen Wyatt Earp, Doc Holliday und der Rancher mit den anderen Weidereitern in der Wohnstube um den großen Tisch.
Der Rancher hatte die beiden Dodger herzlich zum Abendbrot eingeladen.
Während des Essens fragte Anderson: »Wie kommen Sie darauf, daß der Mann, dem Sie folgen, hierhergeritten sein müßte?«
Wyatt legte den Löffel neben den Suppenteller zurück.
»Er ist hierhergeritten, Mr. Anderson.«
Die Männer hielten inne mit dem Essen und sahen den Missourier verblüfft an.
»Ich verstehe nicht…«, stotterte der Rancher.
»Würden Sie mir sagen, wie dieser Cordoba aussieht?« fragte der Marshal und heftete seinen Blick auf das Gesicht des Viehzüchters.
»Well, er ist ziemlich groß, hat ein dunkles Gesicht, dunkle Augen…«
»… trägt einen mexikanischen Sombrero«, unterbrach ihn der Marshal, »und reitet ein mexikanisch aufgeschirrtes Pferd.«
»Nein, absolut nicht. Cordoba trägt sich wie Sie. Er hat einen dunklen Stetson auf und trug einen schwarzen Anzug, als er heute hier war.«
»Wo kam er her?«
»Er kam aus Harricourt. Da ist er öfter. Er hat Verwandte da. Und außerdem gehört das kleine Postamt dort mit zu seinem Distrikt. Da ist eine Wells Fargo Station, die er mitzubetreuen hat. Vielleicht wissen Sie ja, daß in Port Latur das Headquarter der Wells Fargo Company ist.«
»Ja, das weiß ich.«
Die beiden Dodger wechselten einen Blick miteinander.
»Und Cordobas Pferd war nicht mexikanisch aufgeschirrt?« erkundigte sich der Marshal.
Der Rancher schüttelte den Kopf. »Nein, es war aufgeschirrt wie unsere Pferde, ohne jeden Putz.«
Sollten sie sich getäuscht haben? Sollte der Mann, dessen Pferd sie den ganzen Tag über gefolgt waren, etwa doch nicht Jallinco sein?
»Sie können sich darauf verlassen, Mr. Earp, daß ich Cordoba genau kenne. Wir haben öfter miteinander zu tun gehabt. Er ist ein prächtiger Bursche und freigiebig. Außerdem hat er überall Freunde hier in der Gegend. Ich sage das nur, damit Sie verstehen, weshalb er auch mich auf seinem Ritt aufgesucht hat. Er ist ein unterhaltsamer Bursche, der gern eine kleine Pause auf einer Ranch macht. Wir beide haben einen Whisky zusammen getrunken und eine Zigarette geraucht. Dann ist er weitergeritten.«
Wyatt Earp hatte lange überlegt, ob er Anderson und seinen Leuten erzählen sollte, was er in Marana und Red Rock erlebt hatte. Er kam nun zu der Ansicht, daß es besser sei, wenn die Bewohner der Umgebung Bescheid wußten. Als er seine Geschichte beendet hatte, blickten die Männer einander verblüfft an.
»Das ist ja eine höllische Story«, fand der Rancher. »Aber was Cordoba betrifft, da irren Sie sich bestimmt. Weiß der Teufel, wohin dieser Mexikaner geritten ist.«
Die Männer unterhielten sich noch bis in die Nacht hinein. Und dann nahmen die beide Dodger das freundliche Angebot des Ranchers an, bei ihm im Haus zu übernachten.
In der Morgenfrühe des darauffolgenden Tages verließen sie die Ranch.
»Vielleicht ist es Irrsinn, daß wir jetzt den weiten Weg hinüber nach Port Latur machen, aber wenn wir es nicht tun, dann haben wir die Fährte des Mexikaners auch verloren.«
Doc Holliday blickte gedankenversunken in die Savanne, die noch von dem Morgennebel eingehüllt war.
»Ich glaube nicht, daß der Rancher uns belogen hat.«
»Nein, belogen hat er uns ganz sicher nicht. Aber an der Geschichte gefällt mir irgend etwas nicht.«
»Ja«, entgegnete der Georgier, »mir auch nicht. Und zwar ist es die Tatsache, daß der Mann ausgerechnet die größte Telegraphen- und Transportstation der ganzen Umgebung unter sich hat.«
Wyatt lächelte. »Wir sind zwei mißtrauische Kerle, Doc. Aber da wir wieder einmal dasselbe denken, bleiben wir auch auf dem Trail. Wir werden uns dieses Port Latur und seinen Wells Fargo Boß einmal näher ansehen.«
Wieder waren sie gezwungen, den Kurs zu wechseln.
Port Latur lag im Südwesten. Und Tombstone, wo ihr Freund Luke Short auf sie wartete, im Südosten.
Port Latur war eine verhältnismäßig kleine Stadt, und ihre Bedeutung lag nur in ihrer Lage.
Schon sehr früh war die kleine Siedlung durch die Poststation bekannt geworden. Alle Overlandlinien, die von Norden, Süden, Westen und Osten kamen, schnitten die Paßstelle zwischen den Rovery Hills und dem Golden- Creek.
Sehr bald hatte sich neben vielen anderen Handelsfirmen auch Amerikas rührigste und größte Transportgesellschaft etabliert. Sie baute ein großes Lagerhaus und errichtete auch eine eigene Poststation, der gleich nach dem Kriege auch ein Telegraphennetz angeschlossen wurde.
Es war Abend, als die beiden Männer die Stadt am Fluß unter sich liegen sahen. Sie hielten an dem hier ziemlich steil abfallenden Hang der Rovery Hills und blickten auf die Häuser hinunter, die wie Spielzeuge zu ihren Füßen lagen.
»Wenn wir den Weg zu Mr. Cordoba vergeblich gemacht haben, dann hat Gipsy Jallinco einen Vorsprung von achtundvierzig Stunden«, preßte der Georgier heiser durch die Zähne.
Schweigend setzten sie ihren Ritt in die Stadt fort.
Es war kalt geworden. Die Sonne hatte sich am Tage nur kurze Zeit blicken lassen. Und die Nebelschwaden stiegen schon seit fünf Uhr wieder hoch. Hier unten am Fluß war es noch schlimmer. Die Lampen in der Mainstreet waren von weißen, wattigen Kränzen umgeben. Die Geräusche in der Straße hörten sich gedämpfter an als sonst.
Die beiden Reiter brachten ihre Pferde in einen Mietstall und schlenderten dann über die Straße auf das Sheriffs Office zu.
Es war ein kleiner, schmaler Bau, aus dessen Schornstein es heftig qualmte.
Als der Marshal nach kurzem Anklopfen die Tür geöffnet hatte, sah er nur das Hinterteil eines Mannes, der damit beschäftigt war, Papier in den Kanonenofen zu stopfen.
»Kann ich den Sheriff sprechen?« fragte der Marshal.
»Wenn es warm ist, hat der Sheriff Sprechstunde«, entgegnete der Mann und stopfte weiter Papier in den Ofen.
»Wie wär’s denn mal mit Holz?« meinte der Marshal.
»Holz? Ja, bringen Sie Ihren Kopf her, ich stecke ihn gleich rein. Hahaha!«
Der Mann richtete sich auf und blickte sich um. Sein rundliches rotwangiges Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Dann stieß er den dicken Zeigefinger nach vorn und meinte: »He, wenn Sie nicht Wyatt Earp sind, dann bin ich Abraham Lincoln.«
»Schade«, meinte der Marshal, »ich wäre Lincoln gern begegnet.«
Der wohlbeleibte Sheriff von Port Latur stampfte auf den Marshal zu und preßte seine Pranken um die Rechte des Missouriers.
»Das ist eine Überraschung, Wyatt Earp!«
Der Marshal dämpfte die Begeisterung des wohlbeleibten Gesetzesmannes und sagte ihm, weshalb er hierhergekommen war.
Der Dicke zog sein Gesicht auseinander und feixte wie ein Honigkuchenpferd.
»Cordoba?« Er deutete mit dem Daumen nach rechts. »He, das ist ein Witz. No, no, Marshal, den Weg haben Sie vergeblich gemacht. Cordoba ist in Ordnung. Er ist schon elf Jahre hier in der Stadt. Und nächstes Jahr wird er hier der Mayor sein. Nein, da sitzen Sie auf der falschen Fährte, Marshal. Dem guten Cordoba wird Port Latur eines Tages noch einmal ein Denkmal setzen. Er hat eine ganze Menge für die Stadt getan, mehr als jeder andere. Sollten mal sehen, wie sein Laden drüben läuft. Und was wäre die Poststation ohne ihn? Besuchen Sie ihn mal. Kommen Sie, ich werde gleich mit Ihnen gehen.«
»Nein«, wehrte der Marshal ab. »Es kann ja sein, daß Sie recht haben. Aber es kann auch sein, daß ich recht habe.«
Der Sheriff lachte. »Sie irren sich ganz bestimmt. Es ist schade, daß Sie den weiten Weg umsonst gemacht haben, aber andererseits ist es natürlich auch großartig. So komme ich doch wenigstens einmal dazu, den berühmten Wyatt Earp zu sehen.«
Der Sheriff nahm eine Kaffeekanne vom Ofen und schob einen sauberen Becher vor den Marshal hin.
»Sie trinken doch bestimmt einen Schluck?«
»Ja.«
Mitten im Einschenken hielt der Sheriff inne.
»Warten Sie mal, was haben Sie da eben gesagt? Er trägt den Revolver links und hat Sternradsporen? He, Cordoba trägt auch Sternradsporen und… und den Revolver über dem linken Oberschenkel. Aber, haha«, lachte er dann, »das ist bestimmt ein Zufall.«
»Wir werden sehen.«
»Wissen Sie was?« Der Sheriff setzte die Kanne auf den Ofen zurück. »Ich werde ihn einfach mal herholen. Ich bin gut mit ihm befreundet. Er kommt bestimmt.«
»Nein, ich gehe lieber zu ihm.«
»Dann komme ich mit.«
Sie gingen hinaus. Auf dem Vorbau blieb der Sheriff erschrocken stehen und blickte auf die hochgewachsene Gestalt des Mannes, die vorn an einen der Vorbaupfeiler lehnte und die Straße beobachtete.
»He, wer ist denn das?«
»Das ist… ein Begleiter von mir«, erklärte der Marshal, da er den Namen des Georgiers nicht laut auf dem Vorbau nennen wollte. Außerdem mußte er damit rechnen, daß der Sheriff ihn laut wiederholte.
»Ach so«, meinte der dicke Gesetzesmann. »Sie haben Ihre Geister wohl schon überall hier postiert?«
»So ungefähr.«
Die beiden gingen weiter. Stampfend marschierte der schwergewichtige Sheriff neben dem Marshal her. Sie verließen den Vorbau, überquerten die Mündung einer Gasse und betraten den Stepwalk vor den nächsten Häusern.
Schon von weitem konnte der Marshal das Gebäude der Wells Fargo sehen, und selbst wenn er es nicht gesehen hätte, würden ihm die vielen Wagen, die davorstanden, die Station verraten haben.
»Da ist es«, meinte der Sheriff.
Als sie vor dem Gebäude angekommen waren, sah der Marshal die großen Fenster, die ihre gelblichen Lichtrechtecke auf die Straße hinauswarfen.
»Warten Sie!« Er hielt den Sheriff am Jackenärmel fest. »Ich sehe, daß man von hier aus den ganzen Raum drinnen gut übersehen kann. Gehen Sie hinein und bleiben Sie in der Mitte des Raumes stehen, wo jetzt die Frau mit dem Korb steht. Und dann sagen Sie, daß Sie Cordoba sprechen wollen. Bleiben Sie unbedingt da stehen.«
»Wird gemacht.«
Der Sheriff stampfte davon, öffnete die Tür und trat ein. Wyatt konnte ihn von seinem Platz aus gut beobachten.
Es kam ein Mann in weißen Hemdsärmeln und mit einem grünen Marienglasschirm auf der Stirn und sprach mit ihm.
Das war niemals Jallinco!
War es Cordoba?
In diesem Augenblick krachte auf der Straße ein Schuß.
Die Kugel klatschte nur handbreit neben der Schulter des Marshals in das Holz der Wells Fargo Hauswand.
Der Marshal warf sich sofort nieder und robbte hinter einen Wagen, der dicht am Vorbau stand.
Da peitschte von links vom Vorbau her ein Schuß auf die Straße.
Es war einer der Revolver Hollidays. Wyatt Earp erkannte ihn sofort an seinem hellen Klang.
»Da stehst du schlecht, Jallinco«, fiel im nächsten Augenblick die klirrende Stimme des Spielers über die Straße. »Komm raus aus der Türnische, sonst schieße ich dir das Holz in Fetzen um die Ohren!«
Der Nebel auf der Straße war so dicht, daß Wyatt von seinem Platz aus nur wenig sehen konnte. Wie Gespensteraugen griffen die Lichter der Häuser durch die wattigen Schleier.
Aus der Tür der Wells Fargo Company stürmte der Sheriff.
»Marshal! Marshal, wo sind Sie? Marshal!«
»Hier bin ich«, rief ihm der Missourier leise zu.
»Ach da, warten Sie! Wer hat geschossen?« Stampfend kam der Sheriff näher. »Wo stecken Sie? Ach, hier sind Sie. Augenblick mal… Verdammt, jetzt kriege ich die Knarre nicht aus dem Halfter! Ach so, da ist sie.« Er nahm den Revolver hoch und ließ die Trommel laut rotieren.
»Pst!« mahnte ihn der Marshal.
Auf der Straße war es still geworden. Da schnitt Hollidays Stimme wieder in den Nebel hinein: »Komm raus, Jallinco! Du sitzt da fest.«
In diesem Augenblick brüllten von drüben drei, vier, fünf Revolverschüsse auf. Yardhoch zuckte die orangerote Mündungsflamme.
Wie eine Feder schnellte der Spieler vom Vorbau und stand auf der Straße. Mit gespreizten Beinen und vorgestreckten Armen sah Wyatt Earp ihn wie ein Schemen mitten in den Nebeldünen stehen. Die Revolver in seinen Händen spien. Das Stakkato der Schüsse brüllte über die Mainstreet von Port Latur.
Wyatt Earp hatte seinen Posten sofort verlassen, lief um den Wagen herum und rannte geduckt über die Straße.
Als er drüben den Vorbau erreicht hatte, sah er, wie sich ein schwarzer Schatten aus einer Türnische löste, einen Schritt nach vorn torkelte und dann schwer auf die Vorbaubohlen aufschlug.
Der Marshal hatte den Revolver noch in der Hand, als er auf den Mann zulief, ihn auf den Rücken wandte und in sein Gesicht blickte.
Es war Gipsy Jallinco, der Mexico Man.
Doc Holliday kam heran.
»Ich sah ihn zufällig. Der Bursche hat ein Talent dafür, alles von der anderen Straßenseite aus zu beobachten. Sein Pech, daß ich an der gleichen Krankheit leide.«
Keuchend stampfte der Sheriff heran und starrte auf den Mann am Boden. »Um Gottes willen, das ist ja Cordoba! Dave Cordoba!«
Der Marshal blickte nicht auf.
»Ja«, sagte er nur, »ich dachte es mir.«
*
Die Stadt Port Latur vermochte die Sensation nicht zu fassen. Der Wells Fargo Boß Dave Cordoba war der Verbrecher Gipsy Jallinco! Ein Führer der Galgenmänner!
Wyatt Earp und Doc Holliday hatten noch in der gleichen Stunde festgestellt, daß der Mann in Red Rock irgendwie an seinen Sattel gekommen sein mußte, in dessen Tasche alle Dinge waren, die er zu seiner Verkleidung benötigte. Dieser Mann hatte mit äußerstem Raffinement ein Doppelleben geführt, aufgrund dessen es ihm möglich gewesen war, den ehrbaren Schein zu wahren. Wahrscheinlich hatte er mit dem Gangsterleben erst wieder begonnen, als er auf die Galgenmänner gestoßen war, oder sie auf ihn.
Wieder war eines der gefährlichsten Graugesichter ausgelöscht. Und mit ihm war ein wichtiger Stützpunkt der Bande gefallen: die Telegraphenstation Port Latur!