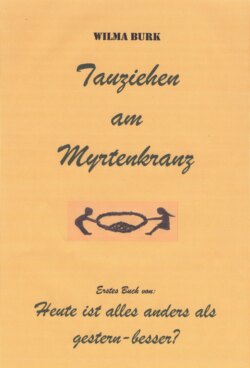Читать книгу Tauziehen am Myrtenkranz - Wilma Burk - Страница 4
2. Kapitel
ОглавлениеWenn ich jetzt morgens erwachte, galt mein erster Gedanke Konrad. Verträumt stand ich auf und stellte mich erst gedankenverloren an das Fenster meines Zimmers. Ich sah Menschen die Straße entlangeilen und sah sie doch nicht. Ich bemerkte auch nicht das aufbrechende Grün der Straßenbäume oder hörte das Lärmen der Spatzen. Nicht einmal das mächtige Dröhnen der Flugzeugmotoren vom nahe gelegenen Flugplatz Tempelhof konnte mich aus meinen Träumen reißen.
Meinem Bruder Bruno allerdings gelang es oft genug, mich früher aus dem Schlaf zu holen als nötig. Er verstand es, nebenan im Badezimmer wahre Arien zu gurgeln. Dazu überflutete er noch plätschernd den Boden und wenn das nicht reichte, klopfte er an die Wand. Er konnte es sich nicht versagen, mich morgens um sechs Uhr zu wecken, obgleich er wusste, ich brauchte erst eine Stunde später aufzustehen. Damit es ihm auch wirklich gelang, rief er noch durch die beiden Risse in der Wand zu meinem Zimmer, die bei einem Luftangriff auf die Stadt im Krieg entstanden waren: „Katrinchen, aufstehen!“
Wütend warf ich dann meine Pantoffeln gegen die Wand. Ich konnte es nicht ausstehen, Katrinchen gerufen zu werden. Er wusste es genau. Ich fand den Namen bäuerisch und völlig unpassend für mich. Ich war zierlich und nicht rund, hatte keinen Zopf oder Dutt, sondern schönes gewelltes blondes Haar.
Auch am Morgen jenes Tages, der entscheidend für mein ganzes Leben werden sollte, weckte mich Bruno auf seine Art. Polternd - wie üblich - verließ er das Bad. Er konnte es sich nicht versagen, noch vom Flur aus an meine Tür zu klopfen. Doch da stand Mama gleich in der Küchentür.
„Psst! Mach nicht solchen Lärm, Junge! Du weckst mir Traudel auf“, ermahnte sie ihn mit verhaltener Stimme.
Bruno brummte unwillig und schlurfte in die Küche. Ganz schön neidisch war er auf Traudel, unsere jüngere Schwester, die länger schlafen konnte.
Doch Traudel, das Küken, zwölf Jahre alt mit Stupsnase und roten dicken Zöpfen, konnte so leicht nichts wecken. Da hatte er bei mir mehr Erfolg. Das machte mich manchmal wütend. Doch konnte man diesem Schlaks von siebzehn Jahren mit dem dunkelblonden Wuschelkopf überhaupt böse sein?
Ich hörte Bruno in der Küche noch sagen: „So gut wie Traudel möchte ich es auch haben. Wie gut, wenn man zur Schule geht.“
Auch Bruno könnte noch zur Schule gehen. Papa hätte es gern gesehen, wenn er sein Abitur gemacht und dann studiert hätte. Er war doch der Sohn der Familie - und ein Sohn musste wenigstens einen gleichwertigen Beruf wie der Vater haben. Bei den Mädchen war das nicht so wichtig. „Die heiraten sowieso“, meinten Papa und Mama. Beide waren eben noch aus den alten Generationen.
Bruno jedoch dachte anders. „Nun gut, Papa, du hast studiert und bist Ingenieur“, lehnte er sich auf. „Muss ich deshalb mindestens ein Doktor werden? Ich sehe das nicht ein. Ich habe die Schule satt. Meinem Freund und mir bietet sich jetzt die Gelegenheit, eine Lehre zum Elektromonteur anzufangen. Da kann ich bereits Geld verdienen, wenn es auch wenig ist. Bald geht der Wiederaufbau der Stadt los. Dann ist dieser Beruf bestimmt gefragt.“
„Junge, überlege dir das gut! Was du jetzt versäumst, kannst du in deinem ganzen Leben nicht mehr nachholen.“ Eindringlich redete Papa auf ihn ein.
Bruno aber war nicht mehr umzustimmen. Bestärkt von seinem Freund, erzwang er sich das Einverständnis von Papa. Der bemühte sich danach, nicht zu zeigen, wie traurig er darüber war.
Doch Bruno strahlte vor Freude. „Schau, Papa, ist es nicht ein Glück, dass ich diese Lehrstelle bekommen habe, bei der Arbeitslosigkeit zu dieser Zeit?“, versuchte er ihn nachträglich zu überzeugen. „Wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Mir kann das dann egal sein. Ich habe dann meinen Beruf.“
So war der Tag gekommen, an dem Bruno mit einem lauten „Hurra!“ seine Schultasche in die Ecke warf. Mama hatte besorgt zu Papa gesehen. Auch ihr wäre es lieber gewesen, wenn Bruno sein Abitur gemacht hätte.
Wie jeden Morgen ließ er auch heute die Tür hinter sich geräuschvoll ins Schloss fallen, als er ging. Mama seufzte, dass sich der Junge wieder nicht hingesetzt und gefrühstückt hatte. Mit einer Scheibe Brot in der Hand war er eilig die Treppe hinuntergestürmt.
Anders dagegen war es bei Papa. Während Mama in der Küche am Tisch weiter das Frühstück für Traudel und mich zurechtmachte, saß er gemütlich daneben. Auf dem großen Kachelherd in der Ecke der Küche hatte Mama immer eine große tönerne Kanne Malzkaffee warm gestellt. Zum Frühstück gehörten für Papa eine Tasse davon, frisch gebrüht, und die Neuigkeit der Zeitung. Da sprach Mama ihn auch nicht an. Manchmal machte er sich empört Luft über das, was er las. Dann tat Mama erstaunt oder nickte verständnisvoll. Hatte er schließlich die Zeitung zusammengefaltet, so schlurfte er leise mit seinen Filzpantoffeln in den Flur, zog sich die Straßenschuhe an, gab Mama, die wartend an der Wohnungstür stand, einen liebevollen Kuss und ging pünktlich zehn Minuten vor sieben Uhr zur Arbeit.
Dann wurde es Zeit für mich. Als ich an diesem Morgen in die Küche kam, sah ich erfreut, Mama legte mir eine hauchdünne Scheibe Schinken auf mein Frühstücksbrot. Der Schinken war noch von meiner Hamsterfahrt zu Tante Luise her. Ich dachte daran, dass sie noch vor kurzer Zeit oft falsche Leberwurst darauf gestrichen hatte. Das war ein Gemisch aus Mehl, Zwiebeln und Majoran, was wir nicht sehr mochten. Doch sagten wir ihr das, dann konnte Mama traurig erwidern: „Ja meint ihr, ich gäbe euch nicht auch lieber etwas anderes mit?“
Einige Wochen war es bereits her, dass ich mit essbaren Schätzen von Tante Luise nach Hause gekommen war. Genauso lange kannte ich jetzt Konrad. Ich fieberte jeder Verabredung mit ihm entgegen. Ich schmiegte mich inzwischen an ihn, wenn er mich zärtlich in den Arm nahm und küsste. Eigentlich müsste ich jetzt Mama von ihm erzählen. Auch an diesem Morgen überlegte ich das. Doch ich schob es auf, bis zur Mittagszeit, bis ich von der Arbeit wieder nach Hause kam.
Obwohl sonnabends nur wenige Stunden gearbeitet wurde, verging mir die Zeit an diesem Tag viel zu langsam. Ungeduldig sah ich auf die Uhr.
„Na, du kannst es wohl nicht erwarten?“, neckte mich Brigitte und musterte mich neidisch, wie mir schien.
Ich lachte, packte mittags schnell meine Sachen zusammen und lief zur Tür.
„Da brauche ich dich wohl nicht zu fragen, ob du heute Zeit für mich hast?“, rief sie mir nach. „Oder habe ich vergessen, dass wir uns heute treffen?“
„Natürlich treffen wir uns wieder, wie immer in letzter Zeit. Das weißt du doch!“, antwortete ich vieldeutig.
„Ach, ja!“, antwortete sie. „Habe es schon verstanden.“ Sie wusste, dass sie meine Ausrede war, wenn ich mich mit Konrad traf.
Die Köpfe von Monika und Waltraud flogen herum. Sie spürten, da war etwas Geheimnisvolles. Fräulein Krause sah prüfend auf die Uhr, ob ich auch nicht eine Minute zu früh das Büro verließ. Ich atmete auf, sobald ich draußen war.
Als ich mich unserem Haus näherte, ging meine Schwester Traudel vor mir her. Ihre roten Zöpfe hingen ihr weit über die Schulter. Unter dem Arm trug sie ihren Schulranzen. Sie band ihn sich nie mehr auf den Rücken. „Das machen doch nur Babys“, konnte sie mit der Herablassung ihrer zwölf Jahre sagen. Sie bettelte seit Langem um eine richtige große Aktentasche. Doch Papa meinte, der Ranzen sei wenigstens aus Leder, dagegen sei eine Aktentasche, wie man sie heute kaufen könnte - wenn überhaupt - nur aus Ersatzmaterial. Das wäre viel zu teuer und würde der Behandlung durch Traudel sicher nicht lange standhalten. Traudel gab dann ihrem Ranzen heimlich einen herzhaften Fußtritt und murrte: „Ich pfeif was auf Leder!“ Aber der Ranzen aus Leder ging eben trotz der Fußtritte nicht entzwei.
Kurz vor der Haustür holte ich Traudel ein. Zu ihrem Missfallen hielt ich sie an ihren Zöpfen fest.
Unser Haus in dieser Straße sah aus wie alle anderen hier, die den Krieg überstanden hatten. Es war teilweise beschädigt und die Klingeln an der Haustür funktionierten nicht mehr. Es gehörte zu einer Siedlung, die man damals modern nannte, mit glattem Putz und vielen Balkons. Das waren keine Altberliner Häuser mit hohen Fenstern und Stuckaturen. Früher quollen hier die Balkonkästen über von Sommerblumen und machten neben den herrlichen Rotdornbäumen am Straßenrand die Gegend freundlich. Wenn sie blühten, hatte das sonntags viele Spaziergänger aus der Innenstadt angezogen.
Die Räume in diesen Häusern waren nicht so hoch wie in einem Altberliner Haus, die Wohnungen nicht so groß. Trotzdem hatte ich hier ein eigenes Zimmer. Es war klein. Gerade ein Schrank, ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl hatten Platz darin. Aber es war mein Reich. Als wir vor Beginn des Krieges hier einzogen, hatte Bruno gemault und gemeint, ihm, als einzigem Jungen, stünde das Zimmer zu. Doch Papa hatte mit einer Handbewegung seine Einwände beiseite geschoben, „Katrina ist die Älteste“, bestimmte er. So bekam Bruno sein Bett auf der Couch im Wohnzimmer jeden Abend zurechtgemacht und Traudel schlief auf einem Sofa bei den Eltern im Schlafzimmer.
Schon im Treppenhaus roch es nach gebratenen Zwiebeln. Wie jeden Sonnabend stand mittags dampfende Kartoffelsuppe auf unserem Tisch in der Küche, um den sich die Familie versammelte. Wie jeden Sonnabend warf Bruno flehentlich seinen Blick zur Decke und sagte: „Und jetzt ein paar Bockwürste dazu!“, ehe er nach seinem Löffel griff.
Anfangs hatten wir darüber gelacht, doch dann mahnte Papa: „Lass den Unsinn!“ Und schließlich achteten wir kaum noch darauf. Nur Traudel nahm ihren Löffel nie auf, ehe ihr vergötterter großer Bruder nicht seinen Spruch getan hatte.
Als sich Papa nach dem Essen zu einem Mittagsschlaf ins Schlafzimmer zurückzog, war eigentlich der Moment gekommen, Mama zu sagen, dass ich mich heute mit Konrad treffe. Doch ich konnte es nicht - noch nicht - später, nahm ich mir vor.
Nach dem Essen half ich Mama in der Küche das Geschirr abzuwaschen. Eifrig redete ich, um damit mein schlechtes Gewissen zu verbergen. Als wir fast fertig waren, sagte ich beiläufig: „Ich treffe mich gleich mit Brigitte. Wir wollen bei dem schönen Wetter ins Grüne, an die Havel fahren.“ War ich erleichtert, dass mir die Ausrede wieder leicht über die Lippen ging - nur putzte ich wohl den Teller, den ich in der Hand hielt, besonders lange trocken.
Mir entging nicht, wie Mama mich von der Seite her ansah. „Gut!“, sagte sie zustimmend. Doch nach einer Pause: „Ist der Teller nicht schon trocken genug?“ Und sie lächelte seltsam dabei, so dass ich vor Verlegenheit errötete und mich fast verraten hätte.
Ich stutzte. Ahnte Mama etwas? Unmöglich! Sicher lächelte sie, weil ich wieder gewartet hatte, bis Papa schlief, um ihr das zu sagen. Papa konnte so unbequeme Fragen stellen: Wohin? Mit wem? Wann zurück? - Ich war froh, dass sie es wieder war, die all seine Fragen beantworten musste. Und darin hatte sie im Laufe der Jahre viel Übung bekommen.
*
Es war ein schöner warmer Tag im Mai. Wer Zeit hatte und nicht damit beschäftigt war, das Notwendige fürs tägliche Leben zu beschaffen, der strebte hinaus in die Natur. Mein Weg zur S-Bahnstation war nicht weit. Zwischen all den Menschen dort, sah ich Konrad sofort. Mit seinem warmen Glanz in den Augen sah er mir entgegen. Längst näherte ich mich ihm nicht mehr zögernd, sondern lief die letzten Schritte und sprang ihm regelrecht in die Arme. Jede Geste, jeder Blick von mir musste ihm verraten, wie sehr ich ihn liebte. Die Zeit, da ich versuchte, dies zu verstecken, war längst vorbei. Eng umschlungen, miteinander vertraut, gingen wir auf den Bahnsteig und stiegen in den Zug. Dicht beieinander standen wir zwischen all den anderen Menschen im vollen S-Bahnabteil und fuhren hinaus nach Wannsee zur Havelchaussee.
Das Wasser der Havel dümpelte leise plätschernd an den Strand und strich immer wieder den feinen Sand, von vielen Füßen zertreten, glatt. Auch in meine Schuhe drang dieser Sand, so dass ich kaum noch laufen konnte.
„Komm!“, sagte Konrad. „Lass uns hinaufgehen in den Wald.“
Mir war es recht. Vom ersten Moment an, als wir uns begegneten, hatte ich nie den Wunsch verspürt, mich gegen seinen Willen aufzulehnen. Was Konrad tat war richtig, ich hatte Vertrauen. So verließen wir die vielen Menschen am Strand der Havel und stiegen hinauf in den schattigen Wald der Havelberge.
Es war schön, neben ihm zu gehen, sich an ihn zu lehnen. Ich war so jung und an ihm war nichts Jungenhaftes mehr. War er auch nur einige Jahre älter als ich, so machte es zwischen uns viel aus. Er ging so sicher und wusste, was er wollte.
Bald lenkte Konrad unsere Schritte vom Weg ab. Ein schmaler Pfad verlor sich im Wald. Kein Mensch war mehr um uns herum. Aufgeregt, beklommen und ängstlich schmiegte ich mich in seinen, mich fester umfassenden Arm. Vor uns öffnete sich der Wald und wir traten geblendet hinaus auf eine sonnenüberflutete Lichtung. Wir blickten hinunter auf die Straße und zu dem Strand am Ufer der Havel. Gedämpft klang das Stimmengewirr der Spaziergänger von dort unten zu uns hoch, auch das leise Plätschern der Wellen auf dem Fluss. Hier war ein warmer Platz, einsam, als wäre er für Verliebte geschaffen.
Konrad zog sich seinen Mantel aus, legte ihn auf das Gras mit den ersten grünen Halmen und setzte sich darauf. „Komm! Lass uns hier verweilen. Der Boden ist schon warm“, forderte er mich auf und zog mich zu sich hinunter.
Ehe ich mich versah, lag ich neben ihm auf seinem Mantel. Ein seltsames Gefühl der Unruhe befiel mich. Ich fühlte mich wie erstarrt, bereit zur Abwehr. Konrad drehte sich mir zu, blickte mich forschend an und grinste, als wüsste er, was in mir vorging. Sacht griff er nach meiner Hand zwischen uns und hielt sie fest. „Ich träume gerne so in den Himmel. Komm, lass uns das zusammen tun“, forderte er mich auf und sah zu den einzelnen Wolken hoch. Träumen, ja! Die Spannung in mir löste sich und ich konnte mich dem wundervollen Gefühl überlassen, hier neben ihm zu liegen.
Herrlich war dieser Tag, diese stille Stunde, diese junge Zeit der Liebe, die schöner war, als ich sie mir je erträumt hatte. Ich vertraute ihm. Er würde mich nicht überrumpeln, dessen war ich mir sicher. Und doch, wenn er sich zu mir drehte, mich zärtlich küsste und liebkoste, spürte ich sein Drängen. Das rief in mir eine seltsame Unruhe hervor. Verunsichert zog ich mich von ihm zurück.
Ich bemühte mich aber, ihn das nicht merkten zu lassen. So rupfte ich ihm neckend ein Gänseblümchen aus seinem Mund, das er spielend mit seinen Zähnen bewegt hatte.
„Na warte“, ging er scherzhaft darauf ein.
Ich wollte aufspringen und lachend davonlaufen, er aber ergriff mich und hielt mich fest. Verliebt miteinander balgend rollten wir auf den Boden zurück. Plötzlich spürte ich sein leidenschaftliches Begehren. Atemlos still, wie gelähmt lag ich da.
„Katrina, komm, lass uns zu meiner Laube fahren. Ich habe am Stadtrand einen kleinen Schrebergarten. Dort sind wir ungestört - nur wir zwei. Komm, bitte!“, flüsterte er dicht an meinem Ohr unter Küssen.
Verschreckt zog ich mich zurück, als ich den Sinn seiner Worte erfasste, seinen an mich gerichteten Wunsch. Kälte schien plötzlich vom Boden hochzukriechen.
„Was ist?“ Erstaunt ließ er mich los, als er meinen Widerstand spürte.
Ich errötete heftig, richtete mich auf und starrte angestrengt auf den Boden. „Ich dachte, du liebst mich“, stammelte ich.
„Weshalb zweifelst du daran?“, fragte er verwundert.
Vor Verlegenheit rupfte ich büschelweise das Gras um mich herum. Am liebsten hätte ich mich verkrochen. „Ja, weil ... weil das ... na, was du eben wolltest ... bittet man darum nicht nur leichtfertige Mädchen“, stammelte ich hilflos. Drängende Tränen würgten mich. Ich wusste nicht, wem sie galten, Konrads frechem Wunsch oder dem eigenen zurückgedrängten Verlangen.
Sprachlos blickte er mich für einen Moment an. Dann ließ er sich zurückfallen und lachte, lachte!
Ich fühlte mich verletzt und weinte.
Liebevoll, wie man ein Kind nimmt, zog er mich in seine Arme. „Katrina, wo lebst du?“
Ich schluckte und schwieg.
„Wolltest du eben sagen, dass du glaubst, dass Männer ... dass man Mädchen ... Herrgott! - Dass man eben erst heiratet?“, stotterte er.
Ich nickte stumm.
Leise, ganz leise lachte er noch einmal auf, zog mich fest an sich, wie etwas, dass man nie wieder loslassen möchte und sagte: „Da werden wir bald heiraten müssen, Kleines. Ich will nicht lange warten!“
Ich sah über seine Schulter hinweg und entdeckte eine kleine Maus. Sie war unter einem Busch aus ihrem Loch gekrochen und verschwand wieder eilig darin, als sie uns erblickte. Erst langsam wurde mir bewusst, dass ich eben einen Heiratsantrag bekommen hatte. Staunend erkannte ich, dass er nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Worten meines Traumhelden hatte. Ich fand ja nicht einmal Gelegenheit ein zurückhaltendes „Ja“ zu hauchen. Konrad fühlte sich meiner Antwort sicher, und ich war es zufrieden.