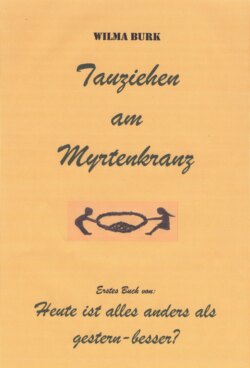Читать книгу Tauziehen am Myrtenkranz - Wilma Burk - Страница 8
6. Kapitel
ОглавлениеWas sind schon zwei Wochen Ferien? Viel zu schnell vergingen die sorglosen Tage. Der gemeinsame Alltag wartete auf uns. Wir ernteten vom Baum noch Äpfel, packten sie in die Taschen, stellten das zuletzt abgewaschene Geschirr in den kleinen Schrank, sahen nach, ob das Feuer im Herd wirklich ausgegangen war und machten uns auf den Weg. Wehmütig war mir zumute, als Konrad Laube und Gartentor abschloss. Ich fuhr ja nun nicht nach Hause zu Mama, in mein kleines Zimmer, konnte ihr nicht sprudelnd erzählen, was ich alles erlebt hatte. Nein, jetzt begann für mich ein neues Leben in Konrads „möblierter Bude“ bei der Witwe Willinger, einem mir völlig fremden Menschen. Mir war bang davor, obwohl ich mich bemühte, es zu unterdrücken.
Die Straßenbahn, die uns zurück in die Stadt brachte, war voller heimfahrender Menschen. Es war Sonntagabend. Hatten die Menschen bei diesem schönen Wetter zum Wochenende oder am Morgen aus der Stadt in die Umgebung hinausgedrängt, so strebten sie jetzt wieder in die Stadt zurück. Gemächlich ruckelte die Bahn von einer Haltestelle zur anderen durch die Straßen. Bald verschwanden Felder und Gärten aus unserem Blick.
Schon zeigten sich die ersten hohen Wohnhäuser, da stieg ein altes Ehepaar ein. Zuerst erklomm der Mann die hohen Stufen in die Bahn. Die Frau kam mühsam und schnaufend hinterher. Sie setzten sich auf die Bank uns gegenüber. Auf ihren Knien hielt jeder einen Korb voller rotbäckiger Äpfel. Ob sie auch einen Garten hatten? Von denen, die um uns standen oder saßen, warf so mancher einen begehrlichen Blick auf ihre Körbe - in dieser mageren Zeit! -. Aber die beiden Alten achteten nicht darauf. Es war, als klammerten sie ihre Umwelt aus ihrem Leben aus. Verstohlen musterte ich sie.
Sie trugen goldene Eheringe. Es war sicher, sie gehörten zusammen. Er hatte vom Schaffner auch zwei Fahrscheine verlangt. Doch wie sie dort nebeneinander saßen, konnte man glauben, sie seien sich fremd. Der eine sah nach links aus dem Fenster, der andere nach rechts. Nie trafen sich ihre Blicke. Kein Wort wechselten sie miteinander. Hatten sie sich gezankt oder hatten sie sich nichts mehr zu sagen? Nein, ihre Gesichter zeigten keine Verärgerung. Sie wirkten einfach nur gleichgültig und abgestumpft. Da bremste die Bahn kreischend mit einem Ruck. Die alte Frau verlor das Gleichgewicht. Sie rutschte nach vorn, ihr Korb stieß gegen Konrads Knie und ein paar Äpfel fielen heraus.
,,’tschuldigung", murmelte sie und bückte sich umständlich, um die Äpfel wieder einzusammeln. Konrad half ihr dabei.
Der alte Mann warf nur einen ärgerlichen Blick zur Seite. „Pass doch uff, Alte!“, grollte er.
Sie reagierte nicht darauf. War sie Vorwürfe von ihm gewöhnt? Hatten sie es verlernt, aufeinander zu achten? Hatte das ständige Beisammensein über viele Jahre sie gleichgültig gegeneinander werden lassen?
Mich fröstelte bei dem Gedanken, dass es so sein könnte. Scheu griff ich nach Konrads Hand. Fragend sah er mich an. Er folgte meinem Blick und lächelte verstehend, als wüsste er, was ich dachte. Nein, ich war mir sicher, zwischen uns würde es nie so sein wie bei diesen alten Leuten.
Die Sonne ging unter. Ihr flammendroter Schein traf nur noch die oberen Fenster der hohen Häuser und ließ sie grell aufleuchten. Unten in den Straßen wurde es dämmerig. Wie eingesperrt kam ich mir hier vor, kein weiter Himmel über Bäumen, in deren Blätter der Wind rauschte, nur Stein neben Stein, Häuser und Straßen. Wie gut, dass es gegenüber des Hauses, in dem jetzt mein Zuhause sein sollte, eine kleine Parkanlage gab.
Dann waren wir da. Die hohe Haustür quietschte wie immer. Konrad machte im Treppenhaus gleich das Licht an. Doch viel heller wurde es nicht. Die Fenster zum Hof wirkten bereits dunkel. An der Wohnungstür bemerkte ich den verschnörkelten alten Griff für die Klingel und darüber das Messingschild mit dem Namen: P. Willinger. Darunter war ein einfaches Pappschild mit Konrads Namen befestigt. Hier wohnten wir jetzt also.
Konrad hatte noch nicht den Schlüssel ins Schloss gesteckt, als die Tür von innen bereits geöffnet wurde. Die Witwe Willinger musste auf uns gewartet haben. Vielleicht hatte sie uns vorher vom Fenster aus kommen sehen. Sie hielt einen Teller in den Händen, auf den sie hübsch dekoriert einen Kanten Brot, Salz und ein paar Pfennige gelegt hatte. Wie klein und zierlich sie war. Schneeweißes Haar umrahmte ihr Gesicht, aus dem mich hinter Brillengläsern kleine graue Augen freundlich musterten. Sie wirkte verträumt, als lebte sie mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Würde ich mich an sie gewöhnen, Vertrauen zu ihr finden können?
„Glück und Segen mit ihrem Eintritt, mein liebes Kind“, begrüßte sie mich feierlich in meinem neuen Zuhause, dazu reichte sie mir den Teller mit den symbolischen Gaben.
Ich bedankte mich, spürte ihre zarten Finger lasch in meiner Hand liegen und sah doch befangen in die vom spärlichen Lampenlicht kaum erhellte Tiefe des Korridors. Wenn Konrads Mutter noch lebte, so hätte ich jetzt eine Schwiegermutter, ging mir durch den Sinn. Vielleicht wäre sie genauso wie die Witwe Willinger.
Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Dämmerlicht in dem Korridor. Konrad schloss die Wohnungstür hinter sich. Er wechselte noch ein paar höfliche Worte mit unserer Wirtin, ehe sie leise davonschlurfte und hinter einer der vielen Türen verschwand. Zielstrebig ging Konrad auf seine Zimmertür hinten bei den Portieren zu und stieß sie auf.
„Überraschung!“, rief er. „Sie haben unsere Hochzeitsgeschenke hergebracht. Schau nur, was da alles steht.“
Neugierig folgte ich ihm. Es war viel, was Mama und Bruno hergeschleppt und hübsch auf dem Tisch aufgebaut hatten. Ein bunter Blumenstrauß stand daneben und davor ein Schild, auf dem Traudel ungelenkig geschrieben hatte: Viel Glück!
Was war da nur alles. In der Aufregung des Hochzeitstages hatte ich vieles nicht wirklich wahrgenommen. Es gab Likörservice, Biergläser, Weingläser, Tortenplatten und Schüsseln mit passenden Tellern dazu. Wenn ich es richtig sah, so waren es in der Hauptsache Glaswaren, die man zu der Zeit eben am leichtesten erhalten konnte, besonders im Ostsektor der Stadt.
Konrad nahm dies und jenes in die Hand. „Ich glaube, Gläser haben wir für unser Leben genug. Allein drei Likörservice sind dabei.“
Ich sah aber auch an der Wand das Feldbett stehen mit meinen sauber bezogenen Betten darauf. Sie lagen nun nicht mehr auf meinem weißen Schleiflackbett in meinem kleinen Jungmädchenzimmer. „Für dich wird alles anders sein“, hatte Mama gesagt. Dies war der Anfang.
Konrad sah derweil die Glückwunschkarten durch.
„Suchst du etwas?“, fragte ich.
„Ja, einen Gruß von meiner Großmutter“, antwortete er nachdenklich.
Und dann hatte er die Glückwunschkarte gefunden. Sie war unpersönlich wie an einen Fremden geschrieben. Ich spürte, wie enttäuscht er war. Dabei hatte ich geglaubt, diese Großmutter in Bayern bedeute ihm nicht viel. Ob, auch wenn man zerstritten ist, ein familiäres Band dennoch bestehen bleiben kann?
Schließlich entdeckte ich einen bescheidenen Wäschestapel, hauptsächlich Handtücher. Eine bunte, gestickte Tischdecke fiel mir auf. Ich kannte sie. Hatte ich sie nicht bei Tante Emmy gesehen?
„Sieh mal, Konrad“, machte ich ihn darauf aufmerksam, „Tante Emmy hat uns eine Tischdecke geschenkt, die sie in ihrer Brautzeit für ihre eigene Aussteuer gestickt hat.“
Wie viele Hoffnungen mögen sie bei dieser Arbeit erfüllt haben? Und dann war ihre Ehe so schnell zerbrochen. Nur dunkel konnte ich mich an Onkel Emil erinnern, eigentlich lediglich an die Bonbons, die er für uns Kinder stets mitgebracht hatte. Mama sagte von ihm, er sei ein einfacher, aber liebenswerter Mensch gewesen. Doch Tante Emmy hatte sich nicht damit abfinden können, dass er nicht so klug und belesen war wie sie. Oft verwechselte er die Begriffe, dann verbesserte sie ihn sofort ungeduldig. Er aber lachte darüber, als ärgerte es ihn nicht. Oder wollte er sich damit nur über sie lustig machen? Einmal jedoch kam es anders. Als Tante Emmy ihn wieder vor der Gesellschaft zurechtwies, lachte er nicht. Nach einem tiefen Zug aus seiner Zigarre antwortete er: „Wie gut, dass es Dumme gibt, sonst könnten die Klugen mit ihrem Wissen nicht glänzen!“ Alle schwiegen betreten. Wenige Monate später erfuhren wir, dass Tante Emmy und Onkel Emil sich scheiden ließen.
Wir hatten noch nicht alle Glückwunschkarten durchgesehen, da ging das Licht aus, Stromsperre. Konrad zündete eine Petroleumlampe an, die bereit stand, und wir rückten dicht zusammen, um bei ihrem schwachen Schein alles zu Ende lesen zu können.
Darüber war es Nacht geworden. Die Petroleumlampe blakte. Wir waren müde. Dicht kuschelte ich mich zum Schlafen an Konrad auf der Couch. Mein Feldbett blieb in dieser Nacht unberührt. Ich spürte seine Wärme. Sein ruhiger Atem strich sanft über meine Haut. Ich war glücklich, ihm so nah zu sein.
Dabei fragte ich mich, wie es Tante Emmy ertragen konnte, so lange schon allein zu leben. Wie hielt sie es aus, in der einen Hälfte des alten Ehebettes zu schlafen, während die andere daneben leer war. Musste es sie nicht ständig an eine kurze, sicher auch glückliche, gemeinsame Zeit erinnern? Ich wusste, dass Onkel Emils Bett unter der Steppdecke immer frisch bezogen war, als könne er jeden Moment zurückkommen.
*
Am nächsten Morgen trennten sich zum ersten Mal unsere Wege. Jeder ging zu seiner Arbeitsstelle. Ich brannte darauf, meiner Freundin Brigitte von den ersten Tagen unserer Ehe zu erzählen. Doch als ich sie sah, wusste ich, dass ich dazu kaum Gelegenheit haben würde. Mit großen Augen, sichtlich aufgeregt, sah sie mir entgegen. Es musste sich etwas Wichtiges ereignet haben.
Kaum saß ich neben ihr, neigte sie sich mir zu und flüsterte: „Du errätst nicht, was passiert ist. Ich habe mich in einen Ami verliebt.“
„Nein! Wie bist du dazu gekommen? Das ist doch … das kann doch nicht …“, stotterte ich überrascht. „Etwa in einen Soldaten?“
„Jawohl, in einen Soldaten!“ Jetzt schaute sie mich doch ein wenig unsicher, zugleich aber trotzig an.
„Du weißt, wie man darüber denkt?“
„Na und?“
„Wir waren uns doch immer einig, wie verworfen das ist, was Monika und Waltraud tun.“
„So ist das bei mir nicht.“
„Wirklich nicht? Wo hast du ihn überhaupt kennengelernt?“
„Christa, meine Cousine, wollte unbedingt mal zum Columbiadamm am Flughafen Tempelhof …“
„Ihr seid doch nicht etwa auf der Flaniermeile gewesen, wo die Ami-Soldaten mit den bereitwilligen so genannten „deutschen Fräuleins“ anbandeln können?“
„Warum nicht? Man kann es sich doch mal ansehen.“
„Und dort hast du …?“
„Ja, dort! Ich war gestolpert, wäre hingefallen, wenn er mich nicht aufgefangen hätte. Der Blick dann aus seinen dunklen Augen, als ich aufsah … das war … ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie ließen mich nicht mehr los. War das bei dir und Konrad auch so?“
„Ich glaube, ja.“ Konnte ich mich daran noch erinnern? Ich fühlte mich wie eine alte Ehefrau.
Wie erfüllt sie von ihrer Verliebtheit war, sicher blind gegen jeden Einwand. Sie schwärmte davon, wie er gelacht hatte, mit seinem Akzent ‚Hoppla’ sagte und sie beinahe nicht mehr losließ. „Ich war wie gelähmt, wollte weg und zugleich bleiben. Dabei zog mich sein Blick immer wieder an.“
„Dann hat es dich wirklich erwischt“, stellte ich fest und kam mir dabei sehr erfahren vor.
Zusammen sind sie weitergegangen. Christa mit seinem Freund hinter ihnen. „Es war lustig, wie wir uns verständigten, mit Händen und Füßen“, erzählte sie. „Sie konnten nur ein paar Worte Deutsch und wir nur ein paar Worte Englisch. Nie hätte ich geglaubt, dass man sich trotzdem unterhalten kann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Danach haben wir uns fast jeden Tag getroffen. Unglaublich, was wir uns mit den wenigen Worten bereits erzählt haben. Ich glaube, wir verstehen uns auch ohne Worte. Jetzt will er sogar bald meine Eltern besuchen.“
„Geht das nicht ein bisschen schnell?“
Da lachte Brigitte. „Und wie war das bei Konrad und dir?“
Weiter kam sie nicht. „Was gibt’s?“, erklang die ungeduldige Stimme von Fräulein Krause, von einem missbilligenden Blick begleitet. Lange genug hatte sie uns tuscheln lassen. Monika und Waltraud hoben ihre Köpfe und sahen neugierig zu uns herüber.
Ehe wir uns der Arbeit zuwandten und in die Tasten der Schreibmaschine griffen, deutete Brigitte noch auf ihre Beine. Sie trug Nylonstrümpfe, die in diesen Tagen begehrten „Nylons“. Das war sicher ein Geschenk von Jonny.
Einen amerikanischen Freund zu haben, war in dieser Zeit etwas Besonderes – oder aber auch etwas Zweifelhaftes, wie wir das bei Monika und Waltraud beurteilten. Und Brigitte? Was wollte Jonny von ihr? Konnte er es überhaupt ehrlich meinen? Brigitte schien sich darum keine Sorgen zu machen.
Ich lernte Jonny bald selbst kennen. Er war ein lieber Kerl, der ständig Kaugummi kaute. Wie er Brigitte ansah! Es war nicht zu übersehen, wie verliebt er in sie war. Es amüsierte mich, wie sie sich verständigten, mal ein Wort in Englisch, dazu ein Wort in Deutsch und viel Zeichensprache. Damit schafften sie es tatsächlich.
Schon kurze Zeit später berichtete mir Brigitte aufgeregt: „Stell dir vor, der Vater von Jonny hat eine Lampenfabrik in Amerika.“
So, wie sie das sagte, erwartete sie Bewunderung von mir. Doch „Hoffentlich hast du ihn richtig verstanden“, sprach ich meine Zweifel aus.
„Na, hör mal!“, empörte sie sich. „Ich weiß genau, was Jonny sagen will. – Und weißt du was?“ Sie machte es spannend. „Seine Großeltern sind aus Deutschland. Darum soll er möglichst eine deutsche Frau mit nach Hause bringen.“ Bedeutungsvoll kicherte sie dabei. „Na, was sagst du?“
„Du denkst doch nicht, du könntest das sein?“
„Ja!“, frohlockte sie. „Noch hat er nur Andeutungen gemacht. Aber warum nicht?“
„Du müsstest nach Amerika gehen.“
„Wäre das so schlimm? Was ist Deutschland heute noch? Ein besiegtes Land in seinen Trümmern. Das dauert, bis das einmal beseitigt ist. Amerika, das ist Freiheit, Reichtum, und Lebensfreude.“
„Doch du wirst immer eine Deutsche bleiben.“
„Na und? Wie viele Amerikaner stammen aus Deutschland?“ Nein, Brigitte wollte in ihren rosaroten Träumen kein Gegenargument gelten lassen.
*
Es tat gut, abends zu Konrad nach Hause zu kommen. Atemlos lief ich die Treppe hoch. Meistens war er bereits zu Hause und ich fiel ihm in die Arme, als hätten wir uns ewig nicht gesehen. Mit jedem Tag aber lernte ich auch mehr und mehr seine Eigenarten kennen.
Zuerst bin ich oft über seine Schuhe neben der Zimmertür gestolpert. Irgendwann bemerkte ich, dass er die Augenbrauen missfällig hochzog, wenn er sie sich danach zusammensuchen musste, um sie wieder exakt ausgerichtet neben die Tür zu stellen. Von da an holte ich sie lieber selbst zurück und bemühte mich, sie genauso ordentlich neben die Tür zu stellen. Albern fand ich das zwar, aber was tut man nicht aus Liebe. Als Konrad bemerkte, wie ich mich seiner Gewohnheit anpasste, sagte er nichts, doch er nahm mich so liebevoll in den Arm, als wäre das ein Dankeschön.
Dabei blieb uns nicht viel Zeit zum Schmusen nach Feierabend. Auch die Arbeit in unserem kleinen Haushalt wollte gemacht sein – und natürlich von mir. Ich tat mich schwer damit. Wie schafft man das, eben war man noch ein umsorgtes Kind im Elternhaus und nun sollte man eine selbstständige, möglichst perfekte Hausfrau sein?
Die Blockade dauerte an. Weiterhin donnerten die Flugzeuge ohne Unterbrechung über die Stadt und brachten alles, was die Menschen zum Leben brauchten heran. Jetzt gab es Kartoffeln in Dosen, oder Trockenkartoffeln, Milchpulver, Eipulver. Wie sollte ich damit umgehen? So stand ich also in der Küche der Witwe Willinger - in einer mir fremden Küche - und versuchte, damit fertig zu werden. Oh, wie ich es hasste, wenn sie hereinkam und mir verstohlen zusah! – Doch bald änderte sich das. Sie hatte eine freundliche leise Art. Ohne dass ich es richtig merkte, begann sie mir zu helfen.
„Sie sind wirklich sehr geschickt“, lobte sie mich.
Ich wurde rot, weil das nicht stimmen konnte.
„Doch, doch, Kindchen“, beteuerte sie, ,,Ihnen fehlt nur etwas Routine. Und Sie haben einen genauso geduldigen Mann, wie es mein Paul am Anfang unserer Ehe gewesen war.“
Von diesem Paul sollte ich in der nächsten Zeit viel hören. Er musste ein Engel gewesen sein. Oder verklärte die Witwe Willinger ihn nur in ihrer unermüdlichen Erinnerung dazu?
Dass Konrad kein Engel war, sondern ein lebendiger Mensch, wurde mir mit jedem Tag mehr bewusst. Wenn er abends nach Hause kam, stellte er nicht nur seine Schuhe genau ausgerichtet neben die Tür an den Platz, wo bis dahin die Hausschuhe gestanden hatten, sondern auch seine Aktentasche wurde von ihm ordentlich auf das Regal abgelegt - dort hatte auch nichts anderes zu suchen. Und danach machte er es sich auf der Couch bequem, nahm die Zeitung und vertiefte sich in die Neuigkeiten des Tages. Hier saß er und wartete darauf, dass ich das Abendessen auftrug. Er tat eben nur alles das, was Männer seit Ewigkeiten tun. Ich kannte es ja von zu Hause auch nicht anders.
Manchmal jedoch wurmte es mich, wenn ich am Abend nicht wusste, was ich zuerst machen sollte und Konrad Zeit für Müßiggang fand. Waren wir nicht eine andere Generation als Mama und Papa? Früher waren die Frauen in der Regel am Herd und bei den Kindern, wie man sagte, und selten berufstätig in der Ehe. Doch Konrad kam sich schon ungeheuer hilfsbereit vor, wenn er mir nach dem Essen half, das Geschirr in die Küche zu tragen.
„Ist das eigentlich alles, was du bereit bist, zu tun?“, fragte ich halb scherzhaft.
Er lachte wieder sein sorgloses Lachen. „Reicht dir das nicht? Du bist die Frau im Haus.“
Ich knurrte leise.
Da packte er mich und sagte halb im Ernst: „Komm, das bisschen Arbeit ist doch nicht so schlimm.“
Was erwartete ich. Mir lag ja selbst daran, ihm alles recht zu machen, um geliebt zu werden. Und schließlich tat er das, was er Männerarbeit nannte, wenn es auch wenig war.
*
Eines Abends überraschte Konrad mich damit, dass er sich hinsetzte und unser gemeinsames Einkommen zusammenrechnete.
„Es wird Zeit, einen Kostenplan für uns aufzustellen“, erklärte er mir.
Ich guckte dumm! Dass über mein Geld ein anderer als ich verfügen könnte, darüber hatte ich nie nachgedacht. Aber recht hatte er, ich bemerkte selbst, wie schnell sich mein Geld ausgab bei all den Einkäufen, die ich machen musste. Also setzte ich mich dazu, bereit, mit ihm über die Einteilung des Geldes zu beraten.
Doch ich kam kaum dazu. Konrad stellte den Plan auf und er bestimmte, wie viel Wirtschaftsgeld mir monatlich zur Verfügung stehen sollte. Zuletzt lächelte er gönnerhaft: „Und an dich wollen wir auch denken, eine kleine Summe Taschengeld sollten dir reichen.“
Mir wurde schnell bewusst, wie großzügig und großartig er sich dabei vorkam, obwohl die Summe sehr klein war. Ich holte schon Luft, um einen Einwand vorzubringen. Konrad aber griff beschwörend nach meiner Hand. „Wir müssen sparen, Kleines. Das musst du einsehen. Du willst bestimmt nicht ewig auf dem Feldbett schlafen. Als Erstes legen wir darum Geld für eine Doppelbettcouch zurück“, redete er auf mich ein.
Konrad war also nicht nur überaus ordentlich, nein, er war auch noch sehr sparsam, musste ich erkennen. Ich hoffte nur sehr, dass er nicht geizig war.
Nun hatte ich nicht nur mit der Zuteilung auf Lebensmittelkarten auszukommen, sondern auch noch mit einer begrenzten Summe Geld. Ich wusste, das würde ich nie fertigbringen. Hatte Mama mich nicht immer ermahnt, mit meinem Geld sparsamer umzugehen. Wie sollte mir das nun von einem Moment zum andern gelingen.
Nein, ich schaffte es nicht. Mein so genanntes Taschengeld war immer nötig, um über die letzten Tage des Monats zu kommen. Auch bei den Lebensmitteln hatte ich die Hilfe von Mama und Onkel Anton oft bitter nötig.
Und Konrad sparte. Äußerte ich wirklich einmal einen Wunsch, den Konrad für unvernünftig hielt, so wusste er ihn mir auszureden.
Als ich mich bei Mama darüber beklagte, sagte sie nur: „Sei doch froh, dass du einen so sparsamen Mann hast, der euer Geld nicht vergeudet. Wenn du das Geld verwalten würdest, sähe ich schwarz für euch.“
Vielleicht hatte sie recht. Darum liebte ich ihn auch nicht weniger. Wie schön war es, wenn er mich in die Arme nahm, liebkoste und mir versicherte: „Wie gut, dass es dich jetzt für mich gibt. Du ahnst nicht, wie sehr ich dich brauche.“
Er brauchte mich, und ich brauchte ihn. Was bedeuteten dabei all die kleinen Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte. Es fiel mir kaum auf, dass er immer dominanter bei uns wurde.
Nur manchmal befiel mich der Wunsch aufzubocken, wenn er mir bei der Arbeit zusah und wieder einmal glaubte, mir nachsichtig Ratschläge erteilen zu müssen: „Schau mal, Kleines, machst du das nicht besser so?“
Dann brummte ich unwillig. Sein Kosewort „Kleines“ bekam für mich mehr und mehr einen herablassenden Beigeschmack, was ich ihn spüren ließ.
„Ich meine ja nur“, versuchte er sofort zu beschwichtigen. Doch es klang verletzt.
Schnell schluckte ich meinen Groll hinunter. Warf ihm neckend ein vielleicht nasses Tuch an den Kopf und bald lagen wir uns wieder in den Armen.
Irgendwie verstand ich das nicht. Papa gab bei uns zu Hause auch den Ton an, aber Mama hatte er nie in ihre Arbeit reingeredet. Dabei lebten wir in einer Zeit, in der die Frauen selbstständiger und gleichberechtigter sein sollten als früher. Ich wollte mich nicht so dem Mann unterordnen, wie Mama es noch getan hatte.
Einmal fragte ich sie darum: „Wie hast du das geschafft?“
Da antwortete sie mir verschmitzt lächelnd: „Na ja, Papa hatte zwar das letzte Wort bei uns. Jedoch lernt man es, die eigenen Vorstellungen so durchzusetzen, dass er glauben muss, es wären allein seine Ideen gewesen.“
„Das lerne ich nie!“, rief ich spontan.
„Du kommst eben aus einer anderen Generation. Ihr habt eure eigenen Vorstellungen vom Zusammenleben. Doch auch euch bleibt nicht erspart, dass ihr euch zusammenraufen und anpassen müsst, egal wie gegensätzlich eure Meinungen sind.“
„Mir kommt es so vor, als müsse nur ich mich anpassen.“
„Das erscheint dir nur so. Oder glaubst du wirklich, alles, was du sagst und tust, gefällt Konrad? Es wird schwer für euch werden, wenn jeder nur auf seinem vermeintlichen Recht bestehen will. Du hast ihn doch gern. Macht man da nicht alles mehr dem andern zuliebe.“
Ich bewunderte Mama. Sicher, Papa war bei uns die Autorität, er hatte das letzte Wort, aber Mama war unser Mittelpunkt, sogar für Papa. Wie oft mag nach ihrem Willen entschieden worden sein, ohne dass es uns oder Papa bewusst geworden war?
Mama sah mich an, als erriete sie meine Gedanken. „Du wirst es schon schaffen, Katrina. Du bist doch nicht dumm!“, sagte sie vielsagend.
Ja, schaffen würde ich es sicher, ich liebte ja Konrad. Doch wollte ich es wirklich auf die gleiche Weise ereichen wie Mama? Nein, ich wollte nicht mit List meine Rechte durchsetzen müssen, sondern sie anerkannt wissen.