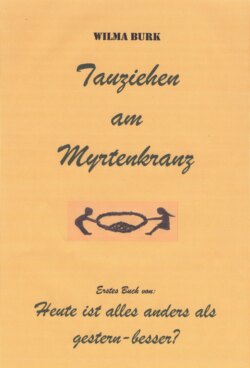Читать книгу Tauziehen am Myrtenkranz - Wilma Burk - Страница 5
3. Kapitel
ОглавлениеDann kam der Tag, an dem Konrad zum ersten Mal zu uns kam. Verlegen und stotternd hatte ich Mama darauf vorbereitet. Es Papa mitzuteilen, überließ ich natürlich ihr. Da hatte ich ihr auch beichten müssen, dass Brigitte als Ausrede herhalten musste, wenn ich mich mit Konrad getroffen hatte.
„War das nötig?“, fragte sie nur kopfschüttelnd.
Und dann kam Konrad. Er kam zwar nicht in einem dunklen Anzug, sondern in jenem grauen, in dem man jede Falte sehen konnte, die einmal eingesessen war, und in der Hand hielt er einen Strauß roter, bereits zu weit aufgeblühter Rosen. Wer weiß, wo er die aufgetrieben hatte? Mama war angenehm überrascht. „Wie es sich gehört“, meinte sie. Unter dem Arm trug er noch ein längliches Paket.
Alle, außer Papa, standen in der Diele um ihn herum und musterten ihn unverhohlen neugierig. Das war sogar Konrad peinlich. Unruhig schob er das Paket unter seinem Arm hin und her. Endlich kam Papa, machte einen Schritt auf ihn zu, begrüßte ihn zurückhaltend und bat ihn ins Wohnzimmer. „Ich denke, wir unterhalten uns erst einmal, um uns besser kennenzulernen“, meinte er.
Konrad übergab Mama schnell noch das Paket, dann verschwanden sie beide im Wohnzimmer und Papa schloss die Tür.
Bruno, Traudel und ich folgten Mama in die Küche. Traudel platzte vor Neugierde, was in dem Paket sei. Doch wie enttäuscht war sie, als Mama nur eine Suppenkelle und einen Schaumlöffel auspackte. Die waren wohl noch aus der Zeit, als er bei der Firma im Osten gearbeitet hatte. Mama lachte und sagte: „Oh, das ist aber aufmerksam in heutiger Zeit.“
Mama hatte zu diesem Tag Kuchen gebacken. Sogar Fett, Eier und Zucker hatte sie nicht so sparsam wie sonst dazu verwandt. „Schließlich ist das ein besonderer Tag“, betonte sie. Nur Bohnenkaffee fehlte, den hätte sie auch noch gern gehabt. Aber diesmal konnte ihr nicht einmal Onkel Anton, Papas Bruder, so schnell dazu verhelfen. Er war Experte auf dem verbotenen Schwarzmarkt, wo man für viel Geld fast alles unter der Hand kaufen konnte - wenn man nur nicht dabei erwischt wurde -. So stand sie also und brühte wie gewohnt Malzkaffee auf. Bruno lümmelte sich neben ihr auf dem Stuhl am Tisch, als sie den Kuchen aufschnitt. Er ergatterte sich ein Stück davon und bekam einen Klaps auf die Finger dafür. Traudel lehnte am Fenster und trat vor Spannung von einem Fuß auf den andern. Sie fand alles so aufregend!
Ich lief unruhig umher. Das Warten wurde mir zur Ewigkeit. Es ging mir auf die Nerven. „Hoffentlich hat er seinen Bankauszug, sein Sparkassenbuch, seinen Impfschein und - Gott weiß was alles – mitgebracht“, moserte ich.
„Aber, Katrina!“, mahnte Mama.
„Was hat Papa sonst so lange mit ihm zu reden, wenn er ihn nicht ausfragt?“, verteidigte ich mich.
Bruno, der sowieso alles albern fand, rief dazwischen: „Das mache ich nie. Ich sehe nicht ein, wozu das alles nötig ist. Wenn mein Mädchen mal ja sagt, dann ist doch alles klar. Oder etwa nicht?“
„Was weißt du schon?“, erwiderte Mama und brachte den Kuchen vor ihm in Sicherheit. „Wenn es so weit ist, wirst du genau das tun, was dein Mädchen von dir erwartet. Und in einer soliden Familie ist es auch heute üblich, die Fragen der Eltern zu beantworten.“
„Ich bestimmt nicht!“, konnte Bruno gerade noch versichern, da ging die Wohnzimmertür auf und Papa rief uns herein.
Allen voran stürmte Traudel. Papa wirkte sehr feierlich. Und Konrad? - Er stand neben ihm mit diesem liebevollen Glanz in den Augen, den ich so an ihm mochte. Ich sah nur ihn. Ich hatte einen Kloß im Hals und war beklommen. Papa sprach viele zu Herzen gehende Worte, unter anderem vom „Bund fürs Leben“. Mama schluckte ein paar Tränen hinunter. Mich erreichte kaum, was Papa so bedeutungsvoll sagte. Wie gebannt stand ich nur und kämpfte hilflos gegen eine mir unverständliche Aufregung, die mich beherrschte. Erst als ich begriff, dass Papa mit Konrad einverstanden war, atmete ich auf. War ich jetzt eigentlich verlobt? In Gedanken fragte ich mich schon, was wohl Brigitte und die anderen im Büro dazu sagen würden.
Da riss mich ein Ausruf von Mama aus meinen Gedanken. „Was denn, so bald? Und keine Verlobung, wie es sich gehört?“, rief sie erschrocken und rang ihre Hände. „Aber Kinder, warum denn so schnell? Ihr kennt euch doch erst ein paar Wochen. Was sind schon ein paar Wochen, um darauf ein ganzes Leben aufzubauen?“
Überrascht sah ich zu Konrad. Keine Verlobungsfeier und schon nach kurzer Zeit die Hochzeit? Er machte einen Schritt auf mich zu. Sein überzeugendes Lächeln erinnerte mich daran, was er auf der Lichtung im Wald gesagt hatte: „Ich will nicht lange warten.“ Und seine Augen schienen in diesem Augenblick seine Worte zu wiederholen. Da hatte ich nichts mehr dagegen einzuwenden. Wieder einmal hatte Konrad, ohne mich zu fragen, entschieden. Wieder einmal war ich stillschweigend damit einverstanden.
„Sehen Sie“, wandte sich Konrad Mama zu, „durch den Krieg bin ich ohne Angehörige. Ich möchte Ihre Katrina, und ich möchte wieder jemand haben, der zu mir gehört.“ So redete er eindringlich auf sie ein, seine ganze Warmherzigkeit setzte er dabei ein. Ich sah, wie er damit ihren Widerstand überwand.
Doch Mama wollte mich nicht so schnell hergeben. „Wie soll ich in dieser kurzen Zeit alles zu einer Hochzeitsfeier beschaffen, wo das gerade jetzt besonders schwer ist?“, versuchte sie einen letzten Einwand.
„Wir brauchen nicht viel, um zu heiraten“, wehrte Konrad ab. „Bitte, verstehen Sie meine Ungeduld“, fügte er hinzu. Dabei sah er mich vielsagend an. Ich verstand, was er meinte. Hier vor Mama und Papa war mir das peinlich. Wenn sie es errieten. Verlegen schlug ich die Augen nieder und errötete heftig.
„Eine Hochzeit ohne Feier - das, Herr Haideck, ist nicht Ihr Ernst?“, machte Mama noch einen letzten Versuch.
Bis hierher hatte ich schweigend dabeigestanden. Alles wäre mir recht gewesen, aber heiraten ohne eine Feier? „Nein“, rief ich dazwischen und blickte Konrad beschwörend an. „Ich möchte eine richtige Hochzeit haben, mit Freunden und Verwandten.“ Meinen Traum von Kranz und Schleier wollte ich nicht aufgeben, nicht einmal Konrad zuliebe.
Noch ehe Konrad antworten konnte, mischte sich Papa ein. „Das können wir immer noch besprechen“, beschwichtigte er.
Jetzt erst wunderte ich mich, dass Papa einer schnellen Heirat nicht widersprochen hatte. Konrad musste ihn im Sturm erobert haben.
„Wir lassen euch erst einmal allein“, bestimmte Papa sichtlich großzügig und schob Mama und Bruno zu Tür hinaus. „Du auch, Traudel“, musste er sie ermahnen. Sie stand neben uns mit großen Augen, wie fest gebannt auf ihrem Platz. Sie wollte nichts, aber auch gar nichts versäumen.
Die Tür schloss sich hinter ihnen. Traudels eifriges Plappern und Brunos herablassende Reden verloren sich zur Küche hin. Er fand das alles übertrieben feierlich. „So 'n Blödsinn!“ hörte ich ihn noch sagen.
Konrad und ich sahen uns stumm an. Hier, in der Nähe meiner Familie, bekam ich es nicht einmal fertig, ihm wie sonst in die Arme zu springen. Fast verlegen wie am ersten Tag, stand ich am selben Fleck. Konrad spürte es. Ein amüsiertes Lächeln huschte über sein Gesicht. Ich fragte mich, ob er wie Bruno dies feierliche Getue auch für Blödsinn hielt. Doch als er in seine Jackentasche griff und ein kleines Kästchen herauszog wurde er ernst. Zwei silberne Trauringe lagen darin.
„Ich hoffe, wir können sie einmal in goldene Ringe umtauschen“, sagte er und streifte mir den schmalen Reif über den Ringfinger der linken Hand. Nun war auch er feierlich geworden. Als ich ihm auch seinen Ring übergestreift hatte, besiegelte ein warmer liebevoller Kuss - kein leidenschaftlicher - unser unausgesprochenes Versprechen, nun unseren Lebensweg gemeinsam zu gehen.
Dann stand Mama mit der Kanne voll dampfendem Kaffee in der Tür und mahnte, dass es Zeit sei, am Kaffeetisch im Wohnzimmer Platz zu nehmen. Bald saßen wir alle in gemütlicher Runde und es war, als hätte Konrad schon immer zu uns gehört. Auch Konrad fühlte sich offensichtlich nicht fremd.
Als der Kaffeetisch abgeräumt war, packte Konrad seine Tabakpfeife aus. Dazu holte er ein Kästchen mit Tabak hervor und bot Papa an, sich daraus auch seine Pfeife zu stopfen. „Das ist aus eigenem Anbau“, betonte er stolz.
Papa nahm das Kästchen entgegen und roch daran. „Donnerwetter“, lobte er, ,,wenn der Tabak so schmeckt, wie er riecht.“
Damit hatten sie ihr Gesprächsthema gefunden, Tabakanbau und seine Fermentierung. Papa pflanzte selbst im Hof unseres Häuserblocks jedes Jahr ein paar Stauden an. In dieser Zeit, da selbst Tabakwaren rationiert waren, hatte jeder Mieter ein Stückchen des ehemaligen Rasens zugeteilt bekommen. So war der sehr geräumige Hof - denn Hinterhäuser gab es in unserer Siedlung nicht - zu einem Schrebergarten geworden. Da wuchsen Radieschen, Tomaten, Gemüse oder eben Tabak.
Tabak, Tabak! - Es war ja schön, dass Papa und Konrad sich gleich so gut verstanden, aber allmählich ging mir dieses ausdauernde Gerede darüber auf die Nerven. Sie ereiferten sich dabei, während wir gelangweilt herumsaßen. Gab es denn an diesem Tag unserer Verlobung nichts Wichtigeres als Tabak? Eigentlich dachte ich, Konrad könnte jetzt nur noch Augen für mich haben und nicht von meiner Seite weichen. Dabei begann ich schon zu befürchten, sie würden noch in den Hof gehen, um das Stückchen Erde mit den jungen Pflanzen zu begutachten. Ungeduldig rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her. Mama sah es. Sie rettete wieder einmal die Situation, indem sie Konrad nach seiner Firma fragte, bei der er arbeitete.
Als Konrad ging, begleitete ich ihn ein Stück die Straße entlang. Ein Weilchen noch hatte ich ihn allein für mich. Fest hakte ich mich bei ihm ein, als würde ich ihn nun besitzen. Ein Glücksgefühl erfüllte mich. Ich meinte, jeder Vorübergehende müsste es erkennen: Ich war verlobt!
*
Diesen Eintritt Konrads in unsere Familie konnte man als gelungen bezeichnen. Doch mit diesem kleinen Kreis hatte er noch nicht alle erobert. Es gab zwei „Käuze“ in der weiteren Familie. So nannte sie Bruno. Doch durften weder Mama noch Papa das hören, denn Mama wollte keineswegs von ihrer Schwester Emmy lassen, noch Papa von seinem Bruder Anton.
Tante Emmy war in jungen Jahren verheiratet gewesen. Dunkel erinnere ich mich an einen Onkel Emil, von dem sie sich jedoch scheiden ließ. Danach war sie im Laufe der Jahre verbittert geworden. Männern und Ehe stand sie fast feindlich gegenüber. Sie war Lehrerin und leitete inzwischen als Direktorin eine Schule. Sie ging ganz auf in ihrer Arbeit und bildete sich auf ihren Erfolg viel ein.
Onkel Anton hatte verstanden, sich im Krieg den richtigen Posten beim Militär zu beschaffen. Als gelernter Hotelkoch war ihm das nicht schwer gefallen. So hatte er in all den Jahren in der Militärküche seine beleibte Figur beibehalten. Auch jetzt noch, als Koch in der Kantine eines großen Werkes tätig, war er nicht viel schlanker geworden. Onkel Anton war die größte Hoffnung Mamas neben Tante Luise vom Lande, was die Tafel der Hochzeitsfeier betraf.
Tante Emmy und Onkel Anton standen zueinander wie Hund und Katze. Tante Emmy pflegte von ihm zu sagen: „Wenn ihr wissen wollt, wie die Männer sind, gewissenlos und egoistisch, dann seht euch Anton an. Der neue Fuchskragen seiner so genannten Haushälterin spricht doch Bände. Oder glaubt ihr tatsächlich, sie sei nur das?“
Niemand zweifelte an der Beziehung Onkel Antons zu seiner Haushälterin. Doch außer Tante Emmy sprach niemand mehr darüber. Einmal hatten Mama und Papa ihn gefragt, warum er sie nicht heiratet. Da hatte Onkel Anton gelacht und gemeint: „Heiraten, mit Ring und so, das ist ungemütlich. Das hat so viele Pflichten und so wenig Liebe.“ So ergab es sich, dass die Haushälterin auch in die Familie eingeladen wurde. Nur gelegentlich fragte noch einer hinter vorgehaltener Hand, wie sich diese Person nicht schämen könne?
Onkel Anton bezeichnete Tante Emmy stets als typische alte Jungfer. „Wenn man nicht wüsste, dass sie einmal verheiratet war“, setzte er jedoch augenzwinkernd hinzu. Im Männerkreis konnte man ihn vieldeutig flüstern hören: „Armer Emil, der wäre ich auch davongerannt.“
Welche Reaktion auf unsere Verlobung und baldige Hochzeit war von diesen beiden zu erwarten?
Onkel Anton lachte, schlug sich auf seine fetten Schenkel und rief: „Wieder ein Unglücklicher ins Netz gegangen!“
Beinahe hätte ich mich darüber geärgert. Aber Onkel Anton nahm man seine Worte nicht so leicht übel. Meistens zwinkerte er dabei mit einem Auge, so dass man nie genau wusste, ob er es scherzhaft oder ernst meinte.
Wie anders dagegen Tante Emmy. „Sssst!“, schnalzte sie ungehalten mit der Zunge. „Wie kann man nach so kurzer Zeit schon heiraten. Das wird ein Jammern geben, wenn ihr merkt, dass ihr nicht zusammenpasst.“ Nie fand sich auch nur eine Spur von Humor in ihren Worten, beinahe bissig stieß sie die heraus. Wir Kinder waren ihr gern aus dem Weg gegangen.
Nur Mama hatte Nachsicht mit ihr. „Das müsst ihr verstehen, das Leben hat es eben nicht gut mit ihr gemeint“, verteidigte sie ihre Schwester.
*
Was konnte mich das alles verdrießen. Die nächsten Wochen waren für mich voller Erwartung und Seligkeit. Traudel wurde nicht müde, mich forschend anzusehen und zu fragen: „Wie fühlt man sich als Braut?“
Konrad gab bald meinem Betteln nach und war einverstanden mit einer Hochzeit mit Kranz, Schleier und Kirche. „Wenn dir so viel daran liegt“, sagte er. Ich spürte, er wollte mir eine Freude machen.
Damit begannen die umfangreichen Vorbereitungen zur Hochzeit. Mama stellte lange Listen all dessen zusammen, von dem sie meinte, dass es zur Feier unverzichtbar sei. Sie bombardierte Onkel Anton mit ihren Wünschen. Lachend hielt er sich schon die Ohren zu. Doch was tat er nicht gern für seine Schwägerin. Es war schon vorgekommen, dass er in besonders vergnügter Stimmung zu ihr gesagt hatte: „Du wärst die Einzige gewesen, die mich zur Ehe hätte bekehren können.“ Doch er zwinkerte mit einem Auge dabei.
Konrad und ich machten uns auf den Weg zum Standesamt, um das Aufgebot zu bestellen. Die vorgeschriebene Wartezeit danach reichte gerade aus bis zu dem Termin, an dem wir heiraten wollten. Mit klopfendem Herzen ging ich neben ihm auf das alte Rathaus aus roten Backsteinen zu. Wir suchten hier das Standesamt vergebens. Auch das Rathaus war so vom Krieg beschädigt, dass nur noch wenige Räume genutzt werden konnten. In einem grauen unansehnlichen Anbau war es behelfsmäßig untergebracht. Ein kleiner hagerer Mann mit schneeweißem Haar nahm unsere Anmeldung entgegen. Er war sicher so alt, dass er eigentlich pensioniert sein müsste. Er musterte uns kurz durch seine dicke Brille, kontrollierte sorgfältig unsere Papiere und entließ uns wieder mit einem Kopfnicken.
„Das war aber ziemlich ernüchternd“, sagte ich, als wir wieder draußen waren.
„Was hast du erwartet?“, fragte Konrad. „Wir heiraten doch erst später.“
Hatte ich wirklich erwartet, alles, was jetzt mit unserer Heirat zusammenhängt, könne nur noch feierlich sein? Nicht einmal der Pfarrer brachte das fertig. In einem unscheinbaren dunklen Raum neben der gewaltigen Kirche, die zum Glück vom Krieg verschont geblieben war, empfing er uns. Ich saß auf der Stuhlkante und hielt mich an Konrad fest, als der Pfarrer begann uns mahnend zu predigen, wir würden nun mit der Eheschließung füreinander Verantwortung übernehmen und sollten sie in gegenseitiger Treue und Achtung führen, im Sinne Gottes. Von Gott sprach er in jedem Satz, er war eben ein Pfarrer.
Wir waren Protestanten. Bei uns Zuhause wurde nicht viel von Gott gesprochen, aber er war immer irgendwie gegenwärtig. Man ging zur Taufe, zur Einsegnung, zur Hochzeit in die Kirche, sonst kaum. Zur Beerdigung, da holte man auch noch einmal einen Pfarrer. Mama sagte stets: „Wenn du Gott im Herzen hast, so musst du ihn nicht auf der Zunge tragen.“
Dann ging es daran zu überlegen, wer alles zur Hochzeitsfeier eingeladen werden sollte. Da gab es Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins, die man nur selten sah. Doch zum Fest gehörten sie dazu, natürlich auch meine Freundin Brigitte.
„Wen willst du einladen?“, fragte ich Konrad.
„Ich weiß niemanden“, antwortete er. Doch dann verbesserte er sich: „Natürlich meine Wirtin.“
Ich wollte es kaum glauben, Konrad hatte niemand, weder in den Westsektoren, noch im Ostsektor von Berlin, auch nicht in der Ostzone. Nur seine Wirtin, in deren Wohnung er ein möbliertes Zimmer gemietet hatte, wollte er dabei haben.
Wir hatten beschlossen zu heiraten, aber wir wussten wirklich wenig voneinander. Auf meine Frage, ob es denn nicht irgendwo noch Verwandte geben würde, erklärte er: „Doch, im Allgäu, in Bayern lebt noch eine Großmutter und eine Tante von mir mit ihrer Familie. Das sind Mutter und Schwester meiner Mutter. Ich habe sie nur einmal in meinem Leben gesehen, als ich noch sehr klein war. Wir hatten nur wenig Kontakt miteinander. Meine Großmutter war gegen die Heirat meiner Eltern gewesen. Dass meine Mutter es dennoch tat, vergaß sie ihr nie.“
„Das kann ich nicht begreifen. Wie können sich Mutter und Tochter so zerstreiten?“ Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals so mit Mama zanken würde.
„Bei euch ist das anders. Ihr seid ein richtiger Familienclan, da haben viele an eurem Tisch Platz. Bei uns war das nicht so. Mutter und Vater waren gern für sich. Sie pflegten auch nicht besonders Freundschaften. Mein Bruder und ich kannten das nicht anders und fühlten uns wohl dabei. Wir hatten unsere Schulfreunde, das genügte“, erklärte Konrad.
Es ging immer unruhiger bei uns zu. Stoff für das Brautkleid musste beschafft werden, der Schleier, der Myrtenkranz. Wo bekam man das alles her? Onkel Anton war auch hier die Rettung. Durch seine Beziehungen zum Schwarzmarkt konnte er alles besorgen. Aber es kostete viel Geld. Das machte Papa nachdenklich.
„Ist es wirklich richtig, in einer Zeit, wo alles knapp ist, so eine Hochzeitsfeier zu planen? Soll ich euch nicht lieber das Geld geben, damit ihr euch etwas für euern jungen Hausstand anschaffen könnt?“, fragte er eines Tages.
Konrad wird ihm gleich beipflichten, befürchtete ich.
Doch da war ja noch Mama. Sie protestierte sofort. „Und wenn die Zeiten noch schlechter wären, Heinrich, so müssten wir tun, was wir können, um Katrina diesen Tag so schön wie möglich zu machen. In der Regel heiratet man nur einmal im Leben. Hast du das vergessen?“
„Schon gut, schon gut!“, wehrte er lachend ab. „Machen wir also das Beste daraus.“
Sicher hatte Mama ihn an ihre eigene Hochzeit erinnert. Es gab ein ganzes Album voller Bilder davon. Es muss damals ein schönes Fest gewesen sein.
Ich atmete auf. Die Feier war gerettet. Ich versuchte Papa noch zu beruhigen. Wir hätten doch beide Arbeit und mit dem jungen Hausstand würde sich das finden, erklärte ich ihm. Ich glaubte wirklich daran.
Als Onkel Anton von Papas Bedenken hörte, lachte er schallend: „Das Wichtigste, was sie brauchen, ist ein Bett.“ Mir schoss wieder einmal die Röte ins Gesicht, was ihn noch heftiger lachen ließ, bis seine Haushälterin ihm mahnend in die Rippen stieß.
Tante Emmy war schockiert, als sie erfuhr, dass wir unsere Ehe in Konrads möbliertem Zimmer bei der Witwe Willinger beginnen wollten. „Als Emil und ich geheiratet haben, war auch keine besonders gute Zeit. Doch mir wäre es nicht in den Sinn gekommen, ohne ein Mindestmaß an Aussteuer, ohne einen eigenen kleinen Hausstand zu heiraten. Die Liebe allein genügt nun einmal nicht. Kein Wunder, wenn Ehen heute so schnell zerbrechen. Klug wäre es, zu warten und später zu heiraten. Aber euch geht es ja nicht schnell genug.“
Es war, als hätte sie vergessen, dass ihre Ehe zerbrochen war, trotz einer kleinen Wohnung und einer Aussteuer aus Bett- und Tischwäsche mit handgestickten Monogrammen, silbernen Bestecks, Rosenthalporzellan und sicher vielem mehr.
„Lass man, Emmy!“, erklärte Mama daraufhin. „Die Kinder werden das bestimmt schaffen. Heute ist es eben so.“
Emsig durchstöberte Mama seit einiger Zeit ihren Haushalt nach entbehrlichen Dingen. In meinem Zimmer wuchs eine Aussteuer, die bei einer angeschlagenen Suppenschüssel begann und bei einem geflickten Bettbezug aufhörte. Und ich fühlte mich reich damit.
*
Im Büro steckten meine Freundin Brigitte und ich jetzt tuschelnd die Köpfe zusammen. Fräulein Krause hatte häufig Grund, ungehalten zu fragen: „Was gibt's?“
Monika und Waltraud, die Amiliebchen, wie wir sie nannten, blickten dabei zu uns herüber, als wären sie von Neid erfüllt? War bei all ihren prickelnden Erlebnissen eine Ehe auch für sie ihr sehnsüchtigster Wunsch? Ich hörte sie hinter meinem Rücken sagen: „Na, wenn man so überstürzt heiratet, da kann doch etwas nicht stimmen. Wir werden ja sehen!“ Und ich wusste, wie sie in der nächsten Zeit meinen Leib mit den Augen abtasten würden, nach der geringsten verfrühten Schwellung suchend, um triumphieren zu können: „Haben wir's nicht gesagt, sie musste heiraten, die Scheinheilige, die immer so brav tut.“
Einmal besuchte ich mit Mama Konrad in seiner „möblierten Bude“, wie er sein Zimmer spöttisch nannte. Es war mitten in der Stadt, in einem richtigen alten Berliner Haus mit hohen Fenstern. Die Erker wurden von steinernen Figuren getragen, denen ein Arm, ein Bein oder eine Nase fehlte, Folgen des Bombenhagels und der Straßenkämpfe im Krieg. Es gab nur vereinzelt Balkons an der Stuck-Fassade mit dem bröckelnden Putz und den sicher einmal schönen Ornamenten. Wenn die Sonne auf die belebte Straße davor schien, so erreichte sie den Boden vor dem Haus nicht. Mit Getöse und rumpelnd fuhr eine Straßenbahn vorbei. Die schwere, geschnitzte Haustür quietschte, als wir sie öffneten und in die Kühle des hohen Treppenhauses eintraten. Blinder rissiger Marmor bedeckte die Wände und als Treppengeländer wand sich eine hölzerne Schlange zu den Etagen hoch.
Konrad wirkte bedrückt, als er uns in die Wohnung einließ. Vielleicht wünschte er in diesem Augenblick, er könnte mir ein besseres neues Zuhause bieten, als dieses Zimmer in einer fremden Wohnung. Der Korridor war dunkel, in den wir eintraten. Die Luft darin schien so alt zu sein wie seine Tapeten und Portieren. Irgendwo in der Dämmerung steckte jemand neugierig seinen weißhaarigen Kopf aus einer Tür und rief uns einen schnellen Gruß zu, ehe er wieder verschwand. Das war die Witwe Willinger, Konrads Wirtin.
„Es ist alles ein wenig unmodern hier“, versuchte Konrad, seine Umgebung zu entschuldigen. „Doch als ich aus der Gefangenschaft zurückkam, war ich froh gewesen, hier überhaupt eine Unterkunft zu finden. Mit meiner Wirtin kann man gut auskommen. Wenn wir uns erst eigene Möbel anschaffen, können wir die alten hinten in der Korridornische abstellen. Das hat sie vorgeschlagen.“ Wollte er mit seinem eifrigen Reden seine Verlegenheit verbergen? Endlos lang erschien mir der düstere Korridor bis zu seinem Zimmer.
Doch als er die Tür dazu öffnete, atmete ich auf. Durch ein großes Erkerfenster sah ich auf einen sonnigen, verwilderten Park gegenüber der Straße. Dass die Gardinen alt und vergilbt waren, bemerkte ich kaum. Meine ganze Aufmerksamkeit galt einem Schaukelstuhl, der davor stand. „Noch nie habe ich in einem Schaukelstuhl gesessen“, rief ich, lief darauf zu und ließ mich hineinfallen.
„Vorsicht!“, mahnte Konrad. „Man kann auch damit umfallen.“
Ich lachte sorglos. „Gehört er auch deiner Wirtin?“
„Nein, er gehörte meiner Mutter. Sie saß so gern darin.“ Zum ersten Mal sah ich Konrads Augen dunkel werden von Trauer erfüllt. „Ich fand ihn in der Laube, die mir noch geblieben ist. Warum sie ihn dort hingebracht hatte, werde ich nie erfahren. So ist er das Einzige, was ich noch von meinem Elternhaus besitze.“
Mama stand derweil und schaute sich schweigend um. Ich sah, wie ihr Blick abschätzend alles aufnahm. Es war ihr anzusehen, dass ihr nicht besonders gefiel, was sie hier vorfand. Bedrückt erhob ich mich wieder aus dem Schaukelstuhl und suchte nach etwas, das mich noch begeistern könnte. Und mein Blick blieb wieder an den hohen Fenstern hängen.
„Sieh mal, Mama!“, rief ich ihr aufmunternd zu. „Auf diesen breiten Fensterbrettern kann ich viele Blumentöpfe hinstellen. Dann wird alles gleich freundlicher aussehen, wenn sie blühen.“
„Das Zimmer liegt nach Norden“, warf Konrad ein. „Die Sonne erreicht die Fenster nicht.“
„Das ist schlecht für blühende Pflanzen“, erklärte Mama knapp.
„Ach, das macht nichts, dann nehme ich eben Schattengewächse. Die sind auch schön.“ Nein, ich wollte alles so freundlich sehen, wie es irgend ging.
Doch gelang mir das? Ich folgte Mamas Blick. In einer Ecke ragte bis zur stuckverzierten Decke ein riesig erscheinender Kachelofen, mit vielen verspielten Ornamenten. War es schwer, ihn zu beheizen? Massige Mahagonimöbel füllten das Zimmer. Sicher waren sie einmal der Beweis für einen hohen Wohlstand gewesen. Jetzt aber wirkten sie, als seien sie voll gesogen mit Vergangenheit, mit Geschehen, was sich lange vor uns hier abgespielt hatte. Mir war, als könnten sie nun von unserem Leben nichts mehr in sich aufnehmen. Bedrückt blickte ich zu Konrad.
Mit einem hilflosen Lächeln stand er da, der sonst so Selbstsichere.
„Aus diesem Zimmer kann man bestimmt etwas machen. Warte nur, wenn wir uns erst neu einrichten können. Du sagtest doch, deine Wirtin hätte nichts dagegen, Konrad?“ Wen wollte ich trösten, Konrad, Mama oder mich? Doch in diesem Augenblick glaubte ich fest an das, was ich sagte.
Noch ehe Konrad antworten konnte, mischte sich Mama ein. Sie stand nachdenklich vor einer Couch. Erstaunlich, dass es diese hier gab, viel besser hätte ein weinrotes Plüschsofa hierher gepasst.
„Auf dem Boden haben wir noch ein altes Feldbett. Ich denke, wir werden es für Katrina herbringen. Sie kann so lange darauf schlafen, bis ihr euch eine neue Schlafstatt anschaffen könnt“, schlug sie vor.
„Das ist eine gute Idee“, pflichtete ihr Konrad bei. „Ich hatte auch schon überlegt, was wir machen können.“
Zweifelnd sah ich Konrad an. Meinte er das im Ernst? Glaubte er, ich würde oft darauf liegen? Sicher, ich sah, eigentlich war die Couch zu schmal für zwei, doch für einen auch wieder bestimmt zu breit. Ich konnte mir nicht vorstellen, neben ihm zu liegen, ohne ihn zu spüren. Mama sah fragend zu mir herüber. Verdammt, wieder wurde ich rot bei meinen Gedanken.
„Doch, doch“, beeilte ich mich, zu versichern, „das ist gut.“
Damit war die Besichtigung beendet. Konrad brachte uns durch den dunklen Flur zur Korridortür. Als wir die knarrende Treppe hinuntergingen, nahm ich noch wahr, dass in den kleinen von Hinterhäusern umgebenen Hof die Sonne schien. Quietschend fiel die schwere Haustür hinter uns ins Schloss.
„Das wird bald dein Zuhause sein“, sagte Mama, als wir zur Haltestelle der Straßenbahn gingen. Und sie dachte sicher an die zwar kleinen, aber freundlichen, hellen Räume ihrer Wohnung, die bisher mein Zuhause waren. Ihre Augenbrauen hatte sie zusammengezogen. Ich wusste, sie war besorgt.
„Bestimmt ist das nicht für lange Zeit“, versicherte ich ihr – und war überzeugt davon.
„Wer weiß?“, meinte Mama nur.
*
Doch keine Sorgenfalte zeigte ihr Gesicht, als wir eines Sonntags Konrad in seiner Laube besuchten. Es war ein herrlicher Frühsommertag. Die lange Fahrt mit der Straßenbahn führte uns immer weiter hinaus aus der Stadt. Bald lösten kleine anheimelnde Häuser in blühenden Gärten die hohen Stadthäuser ab. Schließlich fuhren wir nur noch durch Felder. An einem kleinen Wald war die Endhaltestelle der Bahn. Von hier aus gingen wir eine Chaussee entlang, an der sich links und rechts verschiedene Vereinsanlagen der Schrebergärten befanden. „Frohsinn“ hieß der Verein, zu dem Konrad gehörte. Durch ein großes Tor betraten wir den breiten Weg zwischen den Gärten, der uns zu Konrad führte.
Traudel sprang aufgeregt vor uns her, Bruno versteckte seine Neugier hinter gespielter Langeweile, Mama balancierte ihren selbstgebackenen Kuchen, den sie heil hinbringen wollte, und Papa ging gemessenen Schrittes neben ihr.
Ich war voller Spannung und Bangen. Nach der Besichtigung von Konrads „möblierter Bude“, fragte ich mich, wie es hier sein würde. Ängstlich sah ich immer wieder zu Mama und Papa je näher wir unserem Ziel kamen.
Der Sand des Weges knirschte unter unseren Füßen. Aus den angrenzenden Gärten wurden wir von neugierigen Blicken begleitet. Fremde Menschen, die unter einem Schatten spendenden Baum saßen, drehten sich nach uns um. Ein Stück weiter arbeitete jemand in seinem Garten und hielt in der Arbeit inne. Endlich entdeckte ich Konrad. Er schaute über das Gartentor hinaus nach uns. Ich begann schneller zu laufen und Traudel folgte mir.
„Konrad, hier ist es wunderschön!“, rief Mama, als sie durch die Gartenpforte trat.
„Das kann man wohl sagen“, pflichtete ihr Papa bei.
Es machte nichts, dass die hölzerne kleine Laube längst einen neuen braunen Farbanstrich gebraucht hätte - wer konnte das damals schon -. Es störte auch nicht, dass die kleinen Fenster nur zum Teil Glas hatten und sonst mit Platten vernagelt waren. Auch hier am Rande der Stadt waren sie geborsten bei einem Bombenangriff. Unter einem alten Kirschbaum hatte Konrad um einen Tisch zusammengetragen, was er an Sitzgelegenheiten zu bieten hatte. Bruno lümmelte sich gleich in einem Sessel. Traudel lief neugierig umher und zählte auf, was alles in den Beeten wuchs: Radieschen, Tomaten, Salat, Kohlrabi.
„Sogar Erdbeeren gibt es hier“, rief sie aus einer Ecke des Gartens mit vollem Mund, was verriet, dass sie genascht hatte.
„Traudel, man fragt erst“, tadelte Mama. Sie suchte einen Teller für ihren mitgebrachten Kuchen und verschwand in der Laube. Kurz darauf hörte ich sie hell auflachen.
„Katrina, komm her!“, rief sie.
Gespannt ging ich zu ihr. Sie stand in der kleinen Küche vor einem gusseisernen Herd, in dem es leise knisterte und auf dem ein dampfender Wasserkessel vor sich hin blubberte. An diesem herrlich warmen Frühsommertag trieb die Hitze, die von dem Herd ausging, den Schweiß aus allen Poren.
„Da bin ich aber neugierig, wie du mit diesem alten eisernen Gesellen fertig werden wirst“, prophezeite sie mir frohgelaunt. „In deinem neuen Leben wird wirklich alles anders sein, als du es bei uns bisher gewöhnt bist.“ Dann holte sie aus einem kleinen wackeligen Schrank einen Teller und ging zurück in den Garten.
Ich sah mich um. Der Herd wirkte auf mich wie ein altes Museumsstück. Daneben stand eine Kiste mit Holz und ein paar Kohlen. Weiter gab es noch den wackeligen Schrank einen kleinen Tisch und ein Gestell für Eimer, auch Schüsseln, worauf oben ein Krug mit Wasser stand. Richtig, ich hatte ja neben der Laube eine Wasserpumpe bemerkt. Hier gab es kein fließendes Wasser und keinen Strom. Auf dem Tisch stand eine Petroleumlampe für die Dunkelheit. An einer Seite dieser kleinen Küche war ein Durchgang mit einer Portiere verhängt. Ich schob sie beiseite. Winzig war der Raum dahinter. Links und rechts an der Wand stand je ein schmales Bett. Konrad schien sehr ordentlich zu sein. Exakt ausgerichtet lagen Bettdecken und Kissen darauf. Gleich neben dem Durchgang gab es noch einen Schrank für Garderobe. Das war alles in dieser Laube. Wo war das Klo? Ich fand keine Tür, die dahin führen könnte. Später stellte ich fest, hinter der Laube gab es noch einen Schuppen, hier war dann auch das Klo. Ein Plumpsklo!
Ja, Mama hatte Recht, alles wird anders sein. Aber Konrad und ich werden hier zusammen leben, nur das zählte. Eigentlich war es reizvoll, ein neues Leben beginnen zu können, dachte ich und ging aus dem Dämmerlicht der Laube hinaus in den Sonnenschein zu den andern.
Mama deckte den Tisch, Bruno malte mit einem Stock Figuren in den Sand, Traudel hockte noch immer bei den Erdbeeren und Papa stand mit Konrad bei den Tabakstauden. Sie waren wieder bei ihrem Lieblingsthema. Doch ein Ruf von Mama und wir saßen alle um den Tisch. Ein sanfter Wind spielte mit den Blättern im Baum über uns. Der Kaffee dampfte aus unseren Tassen. Es roch nach Bohnenkaffee. Mama genoss jeden Schluck.
„Wo hast du den nur her, Konrad?“, fragte sie angenehm überrascht.
Viel zu schnell wurde es Abend und wir fuhren zurück in die Stadt. Gelöst und glücklich saß ich in der Straßenbahn. Ich träumte zum Fenster hinaus. Wie schön, dass Konrad diesen kleinen Garten hatte! Wurde uns mal die Stadt zu unruhig oder die „möblierte Bude“ zu dunkel, so konnten wir dorthin flüchten. Ich spürte, auch Mama und Papa waren von diesem kleinen Ausflug begeistert. Traudel fragte schon ungeduldig, wann wir das nächste Mal hinfahren.
*
Es waren schöne Wochen, die jetzt folgten, voller Vorbereitungen zur Hochzeit und aufregender Erwartung. Aber mich störte, dass man Konrad und mir kaum Zeit zum Alleinsein ließ. Auch dass die politischen Spannungen um Berlin wieder zunahmen, ängstigte mich. Dabei wollte ich von alledem am liebsten nichts hören. Ich wollte nur mit Konrad zusammen sein und mich zurückziehen in meine Traumwelt, in der ich mir unsere gemeinsame Zukunft ausmalte. Doch das Zeitgeschehen holte mich ein.
Immer wieder hatte es Spannungen und Unstimmigkeiten zwischen den Westmächten und der Sowjetunion um Berlin gegeben, weil es innerhalb der Ostzone lag. Im März hatten die Sowjets schließlich den Kontrollrat verlassen, in dem sie mit den drei Westmächten zusammen waren. Damit war die gemeinsame Verwaltung der Stadt durch die vier Siegermächte gestört.
Wieder und wieder kam es zu Behinderungen auf den vereinbarten Zufahrtswegen von den Westzonen Deutschlands durch die Ostzone zu den Westsektoren Berlins. Die Sowjets wurden nicht müde, stets neue Gründe dafür zu finden. Es gab erneut politische Debatten und Protestnoten wurden ausgetauscht. Wie oft seit Kriegsende befürchteten wir eigentlich bereits, dass ein neuer Krieg zwischen Ost und West ausbrechen könnte? Jedes Mal befiel mich dann beklemmende Angst.
Man sprach längst von der Salamitaktik der Russen, womit sie Stück für Stück versuchten, die Westmächte aus Berlin zu verdrängen. Auch in der Frage der Währung konnte keine Einigung erzielt werden. So kam es noch vor meiner Hochzeit zu zwei getrennten Währungsreformen in Ost und West von Deutschland und Berlin, hier die D-Mark und dort die Ostmark. Das bedeutete ein weiteres Stück Teilung von Berlin. Zwei Währungen gab es nun in einer Stadt.
Noch war nach all dem Geschehen die Ruhe nicht wieder eingekehrt, da flog eines Tages im Büro die Tür auf und jemand rief aufgeregt in den Raum: „Alle Wege, Straßen, Bahnen und Flüsse von den Westsektoren Berlins zu den Westzonen Deutschlands sind von den Sowjets versperrt! Nur nach Ostberlin können wir noch.“ Schon verschwand er so schnell, wie er gekommen war.
Schlagartig hörte das gleichmäßige Geräusch der Schreibmaschinen auf. Ungläubig sahen wir uns an.
„Was nun?“, fragte Brigitte.
Ja, was nun? Was wird aus meiner Hochzeit?
Mama erwartete mich bereits, als ich abends nach Hause kam. „Nun dreh nicht durch“, ermahnte sie mich. „Ich weiß zwar nicht, wie das alles jetzt gehen soll, aber heiraten wirst du. Basta!“ Dann nahm sie ihre Einkaufstaschen und rannte los, um zu sehen, was es in den Geschäften noch zu kaufen gab.
Auf dem Heimweg war mir aufgefallen, dass sich wie früher lange Schlangen vor vielen Geschäften gebildet hatten. Auch Mama hatte einige Male im Laufe des Tages angestanden, wenn es noch ein paar Kartoffeln, Mehl oder sonst was zu ergattern gab. „Wer weiß, wann es wieder etwas gibt?“, meinte sie.
Das war der Beginn der Blockade Westberlins durch die Sowjetunion. Bald donnerten die dickbauchigen Flugzeuge der Westalliierten in kurzen Abständen über unser Haus hinweg. Sie übernahmen mit dieser Luftbrücke die Versorgung der Stadt. Die bestehenden Transitwege zwischen den Westsektoren Berlins und den Westzonen Deutschlands konnten gesperrt werden, aber die bestehenden, unter den vier Siegermächten nach dem Krieg vereinbarten Luftkorridore zwischen den Westsektoren Westberlins und den Westzonen Deutschlands nicht. Auf einer Anhöhe am Tempelhofer Flugplatz sammelte sich ständig eine Schar staunender Menschen an, die ungläubig zusahen, was da alles aus den Maschinen ausgeladen wurde. Mit jedem voll geladenen Flugzeug wuchs ihre Zuversicht. Man gewöhnte sich daran, dass es nun Trockenkartoffeln und Milchpulver gab.
Außerdem war der Weg in den Osten der Stadt und die Umgebung noch nicht versperrt, nur die Wege nach dem Westen hatten sie abgeschnitten. Allerdings waren die Lebensmittel auch dort rationiert und kaum etwas zu erwerben. Doch Brötchen in den Bäckereien gab es jetzt frei zu kaufen. Wollten sie damit die Westberliner anlocken? Plötzlich war dazu genug Mehl in Ost-Berlin da, das möglicherweise auf dem Land der Ostzone fehlte.
Je näher der Tag der Hochzeit kam, desto aufgeregter ging es bei uns zu. Es war gut, dass die wichtigsten Dinge längst besorgt waren. Trotzdem wurde Mama immer nervöser und klagte: „Jetzt auch noch die Probleme mit dem Geld und der Blockade, wo ich sowieso nicht weiß, wie ich alles schaffen soll.“ Sie saß über ihren langen Listen, rechnete, nähte an meinem Hochzeitskleid oder sauste mit dem Putzlappen durch die Wohnung.
„Mädel, du machst mich noch verrückt!“ fuhr sie Traudel an, die ihr dauernd mit der Bitte in den Ohren lag, an der Hochzeitstafel neben Konrad sitzen zu dürfen.
Eines Tages erwischte ich Traudel dabei, wie sie versuchte, sich meinen teuer erstandenen Brautschleier aufzustecken. Eitel drehte sie sich dabei vor dem Spiegel, so dass ich befürchtete, das zarte Gewebe könnte unter ihren ungeschickten Fingern zerreißen.
Bruno zog sich am liebsten mit einem Buch in einen stillen Winkel zurück. „Das riecht jetzt hier so entsetzlich nach Myrtenkranz“, schnüffelte er verächtlich.
Mama und Papa hörte ich oft über das politische Geschehen miteinander reden. An mir rauschte das jetzt vorbei. Ich half Mama beim Nähen meines Hochzeitskleides und stichelte alle meine Träume von einer schönen und unbeschwerten Zukunft mit Konrad hinein.
Der Sommer hatte bereits seine höchste Zeit hinter sich, die Zugvögel begannen sich zu sammeln und die ersten Blätter an den Bäumen verfärbten sich, als ich Kranz und Schleier aufstecken konnte.