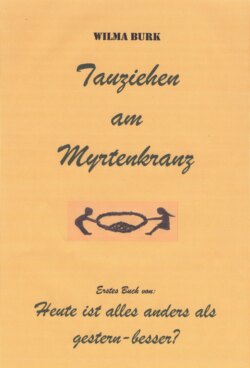Читать книгу Tauziehen am Myrtenkranz - Wilma Burk - Страница 7
5. Kapitel
ОглавлениеAlle Aufregung um die Hochzeit war vorüber. Unsere gemeinsame Zukunft begann. Glücklich, aber müde, saß ich dicht an Konrad gelehnt in der Straßenbahn, die uns zu sorglosen Ferientagen in Konrads kleinen Schrebergarten brachte.
Nur wenige noch verschlafen dreinblickende Fahrgäste fuhren so früh mit uns. Wahrscheinlich waren sie auf dem Weg zur Arbeit. Keiner achtete auf uns oder auf den Brautstrauß, der mit seinen an den weißen Seidenbändern hängenden Myrtenkränzen verräterisch aus meiner Tasche lugte. Langsam erwachte die Stadt unter strahlendem Sonnenschein. Die gewohnten Geräusche täglicher Geschäftigkeit nahmen zu. Hinaus fuhren wir aus der Stadt, fort von den engen Straßen mit den hohen Häusern, hin zu den Feldern, dem kleinen Wald und den Schrebergärten, die gerade noch zu den Westsektoren gehörten.
In den Taschen zu unseren Füßen befanden sich hauptsächlich Lebensmittel für den kurzen Urlaub. Mama hatte alles Mögliche eingepackt. „Wer weiß, wie du mit den Rationen auf Lebensmittelkarten zurechtkommst“, hatte sie gemeint.
Ich musste lachen, als ich darüber nachdachte, und stieß Konrad an. „Wir haben aber ein seltsames Gepäck für eine Hochzeitsreise“, sagte ich.
Er gähnte heftig und nickte.
„Ob wir später einmal eine Reise nach Venedig machen können? Vielleicht, wenn wir die silbernen Trauringe in goldene umgetauscht haben?“, spann ich meinen Gedanken weiter.
Doch Konrad hörte mir nicht zu. Der Kopf war ihm herabgesunken und er schlief, wohl benebelt von seinem noch immer anhaltenden Rausch.
An der Endhaltestelle weckte ich ihn. Schlaftrunken sah er sich um. Nur langsam begriff er, wo er sich befand. Wir waren die letzten Fahrgäste. Schmunzelnd sah uns der Straßenbahnschaffner nach. Mir war es peinlich, dass Konrad fast aus dem Waggon stolperte. Leicht schwankend ging er neben mir her. Die schweren Taschen schienen ihn mal nach links und mal nach rechts zu ziehen.
„Oh, hoppla! Schubst du mich etwa?“ Dabei machte er einen missglückten Versuch, verschmitzt zu grinsen.
Die Schrebergartensiedlung wirkte noch verschlafen. Hier und da öffnete gerade einer seine Laubentür, reckte sich in der Morgenluft und sah uns neugierig entgegen. Was mochte er denken beim Anblick des schwankenden Konrad und mir, mit dem versteckten Rosenstrauß in der Tasche. Sicher wussten sie alle, dass wir geheiratet hatten und jetzt auf dem Weg zur Laube, zu unserer Hochzeitsnacht waren. Ich war froh darüber, dass sich wenigstens bei unseren unmittelbaren Nachbarn noch nichts rührte. So konnten wir von ihnen ungesehen in die Laube gelangen, obgleich die Gartentür in der Stille des Morgens besonders laut quietschte.
„Treten Sie ein, gnädige Frau, in meinen paradiesischen Garten.“ Launig verneigte sich Konrad vor dem Gartentor vor mir, was ihn fast umgeworfen hätte.
„Paradies? Wo ist das? Ich sehe nur eine farblose Laube umgeben von einem Tabakwald“, stellte ich vergnügt richtig.
Doch er hörte nicht mehr hin, sondern schwankte bereits gähnend den Weg zur Laube, schloss die Tür auf und wollte darin verschwinden.
„Halt! Willst du mich nicht über die Schwelle tragen, wie es sich für einen jungen Ehemann gehört?“, rief ich und war mit wenigen Schritten bei ihm.
„Wenn es denn sein muss“, seufzte er, drehte sich um, ergriff mich und hob mich über die Schwelle. Die Tür schlug zu. Wir waren allein. Ein seltsames Flackern war in seinen Augen. Mir wurde heiß. Alle Hemmungen bröckelten. Ich drängte mich an ihn, schlang meine Arme fest um seinen Hals. Mich störte nicht sein alkoholgeschwängerter Atem. Unbeholfen, doch erwartungsvoll küsste ich ihn voller Liebe und Leidenschaft. Da machte er eine schwankende Bewegung, beinahe wären wir beide hingefallen. Spontan ließ er mich aus seinen Armen gleiten. Unsicher lächelte er. Jetzt erkannte ich erst richtig, wie müde und betrunken er war.
Er versuchte an mir vorbei zu sehen. „Verzeih, ich bin hundemüde“, erklärte er. „Himmel, was werde ich schlafen!“ Damit wandte er sich ab und torkelte in das kleine Schlafzimmer hinter der Küche.
War es eine Flucht? Aber wovor? Jetzt konnte er haben, worum er mich auf der Lichtung an der Havel gebeten hatte. Da stand ich erregt und bereit, mich ihm hinzugeben. Ungläubig und zögernd folgte ich ihm. Gleich würde er wieder nach mir greifen, mich mit all seiner Leidenschaft überschütten, dann könnte ich alle durch Erziehung und Moral aufgebauten Hemmungen fallen lassen, mich verlieren, in meiner Liebe zu ihm. So hoffte ich noch.
Ich zog den Vorhang zur Seite. Im spärlichen Licht, das durch das kleine Fenster drang, sah ich, dass Konrad die Betten in der Mitte des winzigen Schlafraumes zusammen geschoben hatte. Er hatte sich bereits an einer Seite in den nun schmalen Gang zwischen Wand und Bett gedrängt. Ungläubig verfolgte ich, wie er seine Schuhe von den Füßen stieß und sich auszuziehen begann, als wäre ich nicht da.
Hilflos und enttäuscht schaute ich zu ihm und klemmte verzweifelt die Tasche an mich, in der sich das für diese Hochzeitsnacht extra besonders ausgesuchte Nachthemd befand. Was sollte ich nur tun?
Konrad sah auf. Schon im Pyjama torkelte er auf mich zu und zog mich ins Zimmer. „Komm, Kleines, dort ist dein Bett. Der Tag war lang. Lass uns schlafen gehen.“
Dann wollte er sich wieder abwenden, erkannte aber wohl die aufsteigenden Tränen in meinen Augen und nahm mich kurz in seine Arme. „Morgen, Kleines, morgen“, versuchte er mich zu trösten. „Weißt du ... der Alkohol ... na ja, ich bin noch zu betrunken, da ... du weißt doch ... du hast doch noch nie“, stotterte er lallend. Dann löste er sich hastig von mir, als wäre er seiner selbst nicht mehr sicher, wankte zum Bett und ließ sich hineinfallen. Es war, als wäre ich für ihn nicht mehr vorhanden.
Längst verrieten seine ruhigen Atemzüge, dass er schlief, da stand ich noch immer zögernd vor meinem Bett. In diesem Augenblick sehnte ich mich nach meinem anheimelnden Jungmädchenzimmer. Was hatte ich mir für Gedanken gemacht, wie es sein würde, wenn ich mich vor seinen Augen zum ersten Mal ausziehen müsste. Ich hatte befürchtet, vor Verlegenheit zu versinken. Und nun? Sorglos konnte ich eine Hülle nach der anderen fallen lassen, ohne dass er mich auch nur mit einem Blick beachtete. Mir war zum Heulen!
Dann lag ich neben ihm. Ich konnte nicht schlafen, zu aufgewühlt war ich von all dem Geschehen dieses Tages. Ich lauschte auf die mir noch fremde Umgebung. Ein leiser Wind war aufgekommen und klapperte irgendwo am Schuppen mit einem Brett. Jemand fuhr mit einem Fahrrad knirschend auf dem Sand des Weges zwischen den Gärten entlang. Die Nachbarn waren erwacht und riefen sich freundliche Morgengrüße zu. Dies alles sollte mir einmal vertraut sein? So enttäuscht, wie ich jetzt war, fürchtete ich mich davor. Ich wollte versuchen Konrad zu verstehen. Doch es half nichts, es schmerzte, dass ich mich zum ersten Mal hingeben wollte und verschmäht wurde. Wie Hohn kamen mir seine Worte in den Sinn: „Ich will nicht lange warten!“ Wie hatte ich mir stets eine Hochzeitsnacht ausgemalt, voller Liebe und Leidenschaft. Ein Traum, der nun zerbrach.
Ausgerechnet jetzt kamen mir die oft gesprochenen Worte von Tante Emmy in den Sinn: „Die Männer sind alle Egoisten. Was fragen die nach den Gefühlen einer Frau.“ Ich sah sie dabei vor mir, in ihrer Hagerkeit, mit den verachtend heruntergezogenen Mundwinkeln.
„Aber Emmy!“, hatte Mama sie jedes Mal vorwurfsvoll gerügt und bezeichnenden zu mir gesehen.
Doch die Sorge von Mama war unnötig gewesen. Gegen diesen Ausspruch von Tante Emmy hatte ich mich sowieso aufgelehnt. War sie nicht selbst Schuld am Scheitern ihrer Ehe? Was konnte Onkel Emil dafür, wenn er nicht so klug war wie sie? Hätte sie ihn das nicht merken lassen, wäre er vielleicht noch heute bei ihr. So jedenfalls erzählte es Mama. Damit hatte ich mich früher immer in meine rosigen Zukunftsträume zurückgezogen. Nein, ich habe nie etwas dagegen gehabt, wenn Mama versuchte, alles Hässliche von mir fernzuhalten.
Und doch blieb mir das Schicksal von Mamas Cousine Gertrud nicht verborgen. Sie kam selten zu uns. Wenn, dann meistens nur, um sich auszuheulen. Mama schloss die Tür vor uns zu, wenn sie leise miteinander sprachen. Eines Tages aber hatte sie es vergessen. Ich konnte hören, wie Cousine Gertrud in der Küche Mama ihr Leid klagte über ihren untreuen Ehemann: „Nicht einmal mehr anfassen tut er mich, Meta. Nur sein Flittchen hat er im Sinn, diese junge unverschämte Person. Doch fürs Wäschewaschen bin ich ihm noch gut genug.“ Sie weinte sehr.
„Was willst du machen, Gertrud? Denke daran, dass du so wenigstens dein Auskommen hast, wenn du es auch sonst nicht ändern kannst“, redete Mama ihr zu.
Das sagte Mama? Ich konnte es kaum glauben.
Mama erschrak, als sie bemerkte, dass ich alles mit angehört hatte. „Das mit Gertrud und ihrem Mann ist wirklich eine Ausnahme“, versuchte sie mir damals zu versichern.
Wirklich?
Verrückt, jetzt enttäuscht von einer Hochzeitsnacht, die nicht so verlief, wie ich sie mir vorgestellt hatte, fielen mir diese unerfreulichen Beispiele ein.
Endlich überkam auch mich Müdigkeit. Noch einmal sah ich all die wissenden, fast lüsternen Blicke vor mir, die uns zum Abschied begleitet hatten. Woran hatten sie alle gedacht - und wie war es gekommen. Das Verlangen, unbändig zu lachen, überkam mich. Ich versuchte, es unter der Bettdecke zu ersticken. Doch Konrad schlief, er hörte es nicht.
Nur noch halbwach erinnerte ich mich an seine Worte von vorhin: „Morgen ...“ – morgen ..., dachte ich und schlief ein.
*
Wie habe ich einen Tag wirklich leben können ohne dich, Konrad, wie einen Morgen erwachen, ohne auf deinen Schlaf eifersüchtig zu sein? Ich küsste deine borstigen Wangen bis sich deine Arme um mich schlossen. Wie konnte es eine Zeit geben, ohne in deiner Nähe zu sein? Und deine Hände waren immer bereit, mich zu streicheln, dein Mund mich zu kosen und deine Wärme umhüllte mich. Behutsam hast du mich zum ersten Mal genommen, als du deinen Rausch ausgeschlafen hattest. Vergessen war die Enttäuschung der ersten Nacht. Und ich fieberte jeder Vereinigung mit dir erneut entgegen.
Ich lernte es, im flackernden Schein der Kerzen am Abend vor dem etwas blinden und gesprungenen Spiegel kokett mein Haar zu kämmen, dass es weich meinen Nacken umspielte. Mit jedem knisternden Strich des Kammes lockte ich dich. Und du kamst als Verführer, rissest mich leidenschaftlich an dich, zerwühltest mein eben geglättetes Haar und warst doch der Verführte. Ich spürte die Macht, die ich über dich besaß. Du gehörtest zu mir. Nichts konnte uns mehr trennen. Ich drehte den silbernen Ring an meinem Finger und glaubte, mit diesem Ring, mit meinem Körper, Frau und erwachsen geworden zu sein.
Nie wieder habe ich eine Zeit so bewusst gelebt, wie diese zwei Wochen dort in der bescheidenen alten Laube. Wir gingen eng umschlungen am Ufer des in der Nähe vorbeifließenden Kanals entlang, wir lagen dicht beieinander in Liegestühlen im Garten und träumten. Aber es gab auch Arbeit in Haus und Garten, die verrichtet werden musste. Bald merkte ich, wie ordentlich Konrad all seine Sachen wegräumte. Mir kamen die Worte eines Cousins über seinen Vater in den Sinn: „Wenn er könnte, würde er noch Haken in seiner Hosentasche anbringen, um darin alles ordentlich aufzuhängen.“ Das konnte beinahe auf Konrad passen. Ich bemühte mich auch, meine Sachen stets aufzuräumen, aber eigentlich lag mir das nicht.
Ich war gewöhnt an ein eigenes Zimmer, wo nichts, was herumlag, jemand im Wege war. Zu Mamas Leidwesen war ich nie besonders ordentlich. Manchmal war sie in mein Zimmer gekommen, hatte sich kritisch umgesehen und vorwurfsvoll gesagt: „Es könnte nichts schaden, wenn du wieder einmal aufräumst.“ Was war ich dann froh, wenn sie nicht noch den Schrank öffnete, aus dem ihr bestimmt alles entgegengequollen wäre.
An Konrads Ordnungssinn musste ich mich nun gewöhnen. Es war mir peinlich, wenn er ein Nachthemd oder Strümpfe von mir aufhob, die achtlos auf den Boden gefallen waren. Schweigend, noch mit amüsiertem Lächeln hielt er sie mir entgegen. Hastig stopfte ich sie sogleich unter die Bettdecke, die keineswegs so sauber gefaltet auf dem Bett lag, wie er es gewöhnt war. Ich war schon froh, wenn er mich nicht fragte, was die Strümpfe im Bett zu suchen hätten.
Auch im Garten war nicht zu übersehen, wie sehr Konrad Ordnung liebte. Voller Geduld und Ausdauer beschäftigte er sich mit diesem winzigen Stück Erde.
„Na, wieder auf Unkrautjagd“, rief ihm der Nachbar launig über den Zaun zu.
„Bei uns können Sie weitermachen, wenn Sie bei sich kein Unkraut mehr finden“, ergänzte ihn seine Frau, und die krausen Locken, die ihr volles Gesicht umrahmten wippten vergnügt dazu.
Das waren gemütliche, freundliche Leute. Seit im Krieg ihre Wohnung in der Stadt von Bomben zerstört worden war, und sie froh waren, mit dem Leben davongekommen zu sein, wohnten sie jetzt ständig in ihrer Laube. Sie hatten inzwischen einen Raum angebaut, aus Steinen, welche die Trümmerfrauen aus dem Häuserschutt wieder verwendbar gemacht hatten. Zu ihnen führte auch eine elektrische Leitung auf hohen Pfählen den Weg entlang. Sie waren nicht die Einzigen in dieser Siedlung, die froh waren, hier eine Bleibe gefunden zu haben, nachdem sie durch Bomben obdachlos geworden waren.
Er hatte eine sonnenverbrannte Glatze und blickte mit zusammengekniffenen Augen neugierig zu uns herüber. Sie trug ständig eine bunte Kittelschürze. Mit ihren nackten drallen Armen erinnerte sie mich an Tante Luise. Sie sahen beide nicht aus, als müssten sie sich viel Sorgen um das Beschaffen von Lebensmitteln machen. Oft zogen um die Mittagszeit verführerische Gerüche aus ihrer Küche zu uns herüber.
Am ersten Tag, als ich mich zuerst verlegen aus der Laube hinter Konrad in den Garten getraut hatte, kamen sie an den Zaun und riefen uns zu sich. Sie reichten uns einen Teller mit selbstgebackenem Apfelkuchen herüber. Verlockend stieg uns der Duft davon in die Nase. Das war eine willkommene Überraschung.
„Jetzt sind Sie sicher hungrig“, sagte die Nachbarin dazu und kicherte.
„Na klar!“, ergänzte ihr Mann und zwinkerte mit den Augen Konrad zu, woraufhin ich rot wurde.
Konrad fand immer etwas zu tun im Garten. Die Arbeit im Haus überließ er mir. „Jetzt habe ich doch jemand für die Frauenarbeit“, erklärte er mir verschmitzt.
Ich war nicht sicher, ob er das ernst meinte. Papa hatte Mama nie im Haushalt geholfen, er war verantwortlich für kleine Reparaturen, die er leisten konnte, und Mama für Waschen, Putzen und Kochen. Arbeitsteilung nannte er das. Allerdings war Mama auch nie berufstätig gewesen. „Papas Geld reicht, und die Kinder brauchen die Mutter.“ So war ihre Meinung.
Doch wie würde es nun bei uns sein? Erwartete Konrad etwa, dass ich im Beruf Geld verdiene und daneben zugleich alle Hausarbeit ausführe? Wir sind doch nicht von gestern! Gab es nicht bereits Frauen, die von ihren Männern erwarteten, dass sie im Haushalt mithelfen? Auch wenn diejenigen noch als „Pantoffelhelden“ verspottet und belächelt wurden, es schienen mehr und mehr zu werden.
Doch diese aufmüpfigen Gedanken währten nicht lange. Noch überwog der Wunsch, alles für ihn zu tun, was ihn glücklich machte, und selbst von ihm geliebt zu werden.
So tat ich mein Bestes. Konrad schien zu erwarten, dass ich alles konnte. Oder tat er nur so? Dabei fühlte ich mich unsicher und unbeholfen bei der ungewohnten Arbeit. Zu selten hatte Mama von mir verlangt, ihr zu helfen, um jetzt alles zu können. Wie von Mama vorhergesehen machte mir der gusseiserne Herd besonders zu schaffen. Er war wirklich mumienhaft alt. Er vermittelte mir den Eindruck, als könne er jeden Moment zusammenfallen. Die Ofentür hing nur noch an einer Angel. Ich musste sehr aufpassen, um sie richtig zu schließen. Wie sollte ich in ihm Feuer entfachen? Ich hatte damit keine Erfahrung. Zu gern blies er mir zuerst eine dunkle Wolke Qualm ins Gesicht, ehe er sich bei langsam züngelnden Flammen erwärmte.
Wenn ich dann endlich einen Topf zum Kochen auf ihn setzte, so kochte es entweder über oder gar nicht. Konrad zeigte mir, wie man die eisernen Ringe mit dem Feuerhaken in das Feuerloch schob, um damit die Hitze für den Topf zu regulieren. Es sah so leicht bei ihm aus. Doch ich brach mir fast die Finger dabei ab und verbrannte sie mir.
„Verfluchte Scheiße!“, entfuhr es mir wütend.
Konrad, der gerade eine Kanne voll Wasser vom Garten in die Küche brachte, sah mich erstaunt an. Ich schämte mich, als hätte mich Mama beim Fluchen erwischt. Sie konnte es nicht ausstehen. „Wo hast du nur dieses zornige Temperament her?“, fragte sie dann. Ob Konrad nie fluchte? Wir wussten wirklich sehr wenig voneinander.
Konrad überging es, was er auch dachte. Schnell stellte er die Kanne ab, kam zu mir, nahm meine Hand, pustete über die verbrannte Stelle und spöttelte: „Ooooch, hast du dir wehgetan?“
Spott, war das Letzte, was ich jetzt bei meinen misslingenden Versuchen vertragen konnte, auch wenn er noch so liebevoll gemeint war. Scheinbar scherzhaft warf ich ihn aus der Küche. Bei weiteren Versuchen mit diesem widerwilligen Gesellen von Herd wollte ich keinen Zeugen haben.
Doch was wollte, was konnte ich eigentlich kochen? Bratkartoffeln, Spiegeleier jeden Tag? Damit würde wohl Konrad nicht zufrieden sein.
Wie oft hatte mich Mama vor der Hochzeit mahnend aufgefordert: „Willst du mir nicht wenigstens mal beim Kochen zusehen?“
„Warum? Wenn es sein muss, werde ich das schon hinbekommen“, antwortete ich stets sorglos. Das bisschen Kochen konnte doch nicht so schwer sein. Davon war ich überzeugt gewesen.
Nun aber stand ich ratlos hier an diesem alten Herd vor Pfannen und Kochtöpfen, deren Böden vom Feuer verrußt waren. Wie empört war ich zuerst gewesen, als ich ein einfaches Kochbuch auspackte, das Mama mir heimlich in die Tasche geschmuggelt hatte. Jetzt jedoch griff ich häufig danach und suchte darin nach Antwort auf all meine Fragen: Wie viel ist eine Prise Salz? Wie rührt man Mehl an, dass es nicht klumpt? Konrad mochte ich nicht fragen. Er wollte mir wohl auch nicht helfen. Er steckte nur neugierig seinen Kopf zur Küchentür herein, um mir bei meinem hilflosen Treiben zuzusehen. Ja, er amüsierte sich sogar darüber, besonders wenn der Ruß der Töpfe durch meine Ungeschicklichkeit bei mir Spuren an Kleidung, Händen und Gesicht hinterließ. Brachte ich aber endlich zögernd das Essen auf den Tisch, dann lobte er es so sehr, dass ich mir veralbert vorkam. Denn vielleicht war es viel zu versalzen, zu hart, zu roh oder voller Klütern, die da nicht hineingehörten.
Tapfer aß er alles. Gelangte dabei jedoch vom Nachbarn her verlockender Essenduft zu uns herüber, so saß ich bedrückt vor meinem Teller. Konrad lachte dann - das Lachen des Überlegenen. Er nahm mich in die Arme und sagte tröstend: „Lass nur, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das schaffst du schon!“
Konrad schien wirklich alles zu können. Ob ihm nie etwas misslang?
*
Der Sommer verabschiedete sich noch einmal mit einem drückend heißen Tag. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel herab. Seit Tagen war kein Tropfen Regen mehr gefallen. Wir stöhnten, wenn wir abends die schweren Gießkannen vom Brunnen durch den Garten schleppten, um die Pflanzen und Sträucher zu tränken.
Kein Windzug bewegte die Blätter. Schwül und stickig war die Luft nach einer Nacht, die keine Erfrischung gebracht hatte. Selbst für eine Umarmung war es zu heiß. Wir hatten nicht Lust, irgendetwas zu unternehmen oder zu tun. Träge lagen wir im Schatten eines Baumes in den Liegestühlen und sahen den sich auftürmenden weißen Wolken im Westen zu.
„Das gibt bald ein Wetter“, sagte Konrad darauf hindeutend.
Zweifelnd folgte ich seinem Blick. Weiße Wolken sahen nicht nach einem Gewitter aus. Ich hoffte, dass Konrad sich irrte, denn ich fürchtete mich davor.
Auch als die Mittagszeit herankam, war noch keine schwarze Wolke zu sehen. Für mich wurde es Zeit, trotz der Hitze, in die Küche zu gehen und Feuer in dem alten Herdgesellen zu machen, um uns wenigstens ein Mittagessen zu erwärmen. Ich hoffte, dass vom Morgen her noch Glut erhalten war. Aber ich hatte Pech. Kein Fünkchen war mehr zu finden. Die drückende Luft hatte alles verlöschen lassen.
„So ein Mist!“, schimpfte ich leise vor mich hin. Doch so, dass es Konrad nicht hören konnte. Dann räumte ich die Asche aus, die bei der Hitze staubte, so dass ich kaum atmen konnte. Holz und Papier türmte ich, wie Konrad es mir gezeigt hatte, zu einer Pyramide und hielt ein brennendes Streichholz daran. Die Flamme griff nach dem Papier und züngelte daran empor. Stinkender, beißender Rauch quoll mir aus dem Herd ins Gesicht, ehe das spärliche Feuer erlosch. Wieder und wieder geschah es so. Bis der kleine Raum grau vernebelt war und ich hustete und hustete!
Das trieb Konrad aus seinem Liegestuhl hoch und zu mir in die Küche. „Was ist denn hier los!“, rief er und riss erst einmal das kleine Fenster auf. „Was machst du bloß? Komm, lass das, Kleines!“ Er schob mich zur Seite. „Ich mach das schon!“ Er war wieder ganz der überlegene Konrad.
Ja, ihm würde es gelingen, dachte ich niedergeschlagen, weil ich wieder etwas nicht geschafft hatte.
Er kniete sich vor dem widerwilligen eisernen Gesellen nieder, nahm das von mir sorgfältig aufgebaute Holz und Papier aus dem Herd heraus und tat es genau so wieder hinein. „Siehst du, so musst du das machen!“, belehrte er mich.
Ich kam mir wieder einmal sehr dumm vor.
Schwungvoll setzte er ein Zündholz in Brand und hielt das zögernd und zuckend brennende Hölzchen an das Papier des Stapels im Herd. „Na bitte!“, bemerkte er, als ebenso wie bei mir die Flamme am Papier zu züngeln begann. Gleich neigte er sich vor und blies hinein. Immer neu holte er tief Luft und pustete die Wangen wölbend in die Flamme, um sie am Brennen zu halten.
„Siehst du, jetzt brennt es“, triumphierte er dazwischen atemlos.
Und es brannte und qualmte. Je mehr er blies, je höher die Flammen stiegen, umso mehr schwarzer stinkender Qualm entwich in die Küche. Konrad gab nicht auf.
Mir tränten die Augen. Ich presste mein Taschentuch vor Mund und Nase und zog mich in die offene Küchentür zurück.
„Brennt es bei Ihnen?“, rief der Nachbar besorgt herüber. Er hielt bereits einen Eimer für Wasser in der Hand.
„Nein, nein!“, beruhigte ich ihn. „Mein Mann versucht nur Feuer im Herd zu machen.“
Da grinste er, winkte mit der Hand ab und rief: „Doch nicht heute! Nicht bei dieser Hitze!“
Konrad konnte ich durch den Qualm kaum noch sehen. Noch immer kniete er, jetzt erbärmlich hustend, vor dem Herd. Plötzlich war der ganze Spuk vorbei. Ich sah keine Flamme mehr. Das Holz schwelte nur noch und dichter Qualm entwich dem Herd. Konrad gab auf. Schemenhaft durch den Rauch kam er auf mich zu.
„Sonst habe ich es immer geschafft. Es muss am Wetter liegen“, erklärte er kleinlaut.
Ich machte einen Schritt zurück in den Garten, als Konrad in der Tür stand und ich ihn richtig sehen konnte. Ich prustete los vor Lachen! Vor mir stand ein verrußter Schornsteinfeger. „Ich habe einen Mohren geheiratet!“, rief ich übermütig. Es tat mir gut, dass auch ihm einmal etwas nicht gelungen war.
Konrad blieb verdutzt stehen, trat mit einem Schritt zum Spiegel in der Küche, sah hinein, drehte sich sehr langsam wieder um, sah mich mit den unnatürlich hell wirkenden Augen in dem schwarzen Gesicht verschmitzt an und machte einen großen Sprung in den Garten auf mich zu.
Ich schrie verspielt auf und versuchte, vor ihm wegzulaufen. Aber er fing mich ein und hielt mich so fest, dass es wehtat.
„Wer macht sich da über mich lustig?“, fragte er launig und wischte sich sein schwarzes Gesicht an mir ab. Dabei blitzten seine Augen seltsam. Ob er es nicht vertrug, wenn ihm etwas misslang?
Neckend balgten wir so miteinander. Wobei es uns nicht störte, dass die Nachbarn in ihrer Arbeit aufgehört hatten und neugierig herübersahen. Erst das Grollen eines aufkommenden Gewitters ließ uns einhalten.
Eine gewaltige schwarze Wolkenwand zog vom Westen her herauf. Es wurde so dunkel, als wollte die Welt untergehen. Eilig sammelten wir zusammen, was nicht bei Regen im Freien bleiben sollte. Ein stürmischer Wind kam auf und ließ uns einigen Sachen hinterherlaufen. Es blieb uns kaum noch Zeit, mit Tüchern so viel Qualm wie möglich aus der Laube zu wedeln, bis ein wolkenbruchartiger Regen einsetzte. Nun mussten wir auch noch Fenster und Tür schließen. Hungrig saßen wir in der kleinen, sicher noch lange nach beißendem Rauch riechenden Küche, und aßen ein schnell gemachtes Brot. Ich zitterte bei jedem Blitz und es donnerte ohne Unterlass. Der Sturm peitschte gegen die kleinen Fenster und auf das Dach trommelte der Regen.
*
An diesem Abend saßen wir noch lange auf einer Bank vor der Laube zusammen, während sich bei offener Tür und Fenster aus der Küche der Geruch nach Rauch langsam verzog. Das Gewitter war so schnell wieder verschwunden, wie es gekommen war. Die Sonne strahlte noch einmal vom Himmel, ehe sie unterging. Die Erde hatte gierig das Nass des Regens aufgesogen und ein würziger Duft stieg empor. Von den Blättern und Bäumen tropfte es noch hier und da. Im Schlafzimmer der Laube war es, von der Sonne aufgeheizt, noch viel zu warm und zu rauchig. Hier draußen, in der kühlen Luft, die wie gewaschen war, war es angenehm. Die ersehnte Abkühlung nach der anhaltenden Hitze tat gut. Die dünne luftige Kleidung hatten wir gegen wärmere Sachen ausgetauscht.
Dicht schmiegte ich mich an Konrad. Es tat gut, bei ihm zu sein. Wann spürt man die Liebe zum anderen mehr, als im stillen Beieinandersein? Mit leuchtendem Orangerot gefärbtem Himmel ging die Sonne unter. Der Tag glitt in die Dämmerung des Abends. Uns umgab eine Stimmung, in der man seinen Gedanken nachhing. Ich fühlte mich glücklich und unbeschwert und ließ meinen Träumen freien Lauf.
„Weißt du, Konrad, was ich mir wünsche?“, unterbrach ich unser Schweigen. „Ich wünsche mir – aber, lach' nicht! - ich wünsche mir einmal ein richtiges Haus mit Garten für uns. Ein Haus, dessen rotes Dach von weitem leuchtet und einen Garten, der viel größer ist als dieser hier, und in dem viele Rosen blühen.“
Konrad nahm einen tiefen Zug aus seiner Tabakpfeife. „Wäre es nicht vernünftiger, erst an eine Wohnung zu denken?“, fragte er.
„Sicher, Konrad. Aber die haben wir bestimmt bald ...“
„Wer weiß?“, unterbrach er mich. „Du scheinst ein Optimist zu sein.“
„Du nicht?“, staunte ich. Ich war überzeugt davon, jetzt, wo wir verheiratet waren, brauchten wir uns nur beim Wohnungsamt anzumelden, und nach einiger Zeit bekämen wir eine Wohnung zugewiesen. Schließlich könnten wir bald Kinder haben.
„Vielleicht würden wir leichter eine eigene Wohnung bekommen, wenn wir erst ein Kind hätten“, sprach ich meine Gedanken aus.
Konrad schwieg.
„Weißt du“, spann ich meinen Traum weiter, „ich möchte gern drei Kinder haben. Wenn wir dann ein Haus hätten mit einem richtigen Garten, könnten wir darin eine Buddelkiste und eine Schaukel für die Kinder aufstellen. Eine eigene Schaukel habe ich mir als Kind sehr gewünscht, aber nie bekommen. Wäre das nicht schön, wenn unsere Kinder eine hätten? Oder was meinst du?“
Auch dazu sagte Konrad nichts.
„Was ist? Hast du mir zugehört?“ Ich griff nach seiner Hand, beugte mich vor und sah ihn fragend an.
Konrad nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife, ehe er fragte: „Sind dir Kinder wirklich so wichtig?“
Ich erschrak. „Wie kannst du das fragen?“
„Du bist noch sehr jung. Hast dir über die Kriegszeit hinaus Träume bewahrt.“
„Ja, aber …“
„Es ist der Krieg, Katrina!“ unterbrach er mich. „Der verändert alles. Das Geschehen an der Front kann dich nicht unberührt lassen, die ständige Gefahr und das Sterben der Kameraden, die vielleicht gerade Freunde geworden waren. Niemand hatte sie je vorher gefragt, ob sie ihr Leben einsetzen wollten. Du hast mit ansehen müssen, wie Menschen zu Tieren wurden, gepeitscht von der eigenen Angst, von der Gewalt, die sie vielleicht selbst erfahren mussten. Da ist es schwer, an das Gute im Menschen zu glauben. Bald denkst du, es kann überhaupt keine Zeit auf Erden ohne Kriege geben. Und in diese Welt werden Kinder geboren. Kann einem da nicht der Gedanke kommen, ob es nicht besser sei, keine Kinder in die Welt zu setzen, um ihnen dies zu ersparen?“
Mich fröstelte. Ich zog meine Hand zurück. Konrads Vergangenheit stand plötzlich zwischen uns, zwischen mir und all meinen Erwartungen.
„Und dann kommst du nach Hause“, redete er weiter. „Alles würdest du am liebsten hinter dir lassen und möglichst vergessen. Doch du stehst nur vor Trümmern. Keiner ist mehr da, der sich darüber freut, dass du überlebt hast. Da fragst du dich, warum du nicht gefallen bist wie die andern. Warum konnte nicht an meiner Stelle einer nach Hause kommen, um den jetzt geweint wird?“
„Konrad, und jetzt? So kannst du doch nicht mehr denken, oder?“, fragte ich ängstlich.
„Nein, Kleines, jetzt gibt es dich und mein Leben hat wieder einen Sinn.“ Sacht legte er seinen Arm um mich. „Nur, die Erlebnisse dieser Jahre kannst du nie ganz ablegen, sie haben dich geprägt.“
Ich schmiegte mich dichter an ihn, wusste nichts darauf zu antworten. Schweigend hingen wir unseren Gedanken nach. Ein leichter Wind war aufgekommen und raschelte in den Zweigen.
Konrad nahm erneut einen tiefen Zug aus seiner Pfeife, so dass der Tabak im Pfeifenkopf rot aufglühte und sprach weiter: „Manchmal denke ich, mein Vater könnte noch leben. Doch das ist wohl nur eine trügerische Hoffnung. Man hat mir versichert, von dem Trupp, mit dem er losgezogen sei, wären alle durch einem Volltreffer vernichtet worden. Das hätte keiner überleben können. Gelegenheit, dies zu prüfen, hatten sie allerdings nicht, da die Russen zugleich vorgerückt waren. Darum hat man meinen Vater für vermisst erklärt. So sollte ich eigentlich wissen, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und dennoch! Als Vater vom letzten Urlaub an die Front zurückfuhr war er in einer schlimmen Verfassung gewesen. Mein kleiner Bruder, sechzehn Jahre alt, war gerade bei einem Bombenangriff als Flakhelfer in einem Vorort von Berlin umgekommen. Ich hatte daraufhin Heimaturlaub bekommen. Nie werde ich den Tag vergessen, als ich da nach Hause kam. Meine Mutter klammerte sich an mir fest und weinte hemmungslos. ‚Warum? Warum?’, schluchzte sie. Mein Vater konnte mich nicht ansehen. Er stand am Fenster und seine mageren Schultern zuckten unter dem Schluchzen, das ihn schüttelte. Ja, warum musste ein sechzehn Jahre alter Junge für diesen verdammten Krieg sterben. ‚Für Volk und Vaterland’, so hieß es damals. Mein Vater und ich, wir machten uns große Sorgen um meine Mutter, die wir ja allein lassen mussten in ihrem Schmerz. Ich glaube, das war es, was meinem Vater am schwersten fiel, als er wieder an die Front fuhr. Ich weiß nicht, ob er noch erfahren hat, dass eine Bombe mein Elternhaus und auch meine Mutter vernichtet hatte. Ich kann den Gedanken auch nicht ertragen, wie ihn das getroffen haben muss. Sein Schicksal wird sicher immer im Dunkeln für mich bleiben.“
Still saßen wir nebeneinander. Zum ersten Mal hatte er mir ausführlicher von sich und seiner Vergangenheit erzählt.
„So habe ich noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Eigentlich wissen wir bisher sehr wenig voneinander, Kleines“, fügte er nachdenklich hinzu.
Ja, er hatte Recht. Sicher war dies nur ein Bruchteil von Konrad und seiner Vergangenheit, die ich eben erfahren hatte. Und gab es nicht noch unendlich viel, was ich ihm von mir erzählen könnte? Wie konnte von uns einer wissen, wie der andere in einer bestimmten Situation reagieren würde? Wird es überhaupt möglich sein, den andern wirklich zu kennen, oder bleibt da immer etwas Fremdes, was man mitunter spürt? So, wie jetzt, da ich fröstelnd erkannte, wie viel Fremdes in Konrad sich für mich noch verbarg. Doch wir hatten unsere Liebe. Sie würde uns verbinden, darauf hoffte ich.
„Frierst du?“, riss mich Konrad aus meinen Gedanken, und es klang, als hätte er die traurige Nachdenklichkeit über seine Vergangenheit abgestreift. Er rüttelte mich sacht und zog mich fester an sich.
Ich aber wollte jetzt mehr von ihm wissen. „Du sagst immer, du hättest keinen Menschen mehr. Doch da ist doch deine Großmutter in West-Deutschland. Was ist mit ihr?“
Er lachte auf. Es war ein bitteres Lachen. „Ja, sie gibt es, im Allgäu, in Bayern. Großmutter soll eine harte Frau sein. Da ist auch noch eine Tante, Mutters jüngere Schwester mit ihrem Mann, einem Sohn und einer Tochter. Sie haben den großen reichen Bauernhof vom Großvater übernommen. Eigentlich sollte Mutter als älteste Tochter einen Bauern heiraten und ihn übernehmen. Da Großmutter aber Wert darauf legte, dass ihre Töchter nicht nur reich, sondern auch gebildet waren, schickte sie beide auf eine höhere Schule in der näheren Stadt. Nach dem ersten Weltkrieg ließ sie sogar Mutter zu Verwandten nach Berlin fahren, damit sie auch ein Stück von der Welt kennenlernen sollte. Hier begegnete sie meinem Vater und verliebte sich in ihn. So kam sie, statt mit einem Bauern, mit einem Stadtmenschen daher - auch noch mit einem Berliner, einem Preußen. Kannst du dir vorstellen, wie Großmutter darauf reagiert hat? Sie drohte meiner Mutter, nie wieder ein Wort mit ihr zu reden und sie zu enterben, wenn sie nach Berlin ginge, um ihn zu heiraten. Doch Mutter hat sich nicht beirren lassen, sie hat zu Vater gehalten und ist ihm gefolgt. Dann soll wirklich jeder Kontakt zwischen ihnen abgebrochen sein, bis zu dem Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Von da an gab es wenigstens zu Weihnachten und zu den Geburtstagen einen Gruß, mehr nicht. Ich war noch sehr klein, als wir einmal hingefahren sind. Meine Mutter suchte die Versöhnung. Doch es ging nicht, es blieb das einzige Mal, solange ich denken kann. Meine Erinnerung an meine Großmutter ist nicht sehr freundlich. Ich glaube, ich habe mich als kleines Kind vor ihr gefürchtet. Sie saß da, unnahbar in ihrem langen schwarzen Rock mit den streng nach hinten gekämmten Haaren, und musterte die Welt mit kalten grauen Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals einen Menschen liebevoll in den Arm nehmen könnte.“
„Wie du das beschreibst, hätte ich auch kein Verlangen, dort hinzufahren. Doch was ist mit deiner Tante?“
„An sie habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Irgendwann hatte sich Mutter damit abgefunden. ‚Es reicht, wenn wir ihnen zu Weihnachten schreiben. Wir haben uns, das ist genug’, sagte sie oft. Und so blieb es.“
„Und jetzt haben wir uns beide, Konrad, nicht wahr?“ Ich lehnte mich wie Schutz suchend an ihn.
„Was für ein Glück!“ Es klang erleichtert. „Komm, lass uns hineingehen, es wird kühl.“ Damit stand er auf.
Viele Gedanken gingen mir noch durch den Sinn, ehe ich einschlief. Wie hatte ich den Krieg durchlebt? Sicher, da war etwas von der Angst geblieben, wenn der Boden im Luftschutzkeller schwankte, weil in der Nähe Bomben einschlugen. Es war auch die Furcht, mit der wir uns versteckten, als die Russen Berlin eroberten. Doch immer war da Mama und unser Zuhause für mich gewesen, wie eine Burg, zu der man flüchten konnte, ein Ort, an dem man sich sicher fühlte. „Wir haben bestimmt einen Schutzengel“, hatte Mama uns versichert und damit beruhigt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht wirklich so gewesen?