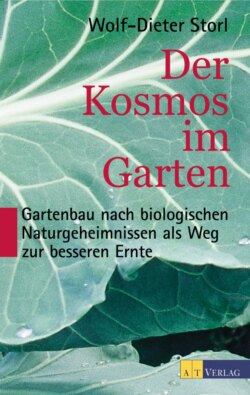Читать книгу Der Kosmos im Garten - Wolf-Dieter Storl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDER GARTEN AN DER HERMETISCHEN QUELLE
Zeige mir deinen Garten,
und ich sage dir, wer du bist!
Christian Grunert
Beim Durchblättern der vergilbten Schriften der alten Alchemisten, Rosenkreuzer und Neuplatoniker tritt dem Menschen des angehenden einundzwanzigsten Jahrhunderts eine recht eigentümliche Welt vor Augen. Da wird die große Natur mit ihren Wäldern, Tieren, Meeren, Winden, Wolken und dem Sternenhimmel als ein riesengroßer Mensch gedacht. Dieser Riesenmensch hat einen von magischen Kräften durchdrungenen Leib, den wir als die sichtbare Natur wahrnehmen. Aber er hat auch eine Seele, die anima mundi, die fühlend, leidend, frohlockend und empfindend die Weisungen eines Weltengeistes, der hinter dem Sternenzelt wohnt, wahrnimmt und ihnen in unzähligen Formen und Gestaltungen Ausdruck verleiht. Dieser »Riesenmensch« wurde mit vielen Namen belegt, wovon Makrokosmos wohl der geläufigste ist.
Der Mensch wird von diesen alten Philosophen als ein getreues Spiegelbild des großen Makrokosmos angesehen, nur in ganz kleinem Format. Der Mensch ist demnach ein konzentrierter Auszug, eine Art Salzextrakt, der sämtliche Teile und jegliches Element des Großen in sich hat. Der Mensch als Mikrokosmos hat ebenso seinen kräftedurchwirkten Leib, seine wahrnehmende und fühlende Seele und einen ordnenden, individuellen Geist, der seinem Wollen und Erkennen zugrunde liegt.
Auch ein wohlgestalteter Garten besitzt alle diese Eigenschaften, auch er ist gewissermassen ein Mikrokosmos. Obwohl ein Garten aus vielen Einzelteilen und einzelnen Lebewesen besteht, fügen sich diese doch zu einem »Organismus«, einer Individualität höherer Ordnung, zusammen. Und das nicht nur im geläufigen ökosystematischen Sinne. Schon architektonisch gestaltet der Garten sich, wie einst die Sakralbauten der alten Zivilisationen, anthropomorph, das heißt wie der Menschenleib. Man betrachte nur den Grundplan der mittelalterlichen Klostergärten, der Bauerngärten (Hauser 1976: 36) oder auch der Schrebergärten. Wie im menschlichen Körper kommt im Gartenentwurf, wenn man die Proportionen, die Längen- und Breitenverhältnisse betrachtet, der goldene Schnitt zum Ausdruck. Ein Hauptweg teilt den Garten in eine rechte und eine linke Hälfte, in denen die Beete wie Rippen liegen. Rechtwinklig durchquert ein anderer Weg den Hauptweg, so dass sich ein Kreuz formt. Hier, in der »Herzensmitte« des Gartens, findet sich oft der Brunnen, eine Kräuterspirale oder ein rundes Mandala aus bunten Blumen, oft mit Gartenzwergen, Gipsfröschen oder einer Statue des heiligen Franziskus bestückt. Kompostmieten und Jauchefässer entsprechen dem Darm und seinen Funktionen. Wie die feste Gehirnkapsel auf dem Körper befindet sich am oberen Ende des Gartens die brombeer- oder rosenumkränzte Laube oder der Geräteschuppen. Da sitzt der gestandene Gärtner in seinen Mußestunden, raucht sein Pfeifchen oder labt sich am kühlen Bier und hängt seinen Gärtnergedanken nach.
Anthropomorphe Gartengestaltung.
Wassertrog, Kompostplatz, Kräuterbeet, Obstbäume und Kleintierställe heben sich wie einzelne Organe aus dem harmonischen Gesamtgefüge heraus. Wie eine dicke Haut umgibt eine Hecke oder ein Zaun den Garten und trennt diese wohlgeordnete Gestaltung von dem Wirrwarr der noch undifferenzierten Natur oder schirmt sie vor der Außenwelt ab. Das Wort »Garten« bedeutete ursprünglich einen eingezäunten, kultivierten Ort (indogerm. ghorto = Flechtwerk, Zaun, Eingefriedetes). Der Garten stellt daher im primären Sinn den Ursprung der Kultur dar (lat. cultura = Pflege des Ackers, Bearbeitung, Bestellung; lat. cultus = Anbau und Pflege von Pflanzen, Pflege von Kunst und Unterricht, Verehrung, Kult). Es handelt sich um einen Ort, der gepflegt wird, der friedlich ist und in dem sich die kosmische Ordnung (griech. kosmos = Ordnung, Anstand, Schmuck) gegenüber dem wilden, wüsten Chaos (griech. chaos = Leere, Durcheinander, ungeformte Masse) behaupten kann. Es ist der Garten Eden, das Paradies (pers. pardez = Garten), der Midgard, der »Garten in der Mitte«, den die Mythen als den eigentlichen, für die Menschen bestimmten Wohnort angeben und in dessen Mitte der Lebensbaum wächst.
Der Garten besitzt Leib, Seele und Geist. Im Gartenleib findet ein reger Stoffwechsel statt: in und über dem Boden, zwischen Kleingetier und Vegetation sowie durch das Wirken des Gärtners, durch sein Gießen, Düngen und Umgraben. Man kann vom »Lebensleib« des Gartens sprechen als von einer kleinen Biozönose, einer Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren, die ihre eigene Kräftedynamik besitzt. Das Seelenelement tritt einem in den bunten Blumen, der summenden Insektenwelt, dem Vogelgezwitscher, den Würmern, Eidechsen, Mäusen und Igeln entgegen wie auch in den Gärtnerträumen, die in bunten Gipsfiguren, in Brunnen- und Beetgestaltung ihren Ausdruck finden. Der ordnende Geist strömt ebenso aus den kosmischen Rhythmen der Sonne, des Mondes und der Planeten wie aus der Vision und Planung des Gärtners.
Es ist der Gärtner, der das vom Makrokosmos, von der Natur Stammende individualisiert und dadurch den Garten zu einem Mikrokosmos macht. Der Gärtnermeister, die Bäuerin oder der alte Schrebergärtner übertragen ihre seelischen und geistigen Inhalte auf den Garten und werden zusammen mit den Naturkräften die »Eltern« dieses Gebildes. Wer nicht glaubt, dass der Gärtner seine Seeleninhalte in den Garten hineingibt, der versuche einmal, im Garten eines leidenschaftlichen Gärtners etwas Geringfügiges zu verändern, etwa einen neuen Weg anzulegen, einen Busch zu roden oder anders als erwartet umzugraben. Es ist, als verletze man diesen Menschen, als beleidige man ihn. Der Garten ist ein getreuer Spiegel dessen, der ihn gestaltet: Er spiegelt den geistigen und seelischen Zustand des Gärtners. Wer seine Seelentriebe ständig zurückdrängt, der beschneidet mit Eifer die Büsche und Bäume; wer Verdauungsschwierigkeiten hat, konzentriert sich auf Kompostierung und Schneckenbekämpfung; wer einen Sauberkeitstick hat, jätet jedes Unkraut und vergiftet jeden Käfer. Der sachlich nüchterne Praktiker pflanzt nur einfache Sorten, die gute Erträge bringen; beim Künstler wachsen oft exotische Gewächse in wirrer Vielfalt; der Offizier a. D. lässt Blumen und Gemüse wie kleine Soldaten zur Musterung in Reih und Glied antreten.
Der Garten als Spiegel des Menschen: War nicht der Klostergarten, der Hortulus, mit seinen in winzige Karrees unterteilten Beeten, in denen zwar liebevoll gepflegte, aber ökotopfremde Kräutlein aus den biblischen Ländern ihr Leben fristeten, ein Spiegel des Lebens in kargen Mönchszellen. Die dicke Mauer des Hortulus hielt Unkraut und Untier wie auch die Teufel fern. Der Garten der Renaissance mit seinen antiken Statuen und Pflanzen aus den neu entdeckten Ländern verrät die Weltoffenheit der Epoche. Anders die Gärten der Aufklärung und aus der Zeit der Inquisition: Hier wird die Natur gedemütigt und vollkommen der menschlichen Ratio unterworfen. Wie im Garten zu Versailles ist alles streng geometrisch eingeteilt, alle Wege führen zu einem Zentrum – es ist die Zeit der absoluten Herrschaft, eine Zeit, in der die Menschen das Universum als Uhrwerk begreifen und den Schöpfer als Uhrmacher. Bemerkenswert sind auch die protestantischen Pfarrgärten, die wie eine Erweiterung der Pfarrbibliothek anmuten; eingerahmt zwischen peinlichst sauber getrimmten niedrigen Buchsbaumhecken, wuchs dort manch exotisches und symbolträchtiges Gewächs.
Bemerkenswert ebenfalls die amerikanischen Gärten mit ihren großen, sorgfältig gemähten grünen Rasenflächen, auf denen Baseball gespielt und »Beef« gegrillt wird. Hinter ihnen verbirgt sich die unbewusste Sehnsucht der weißen Nordamerikaner nach den saftig grünen Weiden und Wiesen des nordwestlichen Europas, die ihre Vorfahren, oft unter Tränen, hinter sich lassen mussten. Diese materialisierten Kollektiverinnerungen verschlingen mehr Kunstdünger, als die gesamte Dritte Welt zur Nahrungsmittelerzeugung verwendet, und dazu Unmengen an Wasser. Auch der deutsche Garten, der Garten hinter dem Haus, der Schrebergarten oder die Datscha in der ehemaligen DDR, verraten viel über das Seelenleben der Besitzer: Nur Spießer und Pseudointellektuelle nennen Gartenzwerge »spießig«. In Wirklichkeit versinnbildlichen sie die ätherischen Kräfte, die in der Natur wirksam sind. Sie stehen für eine Urerinnerung an ein Goldenes Zeitalter, in dem man noch mit den Elementarwesen und Elfen reden konnte. Der Garten ist Schlaraffenland, Sonntagsland. Der Himmel der keltischgermanisch-slawischen Früheuropäer bestand aus einer blühenden Wiese, auf der einst die Götter mit den Würfeln des Schicksals spielten, den Met der Inspiration tranken und das Lebenskraft spendende Spanferkel schmatzten – nur eben sind heute die Götter zu Gipszwergen geschrumpft, das Spiel zu Skat, Jass oder Rommé und die Götterspeisen zu Bier und Bratwurst.
Christus erscheint als Gärtner. Holzschnitt aus: Kleine Passion, um 1510.
Es ist aber nicht nur der Garten, der vom Menschen gepflegt und gestaltet wird; der Mensch wird auch von seinem Garten beeinflusst, belehrt und »kultiviert«. Der Garten wird zum Yoga (altind. yuga = Joch, in das der Körper gleichsam eingespannt ist) und der Gärtner zum Yogi: Seine Hände werden breit und feinfühlig, sein Leib erstarkt, sein Gesicht wird braun und gefurcht wie die Erde selbst, und seine Arbeit, die regelmäßige Pflege der Pflanzen und Geschöpfe, ist für ihn wie ein Kult. Er arbeitet mit den irdischen Kräften zusammen und erkennt das Götterwirken auf der Erde. Er lernt Hoffnung und Geduld, wenn er pflanzt oder den Samen streut, auf die Ernte wartet, auf Regen hofft. Tiefsinnige Bilder gehen vor seinem inneren Blick auf, wenn er viele Stunden, sich rhythmisch bewegend, den Boden hackt oder Kompost schaufelt. Beim Jäten weben sich die wohlgestalteten geometrisch geformten Pflanzenrosetten wie Mandalas in sein Bewusstsein hinein. Die ruhige Arbeit lässt die Gedankenbilder wie Fische in einem Fluss vorbeiziehen, und mit der geistigen Angelrute fischt er mal diesen silbernen, mal jenen goldenen »Fisch« heraus.
In seiner meditativen Arbeit sieht der Gärtner auf die »Innenseite der Phänomene«. Das ist die trans-sinnliche und dennoch absolut wirkliche Dimension, die »Anderswelt« der Kelten, wo man das weiße Einhorn finden, die Heinzelmännchen werkeln oder Freya über taunasse Wiesen wandeln sehen kann. Letztlich sind es diese, in der gärtnerischen Meditation geschauten Wesenheiten, die dann in den Gipszwergen, Wunschbrunnen, Rehlein und Madonnenstatuen ihren physischen Ausdruck finden. Es mag kitschig erscheinen, wurzelt aber tief in den seelischen Archetypen.
Jungfrau mit Einhorn. Tractatus qui dicitur Thomae Aquinatis de alchimia, 1520.
In dieser »schamanischen Seite« des gewöhnlichen Gartens äußert sich die Individualität des Gartens, der Genius Loci, mit dessen Schicksal das eigene verbunden ist. Man kann dieses Wesen ansprechen, wie man einen guten Freund oder eine geliebte Freundin anspricht. Es kann einem sagen, was der Garten braucht, welchen Liebesdienst man ihm erweisen kann. Solch ein Garten »leuchtet« so, dass der Vorbeigehende kurz stehen bleibt und staunt – wie damals, als er noch ein Kind war. Bewusst oder unbewusst wird ihm eine frohe Botschaft mit auf den Weg gegeben. So gärtnert der Gärtner nicht nur in seinem eigenen Garten, sondern – wie der Heiland selbst – im Garten der anderen Seelen.
Oft sind wir Menschen jedoch viel zu wenig sensibel, um die Gartenseele zu sehen und mit ihr zu plaudern. Oft können wir die Runen in diesem von Götterhand geschriebenen Buch nicht entziffern, aber dann wissen wir doch über Nacht, im Schlaf oder durch eine plötzliche Eingebung was, wie und zu welcher Zeit wir diese oder jene Gartenarbeit zu tun haben. Das geschieht ganz gewiss, wenn wir uns fleißig und voller Hingabe mit unserem Garten beschäftigen. Wie der Heiland in den Seelen der Menschen »gärtnert«, so sollten wir in dem uns anvertrauten Garten liebevoll pflegend wirken. Wir schaffen dadurch an unserem eigenen Schicksal.
Heutzutage muten solche Gedanken weltfremd an. Aber einst, als Gärtner und Bauern die Mehrzahl der Bevölkerung ausmachten, erlebte man diese Zusammenhänge von klein auf in der täglichen Arbeit mit der Natur und brachte sie in Sagen, Bauernweisheiten und Sprichwörtern bildhaft ins Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist heute weitgehend verdunkelt, denn die Machthaber streben einer anderen Vision nach: Sie träumen den trügerischen Traum der absoluten Kontrolle über die Natur; sie streben die Verwirklichung der kybernetischen Maschine an, des Golems, der einem die Arbeitslast abnimmt. Kaum kennen wir noch die tiefgründigen Gedanken der Alten. Weil wir zu schnell leben, umgeben von kaum mehr verständlicher Technologie, die uns in elektronische virtuelle Realitäten verstrickt und uns durch die damit verbundene Hektik kaum Zeit lässt, uns in tiefere Besinnung zu versenken, nach innen zu lauschen und zu wirken, machen wir unsere lebendige Erde kaputt. Dieses Gartenbuch folgt der Spur der Blumenkinder, die dem destruktiven technomanischen Rausch den Rücken kehrten und sich auf den Weg zurück zur lebendigen Erde machten.
Die Erde wiederfinden
Bevor wir uns mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen und den praktischen Aspekten des Gartenbaus, dem Pflanzen, Kompostieren und Düngen, beschäftigen, will ich noch meinen eigenen Weg aus der ahrimanischen Zauberwelt beschreiben und gleichzeitig meinen Lehrmeistern danken.
Das Streifen durch Feld und Wald, das Gärtnern und die Erntearbeit bei den Farmern hatten mir schon immer Freude bereitet, und da ich mein Leben in der Natur verbringen wollte, schrieb ich mich nach dem High-School-Abschluss am OSU College of Agriculture ein, um Forstwirtschaft zu studieren. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich mich damit dem »ersten Kreis der technokratischen Hölle« verschrieben hatte. Da gab es keine schönen Bäume mehr, die einem zum Lobpreis des Schöpfers inspirierten, sondern sich selbst erneuernde Ressourcen, deren Wert allein in Dollar gemessen wurde. In dieser Agrarschule wuchsen auf staubigen, mineralisierten Böden unglückliche Pflanzen, von Kunstdünger aufgeschwollen oder mit Isotopen bestrahlt in der Hoffnung, dass daraus gewinnträchtige Mutationen hervorgingen. Im luftgekühlten Stall standen Tiere mit in den Bauch einoperierten Plastikfenstern, damit die Vorgänge bei der Verdauung studiert werden konnten. Wir lernten, dass die unzeitgemäßen Familienbetriebe verschwinden müssten, um einer rationellen, vollautomatisierten Agroindustrie Platz zu machen. Das sei vor allem eine ethische Norwendigkeit: Nur so würde man dem Problem des Hungers in der Dritten Welt Herr werden. Das hier irgendwas nicht stimmte, war mir klar, aber als jungem Menschen fehlen einem die Begriffswerkzeuge, um damit klarzukommen.
Nachdem der Traum, Förster zu werden, geplatzt war, wollte ich erst einmal die Welt kennen lernen. Nach einer langen Wanderung zu den toltekischen Sonnen- und Mondpyramiden und zu den Cheyenne-Indianern in den Rocky Mountains kam ich zurück und studierte Völkerkunde. Um die Landwirtschaft kümmerte ich mich dann kaum mehr, und das freundliche Gesicht der Natur verschleierte sich immer mehr hinter Theorien und Hypthesen, Labor und Büchern. Aber wie das Schicksal einen so oft wieder zum Ausgangspunkt zurückführt, kam ich Anfang der Siebzigerjahre in die Gärtnerei einer Dorfgemeinschaft in der Nähe von Genf, wo ich eine einjährige ethnologische Studie durchführen wollte.
Die Dorfgemeinschaft von Aigues Vertes war ethnologisch und soziologisch interessant, da es sich dabei nicht um ein traditionelles welschschweizerisches Dorf handelte, sondern um eine neu gegründete Gemeinschaft, die sich dem Zusammenleben mit pflegebedürftigen und geistig behinderten Menschen widmete.1 In der Siedlung lebten zu dieser Zeit siebzig bis achtzig Menschen, von denen zwei Drittel mehr oder weniger geistig behindert waren. Man lebte in einzelnen Häusern mit individueller Haushaltung. Je nach Begabung und Verlangen arbeitete man in Werkstätten – Töpferei, Weberei, Schreinerei, Reparaturwerkstatt –, in denen das Handwerk gepflegt und die Arbeit dem Rhythmus der Menschen angepasst wurde. Diese sich selbst verwaltende Gemeinschaft konnte sich dank der mir damals noch unbekannten biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise auch selbst versorgen.
Der Landwirtschaft standen 30 Hektar Land zur Verfügung, davon ein Hektar Gemüsegarten. Das genügte, um die Bedürfnisse an Grundnahrungsmitteln gänzlich zu befriedigen. Und für die Kunden aus der Stadt blieb auch stets etwas übrig. Das ganze Jahr hindurch gab es frisches Gemüse aus dem Garten. Im Winter war das Angebot kleiner, aber immerhin hatte man Karotten, Lauch, Chicorée, Endivien, Zuckerhut, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Speiserüben, Wurzelpetersilie, Randen (Rote Bete) und Rosenkohl. Wenn die Ernte ausreichend war, hatte man bis zum Frühling noch Kohl, Sellerie, Kürbis, Fenchel und Zwiebeln.
Die Gärtner hatten das ganze Jahr über zu tun. Im Sommer war man von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang beschäftigt. Im Herbst wurden noch Gurken eingelegt, Sauerkraut und Dörrobst gemacht. Im Winter gab es weniger zu tun, aber es galt, Komposte umzusetzen, Gemüse für den Verkauf herzurichten, Werkzeuge auszubessern, Brüssler Chicoreé in warme Kästen zu pflanzen, Nüsslisalat (Feldsalat), Endivien und Zuckerhut unter Plastikzelten zu versorgen und, wenn nichts Besonderes oder Eiliges anstand, die vielen Steine, die wie Erdäpfel aus dem Moränenboden zu wachsen schienen, aufzulesen.
Die einzelnen Haushalte gaben ihre Bestellungen jeweils am Morgen auf, das Gemüse und Obst wurde frisch geerntet und direkt zur Küche gebracht. Statistische Aufzeichnungen der Bestellungen ergaben, dass unter dem Gärtnermeister Stauffer die Erträge mit dem Bewohnerzuwachs Schritt hielten, ja sich in manchen Jahren auf gleich bleibender Anbaufläche sogar verdoppelten. Zur selben Zeit nahm der Humusgehalt des Bodens zu, die Regenwürmer vermehrten sich, der Boden wurde dunkler und war leichter zu bearbeiten. Die Ansicht Prinz Kropotkins, dass der Ackerboden nicht bloß Naturgeschenk, sondern hauptsächlich ein Produkt des menschlichen Wirkens ist, hat sich in diesem Fall bewiesen (Kropotkin 1921). Die sorgfältige Kompostierung der Abfälle, Miste und Unkräuter und die Gründüngung haben entscheidend zur Humusverbesserung beigetragen. Auch das Einführen von organischen Stoffen von auswärts, was ja eigentlich keine biologisch-dynamische Praxis ist, hat dazu beigetragen, dass der Boden eine gesunde Humusstruktur bekam.
Für einige Franken oder eine Kiste Bier konnte man die städtischen Lastwagenfahrer dazu bringen, die in den Parks gesammelten Blätter, die Algen aus dem Genfersee und den Schlamm der Straßengräben nach Aigues Vertes zu bringen, anstatt sie in die kantonalen Müllgruben zu kippen. Alles Organische, was man fand, wurde kompostiert: alte Kleider, Küchenabfälle, Lederreste, Haare aus dem Friseursalon und sackweise Hühnerfedern von einer Hühnerfleischverarbeitungsfabrik. Die Weberin, die aus Versehen ihren Schlafsack und Mantel auf einem Lumpenhaufen liegen ließ, fand beides eine Woche später im vollen Vergärungsprozess. Als der Fenchel wegen zu feuchter Lagerung faulte, fand dies der Kompostmeister gar nicht so tragisch, sondern freute sich, dadurch den Komposthaufen vergrößern zu können. Ein Genfer Buchhändler, der dem Dorf einen Lastwagen voll billiger französischer Schmöker schenkte, hätte sich sicher gewundert, wenn er erfahren hätte, dass man sie nicht auf dem Flohmarkt weiterverkaufte. Stattdessen wurden die Bücher in einem Trog eingeweicht, zu einer Miete gehäuft, mit Stammkompost präpariert und mit einem Erdmantel bedeckt. Nach einem Jahr hatte diese Miete so viele Kompostwürmer, dass die Besucher, die neugierig den Garten bestaunten, wohl meinten, es handle sich dabei um »lebendig« gewordenes Hackfleisch. Letztlich wurde der »Bücherkompost« dann doch nicht für die Gemüsekulturen verwendet, da man sich nicht sicher war, ob nicht zu viele Schadstoffe in Papier und Druckerschwärze enthalten waren.
Es fiel mir nicht leicht, die erkenntnistheoretischen Grundlagen dieser Art zu gärtnern zu verstehen. Was sollte man sich auch unter »planetarischen und lunarischen Einflüssen«, »ätherischen Bildekräften« oder »Naturwesen und Seelen, die sich inkarnieren und exkarnieren«, vorstellen? Meine Notizhefte füllten sich mit Einträgen folgender Art: »Bergkristalle werden zu Pulver gerieben und in einem Kuhhorn den Winter über im Boden gelagert. Im Frühjahr werden einige Brösel davon in lauwarmem Wasser eine Stunde lang verrührt. Diese Mischung wird anschließend über den Garten gesprüht, um die formvermittelnden Lichtkräfte den Pflanzen zugänglicher zu machen.«
Bei einem Wolkenbruch tropfte die Dachrinne des Geräteschuppens. Meine mittägliche Freizeit opfernd, flickte ich den Knick. Beim nächsten Regen merkte ich, dass die Rinne wieder an derselben Stelle geknickt war und es heftig daraus tropfte. Wieder behob ich den Schaden. Als das Gleiche ein drittes Mal passierte, hörte ich den Gärtnermeister klagen: »Wer fummelt denn da immer an der Rinne herum?« Ich erfuhr, dass ein mit Eichenrinde gefüllter Schafsschädel unter der Traufe begraben lag, auf den das Regenwasser tropfen sollte. Als ich eines Tages das Verlangen verspürte, im Garten etwas »Ordnung« zu schaffen, indem ich die unkrautbewachsenen Streifen zwischen den Beeten säuberlich mit der Sense mähte, brachte mir auch diese gute Tat nicht das erwartete Lob ein. »Warum, um Himmels Willen, hast du die Schafgarbe abgemäht? Sie soll dort wachsen, sie strahlt positive astrale Energie in das ätherische Geschehen des Gartenorganismus!« Mich beschlich der Verdacht, in diesem Dorf würden die Behinderten von Verrückten betreut.
Im Sommer erschienen schwarze Blattläuse auf den Bohnen. Ich war gleich zur Stelle und opferte etwas von meinem teuren englischen Pfeifentabak, um daraus eine »biologische« Giftbrühe zu kochen, mit der sich die Schädlinge vertilgen ließen. Der Gärtnermeister gebot dem aber Einhalt und meinte, man müsse sich erst überlegen, ob man überhaupt etwas unternehmen sollte. »Was gibt es da lange zu überlegen?«, sagte der pragmatische Amerikaner in mir. »Da ist das Problem, und hier ist die Lösung: ein biologisch abbaubares Pflanzengift, das der Ökologie wenig schadet.«
»Nein«, erwiderte der Gärtner, »wir müssen zuerst gründlich überlegen, warum die Blattläuse überhaupt da sind.«
Auf eine entomologische Vorlesung an der Ohio State University zurückgreifend, versuchte ich ihm klar zu machen, dass der Wind sie wahrscheinlich herbeigetragen hatte und dass wir schnellstens den Ungezieferherd vernichten müssten, ehe er sich weiter ausbreitete. Aber der Gärtnermeister meinte gelassen, dass die Blattläuse eher Symptome schlechter Düngung, Auswirkung falscher Fruchtfolge oder ungünstiger Wettereinflüsse seien und dass es gelte, die Ursachen zu erkennen. Diese könne man erkennen, wenn man die Erscheinung ganz genau beobachte und aus dem Beobachteten dann die richtigen Schlüsse ziehe. Schließlich meinte er, dass die Blattläuse innerhalb einer Woche verschwunden sein würden. Eine Kräftigung der Bohnenpflanzen mit Brennnesselsud und eine Veränderung des Wetters trugen dazu bei, dass die Schädlinge auch tatsächlich verschwanden.
Wühlmäuse waren gelegentlich ein Problem im Garten. Die Mäuse, die des Gärtners Katzen fingen, wurden gehäutet und ihre Pelze zum Trocknen aufgehängt. Die Gärtnersfrau schmorte die Mäusekörper und gab sie ihren Katzen zu fressen. Wenn die Venus im Zeichen des Skorpions stand, wurden die Pelze verbrannt und die Asche auf den Acker gestreut, »damit sich die Tiere ein anderes Revier suchen«.
Aus dem vorgesehenen einen Jahr Feldforschung wurden schließlich knapp drei Jahre. Ich lernte wieder barfuß zu laufen und das Leben der Erde zu spüren. Die Haare und der Bart wuchsen mir lang, und mit ihnen wuchs zugleich die Überzeugung, dass die Haare eigentlich »Antennen« sind, die in die feinstofflichen Bereiche hineinspüren. Der Professor in Bern, bei dem ich promovierte, hegte schon die Sorge, ich könnte die Todsünde des Völkerkundlers begangen und mich zu sehr mit den Subjekten der »teilnehmenden Beobachtung« identifiziert haben. Ein Agronom des Oberlin-College, der nach einer Studienreise durch Länder der Dritten Welt, in denen die »Grüne Revolution« stattfand, auch Aigues Vertes besuchte, meinte, als ich ihm von homöopathischer Medizin für die Pflanzen, von kosmischen Einflüssen und Pflanzengemeinschaften erzählte, dass er den Garten gar nicht erst zu sehen brauche; er wisse schon: »Organic agriculture does not work.« Er freue sich jedoch, dass ich diese Beobachtungen anstellte, denn so könne man diese landwirtschaftliche Quacksalberei entlarven.
Arthur Hermes
Um etwas Besonderes in den »zwölf heiligen Wintersonnwendnächten« zu unternehmen, luden wir einen alten Einsiedler, einen weißhaarigen Bergbauern namens Arthur Hermes, ein, bei uns einige Kurse über bäuerliches Handwerk und »planetarisches Kochen« abzuhalten. Obwohl er schon weit über achtzig Jahre alt war, begegnete uns kein hilfloser Greis, sondern ein regelrechter Bär, der in einer Waldlichtung im Jura, hoch über dem Neuenburgersee, einen kleinen Bergbauernhof betrieb. Obwohl er nicht allzu viel vom Schreiben und Büchermachen hielt, widme ich ihm dieses Buch, denn von ihm lernte ich am meisten über den Geist in der Natur. Und wenn ich im Text gelegentlich von biologisch-hermetischem Gartenbau rede, dann ist vor allem dieser Hermes damit gemeint.
Sein »Michaelshof«, der auch den alten keltischen Namen »Les Biolles« trägt, ist schwer zu finden. Wenn man jedoch nach langer Wanderung die Lichtung am Ende eines gewundenen Waldweges entdeckt, liegt ein anmutiges Bauernhaus vor einem. Es schmiegt sich eng an eine überwachsene Erhöhung, die mitten in der Waldlichtung liegt. In dem Gestrüpp von Eichen, Eiben, Misteln, Stechpalmen und Efeuranken liegen große Megalithsteine, von denen Hermes meinte, sie seien den Druiden heilig gewesen. Wenn Besuch den Weg heraufkam, meldete es ein Buntspecht, so dass Hermes seine Arbeit beiseite legen und den Besuch empfangen konnte. Abends kamen neugierige Rehe bis an die rosenumkränzte Haustür; und wenn man mit Hermes auf der Bank vor dem Haus saß, umsummten ihn zuweilen Bienen und Schmetterlinge, als wollten sie ihm etwas mitteilen.
Hermes wurde im 19. Jahrhundert unter einem Strohdach in der norddeutschen Heide geboren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es ihn in den Schwarzwald, wo ihn bald die Bauern aufsuchten, um Rat zu holen. Schweizer Bauern, die seinen Rat ebenso schätzten, holten ihn dann in die Schweiz. Zur Bestürzung der in ihrem Elfenbeinturm sitzenden Anthroposophen zog er einmal mit sechzig Bauern in die Hallen des Goetheanums. Es war auch Hermes, der die biologisch-dynamische Bauernbewegung in der Schweiz erst richtig in Gang brachte (Storl 1980: 134). Da er die Menschen kannte, die mit dem Kuhgeruch in der Nase zur Welt kommen, ihre Sprache sprach und von ihren Nöten wusste, hatte man Vertrauen zu ihm.
Als Sechzigjähriger zog Hermes mit Familie, Vieh und Geräten auf den Michaelshof, pflügte die Scholle mit Pflug und vorgespanntem Ochsen, säte das Getreide mit der Hand, machte Heu mit Sense, Gabel und Pferdewagen. Mit Frau, Sohn und Tochter arbeitete er im Winter in der Holzwerkstatt und fertigte Schnitzereien und Kinderspielzeug.
Hermes erklärte, dass jede Arbeit mit vollem Bewusstsein getan werden soll, denn wenn man Holz sägt, Korn sät oder Wasser schöpft, prägt sich das, was der Mensch in seinem Bewusstsein trägt, durch den Arbeitsvorgang in die Materie ein. Man schafft so den Nährboden für gute und böse Elementarwesen. Da der Mensch Vermittler der guten Kräfte sein soll, sollte er darauf achten, was er wie tut. In diesem Sinne wurden bei Hermes auch die Tiere behandelt, denen man an ihrem glänzenden Fell und ihren leuchtenden Augen die Lebensfreude anmerken konnte. Mit seinen bloßen Gedanken konnte er sie von der Weide in den Stall zurückrufen. Auch im Garten kam diese ungewöhnliche Einstellung klar zum Ausdruck. Setzlinge wurden so liebevoll, wie man abends Kinder zu Bett bringt, in die Erde gesetzt und mit einer Mulchdecke umgeben. Blumen blühten überall zwischen den Gemüsen. Wenn er den Samen in die Rillen streute, war er in Gedanken bei dem Sonnengeist, der von sich sagt: »Ich bin das Leben.« Die Käfer, Maulwürfe und besonders die Ameisen wurden von Hermes respektvoll als »unsere kleinen Mitarbeiter« bezeichnet.
Dem kritischen Verstand des zeitgenössischen Lesers kommt das womöglich wie ein Rückfall in die Romantik vor. Wenn man jedoch an Ort und Stelle die Atmosphäre spürte und den Michaelshof nach ökologischen Gesichtspunkten beurteilte, musste man gestehen, dass es doch irgendwie stimmte. Aus Hermes sprach nicht nur seine lange persönliche Erfahrung. Man meinte, die Stimmen der Ahnen zu vernehmen, man »ahnte«, was die Vorfahren Jahrtausende hindurch im Zusammenleben mit der Natur erlebt und erfahren haben. Hermes versuchte, sein Schauen seinen Mitmenschen verständlich zu machen, indem er es in die Begriffsformeln Rudolf Steiners fasste. Aber auch Theophrastus Paracelsus und Agrippa von Nettesheim, deren Schriften auf den staubigen Regalen in der Stube zu sehen waren, gaben dem Geschauten Worte. Viele Themen, die in diesem Buch zum Ausdruck kommen, wurden bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Unterhaltung auf dem Michaelshof »durchwandert«.
Lehrjahre
1974 konnte ich einen biologischen Selbstversorgungsgarten für ein kleines Heim für geistig Behinderte im Bernbiet anlegen. Die Sonntagsspaziergänger lobten die schön gewachsenen Gemüse, aber die Unkräuter, die ich wegen ihrer bodenschützenden und ausgleichenden Wirkung absichtlich hatte stehen lassen, riefen bei den Bauern, die ihr Feuerholz sorgfältig aufschichten und den Miststock kunstvoll flechten, nur Kopfschütteln hervor.
Von 1975 bis 1978 veranstaltete ich an einem College in Oregon Kurse in dieser biologisch-hermetischen Gartenbaumethode. Das tat ich aus lauter Begeisterung neben meinen offiziellen Aufgaben als Kulturanthropologe. Das Häuschen, das wir gemietet hatten, befand sich im Wald, ganz in der Nähe des College. Eines Tages, nachdem seine Frau sich lange genug über die Bäume beschwert hatte, sägte der Besitzer die alten Waldriesen auf seinem Grundstück einfach um, türmte die Stämme mit einem Bulldozer übereinander, übergoss sie mit Benzin, zündete sie an und schaute – genüsslich eine Zigarette paffend – zu, wie sie zu Asche verbrannten. Als im nächsten Jahr üppig wachsende Wildkräuter die gerodete Fläche bedeckten, schob er mit seiner Planierraupe die Muttererde zu einem riesigen Haufen zusammen. Es waren eben zu viele unkontrollierbare »verdammte« Unkräuter, die da wuchsen. Ich fragte ihn, ob wir auf dieser Fläche, die ungefähr eine Are ausmachte, einen Gemüsegarten anlegen dürften, und stürzte mich, nachdem er seine Zustimmung gegeben hatte, in die Arbeit. Schubkarre für Schubkarre trug ich den Mutterboden wieder auf die Beete. Von Ranchern ließ ich mir eine Lastwagenfuhre Mist bringen, den ich zu Komposthaufen aufschichtete. Als der Besitzer sah, dass ich auf seinem Grundstück »Shit« abgelagert hatte, war er entsetzt. Ich versicherte ihm jedoch, es würde alles gut verrotten, würde nicht stinken und auch keine Seuche auslösen. Der Garten antwortete auf die liebevolle Pflege mit ungestümem Wachstum. Die überaus reiche Ernte wollten wir auch mit unseren Hauswirten teilen. Als wir mit einem Korb voller Prachtgemüse vor der Tür ihres Fertighauses standen, lehnten sie dankend ab mit den Worten: »Wir essen unser Gemüse lieber aus der Büchse, das ist viel hygienischer.«
Die Studenten, die auf den Weg zu ihren Vorlesungen am Garten vorbeigingen, bestaunten die Beete mit den herrlichen Gemüsen und den vielen bunten Blumen. Sie wollten mehr überr diese unkonventionelle Gartenbaumethode wissen. So kam es zu dem Kurs »Organic Gardening«, der jedes Quartal überbelegt war. Bald stellte mir die College-Verwaltung noch einen zusätzlichen Experimentiergarten auf dem Campus zur Verfügung. Die Studenten fragten, wo sie etwas über diese Gärtnermethode nachlesen könnten. Literatur dazu gab es nicht, da alles, was ich ihnen zeigte, auf praktischer Erfahrung, auf den Anweisungen des Kompostmeisters Stauffer, den Geschichten des Arthur Hermes und auf einigen obskuren Zeitschriften der europäsichen Bio-Bewegung beruhte. »Dann mach uns wenigstens die Vorlesungsnotizen zugänglich«, baten sie. Aus diesen Notizen wurde dann das Buch »Culture and Horticulture«, welches wir den Studenten zum Preis der Herstellung – 1 Dollar pro Buch – überließen. Es dauerte nicht lange, da wurde vor allem an der Westküste die Raubkopie des Buches zum »Underground-Bestseller«. Plötzlich sah man, wie in den kalifornischen Hippie-Landkommunen und bei anderen »Alternativen« die Gestaltung der Gemüsegärten genau derjenigen entsprach, die ich in dem Buch beschrieben hatte.2
Nach Oregon folgte ein Feldforschungsjahr auf einen biologischdynamischen Bauernhof im Emmental und ein längerer Aufenthalt bei Weinbauern in der Charante Maritime, bis es mich wieder in den Garten von Aigues Vertes zog. Der Kompostmeister Manfred Stauffer war inzwischen nach Dornach gegangen. Wahrscheinlich würde ich den Garten heute noch führen, wenn es nicht zu Differenzen mit dem Christengemeinschaftspriester und den anthroposophischen Fundamentalisten gekommen wäre (Storl 1997: 133). Der Garten war zu biodynamisch geworden. Wir Gärtner lebten in einer participation mystique mit den Naturkräften, mit den Elementarwesen, mit den Naturgottheiten. Unsere Vollmondfeste wurden zu wild, denn die Naturgeister nahmen teil daran, tanzten in uns die Fruchtbarkeit der Erde hervor. Dieser »Rückfall ins Heidentum« war zu viel für diejenigen, welche die Fähigkeit zur Ekstase gegen trockenes Bücherwissen eingetauscht hatten. Nachdem die »wilden« Gärtner gegangen waren, nahm auch die Fruchtbarkeit des Gartens ab. Inzwischen ist man wieder beim Kunstdünger angekommen.
Ein ganzes Jahr lang träumte ich jeden Tag von dem Garten, wusste genau, wie es den einzelnen Gemüsekulturen ging, welche Arbeit gerade anstand, spürte, wie die Gartenseele trauerte. Nach einem Jahr – da waren wir schon in indischen Gärten –, nachdem die Sonne den gesamten Tierkreis durchmessen hatte, hörten die Träume abrupt auf.
1 Wie so viele alternative Kommunen zerbrach Village Aigues Vertes an den Egoismen der Teilnehmer und wurde allmählich in eine straff organisierte offizielle Institution umgeformt.
2 Später vergab ich die Rechte an die amerikanische Bio-dynamic Farming and Gardening Association.Viele Ideen in diesem Buch sind in »Culture and Horticulture« (Wyoming, Rhode Island, B-D. Press, 1979) vorweggenommen.