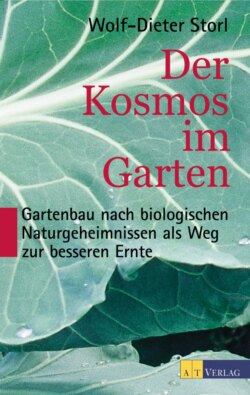Читать книгу Der Kosmos im Garten - Wolf-Dieter Storl - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDIE NEUE LANDWIRTSCHAFT UND RUFER IN DER WÜSTE
Die moderne Landwirtschaft ist ein Wunderwerk der Technik und Wissenschaft
ein untergehendes Schiff wie die Titanic.
Die kleinen Landwirte sind die Rettungsboote.
Sie haben in ihren Nischen Uberlebensmodelle entwickelt und stehen mit ihren Konzepten für eine Trendwende in der Landwirtschaft bereit.
Bernd Lötsch, Biologe und Direktor
des Naturhistorischen Museums, Wien
Das in Religion und Mythe eingebundene Leben der ländlichen Bevölkerung, die Allmende, die Dreifelderwirtschaft und andere organisch gewachsene feudale Einrichtungen zerbrachen an der Aufklärung und dem experimentalwissenschaftlichen und kommerziellen Geist des liberalen Bürgertums. Die Jahreszeitenfeste verloren an Strahlkraft. Man glaubte an »Fortschritt« und sah in jeder Veränderung eine Verbesserung. Kleinbauern und Tagelöhner wanderten aus oder in die Industriestädte ab und überließen das Land den größeren Bauern, die sich nunmehr auf ertragreiche Sorten spezialisierten und den Anbau neuer Pflanzenarten wie Mais, Kartoffeln und Tabak ausprobierten, die Brache mit Hackfrüchten und Textilfaserpflanzen bebauten, Stallfütterung intensivierten und den Mist besser verwerteten. Die Industriebevölkerung der Städte war Abnehmer der Agrarprodukte und lieferte gleichzeitig die nötigen Maschinen und Geräte. An den Rändern der Großstädte entwickelten sich die großen Marktgärtnereien; die Arbeiter, ehemalige Landbewohner, richteten sich kleine Blumen- und Schrebergärten ein. Neben herkömmlichen Gemüsen finden Bohnen, Kürbisse, Topinambur und andere neue Pflanzen aus der Neuen Welt Platz in den Beeten.
Mehr Mist, Abschaffung der Brache, Einführung der Kartoffel, das Drillen des Getreides, Zwischenfrüchte und Klee-Einsaaten führten zuerst in Großbritannien und dann in den anderen Ländern zu enormen Ertragssteigerungen. Bürgerlicher Forschungseifer und Erfindergeist brachten im 19. Jahrhundert in Amerika die ersten Mähdrescher, Dampfpflüge, Kartoffelsetzmaschinen, Dränagen, Stacheldrahtzäune und andere technische Entwicklungen hervor, die die menschliche Arbeit auf dem Land zunehmend ersetzten. Zur selben Zeit begannen Sortenzüchtung, Anwendung der Pharmakologie, Leistungsprüfungen, Versuchsanstalten und Ausstellungen eine Rolle zu spielen.
Als größte Leistung wurde damals die Kunst- oder Mineraldüngertheorie des Chemikers Justus von Liebig angesehen. Diese Theorie, auf deren Umsetzung der Aufschwung der großen agrarchemischen Industrie zurückzuführen ist, geht davon aus, dass die durch die Ernte dem Boden entzogenen Mineralstoffe ersetzt werden müssen. Ob man nun den Boden mit Mist oder mit Mineralsalzen dünge, sei einerlei, denn Stickstoff bleibt Stickstoff, Phosphor bleibt Phosphor und Kalium bleibt Kalium. Man könne also ebenso gut mit mineralischen Salzen düngen und brauche sich nicht mehr mit schmutzigem, klebrigem Tierkot abzugeben. In England begannen J. B. Lawes und der Chemiker J. H. Gilbert die industriemässige Kunstdüngerherstellung, indem sie Knochen oder Kalkphosphatgestein »vitriolisierten«, das heißt mit Schwefelsäure zu Superphosphat machten, und mit Erfolg vermarkteten. Die großen Schlachthäuser und Schlachtfelder – etwa die Gebeine der Gefallenen im Krimkrieg – lieferten das Rohmaterial. Man war überzeugt, dass die chemische Düngung ebenso gute Ernten hervorbringe wie der stinkende, schwer zu handhabende Tiermist. Außerdem war sie billiger, leichter herzustellen und zu verwenden. Der apokalyptische Reiter auf dem fahlen Pferd, der Hunger, schien auf ewig gebannt. Das lang ersehnte Pays de cocagne, das Schlaraffenland, das sich die Menschen schon so lange ersehnt hatten, schien in greifbarer Nähe. Die materialistische Wissenschaft, die den Ackerboden lediglich als Rohstoff für die Zucker und Stärke produzierenden, sonnenenergiebetriebenen Pflanzenfabriken begreift, hatte den Sieg davongetragen. Industrie, internationaler Kommerz und Landwirtschaft verquickten sich zunehmend. Die sich entwickelnde Schwerindustrie lieferte Phosphor, der in Form von Thomasschlacke als Nebenprodukt der Stahlerzeugung anfiel. Kali konnte in Bergwerken im Tagebau gewonnen und auf dem leistungsfähigen Transportnetz der Eisenbahnen verfrachtet werden. Stickstoff (NaNO3), eigentlich uralter, abgelagerter Mövendung, wurde aus Chile eingeführt oder auch als Nebenprodukt bei der Verkoksung von Kohle gewonnen. Von sich aus interessierten sich die Bauern und Gärtner wenig für den Kunstdünger. Ausnahmen waren die Großgrundbesitzer, die dadurch kostenaufwendige Arbeitskräfte einsparen konnten und sich einer erweiterten Profitspanne erfreuten.
Wessen Kind die neue chemische, technisierte Landwirtschaft ist, zeigt sich deutlich. Jeder Krieg gab ihr größeren Auftrieb. Als die Blockade der Alliierten im Ersten Weltkrieg die Einfuhr von Chilesalpeter in die Länder der Zentralmächte verhinderte, baute man in Deutschland Fabriken, in denen die energieaufwendige Ammoniaksynthese im Haber-Bosch-Verfahren stattfinden konnte. Es ging dabei hauptsächlich um die Munitions- und Sprengstoffherstellung, die ja auf Stickstoffverbindungen basiert. Nach dem Krieg blieben die Fabriken bestehen und erzeugten stickstoffhaltigen Kunstdünger für die Landwirtschaft.
Aus den Forschungen zur Herstellung von Giftgasen und chemischen Kampfstoffen, denen im Ersten Weltkrieg 800 000 Menschen zum Opfer fielen, ergaben sich letztendlich die Pflanzenschutzmittel (Insektizide), mit denen dann gegen die Kriecher und Krabbler auf Wiesen und Äckern Krieg geführt wurde (Thompkins/Bird 1991: 13). Was sollte man denn sonst mit den industriellen Kapazitäten tun? Die Genfer Konvention hatte ihre Anwendung zur Vergiftung von Menschen verboten. Anstatt diese Produkte zu verschwenden, wurden sie umfunktioniert. Als Erster der chlorierten Kohlenwasserstoffe wurde DDT, eines der gefährlichsten Abfallprodukte der Militärforschung, von den Alliierten 1943 in Neapel zur Bekämpfung von Läusen eingesetzt und propagandistisch ausgeschlachtet. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurden Nützlinge dezimiert, Boden und Grundwasser verseucht, und zugleich wurden die »Schädlinge« resistent und gefährlicher.
Auch der Vietnamkrieg hatte seine spinn offs für die dummen Bauern. Herbizide und andere Pflanzenvernichtungsmittel wie Agent Orange wurden vom Chemiekonzern Dow Chemical in Massen hergestellt, um die Urwälder Südostasiens zu entlauben, damit die Truppen des Vietkong sichtbar gemacht und ihre Nahrungsmittelgrundlage zerstört werden konnte. Die Überproduktion wurde, als der Krieg vorüber war, gewinnbringend als Unkrautvertilger an die Landwirtschaft weitergeleitet. Eigentlich war das Gift, das dioxinhaltige Herbizid 2,3,5-T schon im Zweiten Weltkrieg in Militärlabors entwickelt worden, um die japanische Reisernte zu vernichten. Da die Atombombe aber früher kam, mussten die mit dem Kampfherbizid beladenen Frachter kurz vor dem Ziel umkehren (Grimm 1999: 206).
Auch die Kernwaffentechnik hielt Einzug in der Landwirtschaft und der Lebensmittelherstellung. In einigen Ländern werden Nahrungsmittel bestrahlt, um Pilze oder Fäulnisbakterien abzutöten und die Produkte haltbarer zu machen. Dass das auf diese Weise behandelte Obst oder Gemüse an Lebenskraft und Nahrhaftigkeit einbüsst, braucht der Kunde ja nicht zu merken.
Noch immer verspricht man sich aus der radioaktiven Bestrahlung des Pflanzenerbguts Zufallsmutationen für gewünschte Eigenschaften. Doch damit sind wir schon beim Thema der Genmanipulation, mit dem wir uns später befassen werden.
Reformbewegungen
Es gab jedoch auch einige nachdenkliche Gemüter, die sich im Laufe der oben beschriebenen Entwicklungen fragten, ob trotz der wissenschaftlichen Errungenschaften nicht doch ein Pferdefuß an der Sache sei. Schon vor der Jahrhundertwende gab es Reformer (Waerland, Kneipp, Graham u. a.), die einer bedrohten Lebensqualität mit natürlicher Nahrung und naturopathischen Kuren begegnen wollten. Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden nach englischem Vorbild die »Armengärten«, wo arme Proletarier Parzellen pachten konnten, um dort frische Luft zu schnappen und etwas Gemüse anzubauen. Um 1870 kamen die Schrebergartenbewegung und die Kleingärtnerkolonien der verschiedenen Naturheilvereine, des Roten Kreuzes und anderer Reformgruppen auf. Hier und da meldeten sich auch Stimmen, die ganz und gar »zurück zur Natur« wollten. Im Großen und Ganzen aber glaubte man fest an den Fortschritt und lehnte die Kritiker als Naturapostel, Fanatiker, Reformköstler und Spinner ab. Im Laufe des weiteren technischen Fortschritts würde ihr Protest schon verstummen.
Rudolf Steiner
Der österreichische Philosoph Rudolf Steiner (1860–1925), Begründer der Anthroposophie, der Waldorfschulen und der anthroposophischen Heilkunde, war für die Ausbreitung der biologischen Landwirtschaft bahnbrechend. 1924 baten ihn schlesische Großbauern um Rat auf der Basis seiner »geisteswissenschaftlichen« Erkenntnisse. Ihre Zuckerrüben wurden zunehmend von Fadenwürmern befallen, das Saatgut verlor an Keimfähigkeit, und die Luzerne, die man früher gut dreißig Jahre lang hatte ernten können, gedieh nur noch ein Dutzend Jahre, zuletzt hatte man sie nur noch vier oder fünf Jahre. Früher, so sagten die besorgten Bauern, nahm man das eigene Saatgut für Roggen, Hafer, Weizen und andere Getreide, aber nun degenerierten die Sorten dermaßen, dass man gezwungen war, immer wieder neues Saatgut zu kaufen. Zugleich kam es vermehrt zu Unfruchtbarkeit bei den Tieren, Schwierigkeiten beim Werfen und Krankheiten im Stall. Zu Pfingsten 1924 hielt Rudolf Steiner acht Vorträge auf dem Gut von Graf Keyserlingk in Koberwitz. Er machte vor allem den mineralischen Kunstdünger für die Probleme der Landwirte verantwortlich. Der mineralische Dünger regt nur die »Wässrigkeit« der Pflanzen an, belebt sie aber nicht; was auf kunstgedüngten Feldern wächst, verliert im Laufe der Zeit an Nährwert (Steiner 1975: 94, 176). Er riet den Bauern, wieder zu kompostieren und die landwirtschaftlichen Arbeiten im Einklang mit den kosmischen Rhythmen zu verrichten. Die Vorträge waren Anlass zur Gründung eines Versuchsrings, dessen Mitglieder die im Kurs stenografisch festgehaltenen Angaben wissenschaftlich erforschen und in der Praxis anwenden wollten. Auf diesen Versuchsring geht die Bezeichnung »biologisch-dynamisch« zurück.
Unvorbereitet kann man die landwirtschaftlichen Vorträge Steiners nicht lesen. Selbst wenn man in der Landwirtschaft tätig ist, bieten sie einige Schwierigkeiten, denn Steiner baut auf einer anderen als der geläufigen Wissenschaftstheorie auf. Er verwirft keineswegs die Wissenschaft – die genaue Beobachtung und die logisch-mathematische Schlussfolgerung –, sondern preist die durch sie bewirkte Disziplin und Gedankenschulung; ja er warnt sogar vor einseitigem Mystizismus und vor »atavistischem« Denken.7 Nur ist seine Wissenschaft auf anderen Grundlagen aufgebaut als die materialistische. Er knüpft an eine andere wissenschaftliche Tradition an, eine, die neben der empirischen Beobachtung und der mathematischen Abstraktion auch kräftemäßige, seelische und geistige Instanzen mit einbezieht und dadurch vermeidet, reduktionistisch vorzugehen.
Durch Bekanntschaft mit einem Kräutersammler im Wienerwald und durch seine Mitarbeit an der Kürschner-Ausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in Weimar kam der junge Steiner als Student mit der okkulten (lat. occultus = verborgen) Strömung in Berührung, die über Goethes naturwissenschaftliches Werk, Paracelsus, die Alchemie und die Homöopathie bis in die Antike zu verfolgen ist. Es war Steiners Anliegen, die aus dieser okkulten Wissenschaft stammenden Einsichten dem modernen Verständnis nahe zu bringen und dem Landmann wieder eine ganzheitliche Anschauung zu vermitteln, die sein praktisches Tun begleiten kann.
Wie schwer Steiners Grundsätze zu verstehen waren – die Generation, die seit dem letzten Weltkrieg aufgewachsen ist, hat weniger Schwierigkeiten damit, zeigt die Abneigung eines so kühnen Denkers wie Sir Albert Howard, der Steiners Methode als »muck and magic« (Mist und Zauberei) bezeichnete und meinte, auf solchen Hokuspokus könne man verzichten. Auch der populäre Gartenbuchautor John Seymour konnte sich nicht enthalten zu schreiben: »Einige Befürworter des organischen Gartenbaus haben recht exzentrische Methoden, wie zum Beispiel den Anbau von Pflanzen in Übereinstimmung mit den Mondphasen oder das Verstreuen winziger Mengen geheimnisvoller Substanzen auf den Boden und so weiter (…) In der Lehre von den organischen Zusammenhängen haben derart unsinnige und abergläubische Vorstellungen keinen Platz. Der organische Gartenbau beruht auf beweisbaren Tatsachen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, und die Durchführung erweist sich als wirkungsvoll und damit als richtig« (Seymour 1978: 96).
Organic Agriculture
Die »organische« Bewegung in den angelsächsischen Ländern geht auf Sir Albert Howard (1873–1948) zurück, der nach jahrelanger Forschung und praktischer Erfahrung seine Werke »An Agricultural Testament« (1941) und »Soil and Health« (1947) herausgab. Zur selben Zeit entwickelte sich die biologische Methode von Lemaire-Boucher in Frankreich. In den frühen Fünfzigerjahren verbreitete sich das Interesse an biologischem, natürlichem Landbau auch in den fortschrittsgläubigen Vereinigten Staaten, wo die unsachgemäße Bodenbearbeitung zu massiver Bodenerosion und Staubstürmen (dust bowls) geführt hatte, wodurch weite Landschaftsteile verwüstet und Milliarden Tonnen Humus verloren gegangen waren.
Kaum einer hat im englischen Sprachraum mehr für die biologische Landwirtschaft getan als Sir Albert Howard. Als junger Mykologe (Pilzforscher) und Dozent für Agrikultur wurde er 1905 Reichsbotaniker der indischen Kolonialregierung. Diese Stelle bis 1924 und ähnliche Aufgaben in Afrika brachten ihn täglich in Berührung mit den Kleinbauern dieser Länder. Dies brachte ihn zur Einsicht, dass der Spezialist, der »Einsiedler« im Labor, weit davon entfernt ist, die vielen biologischen Wechselwirkungen innerhalb der Landwirtschaft richtig zu erkennen. Die Bauern wiesen ihm den Weg zu einer ganzheitlichen Auffassung der Lebenszusammenhänge, der Aufbau- und Abbauprozesse im Boden, in der Pflanzen- und Tierwelt. Dieses »Rad des Lebens« gilt es zu achten. Die Kompostierung ist ein wesentlicher Teil dieses Lebensrades, der Kunstdünger hingegen unterbricht den Kreislauf. Mit diesem Gedanken im Sinn entwickelte er in Indien die Indore-Kompostierungsmethode.
In seinen Arbeiten macht Sir Howard auf die wichtige Rolle der Pilzwurzeln (Mycorrhizae) aufmerksam, die mit den Wurzelhärchen der höheren Pflanze symbiotisch verwachsen sind. Sie versorgen die Pflanze mit Wachstumshormonen, geben ihr Widerstandskraft gegen anderen Pilzbefall und führen ihr Mineralien zu, die sie aus dem Kristallgitter herauslösen. Die grüne Pflanze ihrerseits versorgt die Pilzwurzeln reichlich mit Zucker und anderen Kohlehydraten. Die Mycorrhizae, die in gutem Boden reichlich vorhanden sind, verschwinden, wenn der Boden chemisch behandelt wird.
Ein gesunder Boden ohne Einschaltung von chemischen Substanzen oder Giften ist die Grundlage für das Gedeihen der Pflanzen, Tiere und Menschen. Fruchtbarkeit und Gesundheit resultieren aus sorgfältiger Humuspflege mit Kompostierung aller organischen Abfälle. Ein Beweis dafür war, dass Sir Howards Rinderherde von der Maul- und Klauenseuche verschont blieb, die bei den Kunstdüngerbetrieben der Nachbarn wütete. Er konnte auch zeigen, dass der Schädlingsbefall in erträglichen Grenzen gehalten werden kann, wenn die Kompostierung als Grundlage dient. Er machte die biologische Landwirtschaft auf Charles Darwins letztes großes Werk über die Regenwürmer aufmerksam. Diese Tierchen verdauen als Garanten der Bodenfruchtbarkeit nach Darwins Schätzungen ungefähr 20 Tonnen Erde pro Hektar und Jahr und reichern die verarbeitete Erde mit Nährstoffen an. Kunstdüngersalze vertreiben diese hilfreichen Tiere.8
Das breitere Interesse am Biolandbau währte nur kurze Zeit. Als die Nachkriegswirtschaft in eine expansive Phase geriet, schien die biologische Bewegung geschlagen. Spottbilliges Öl, welches die preisgünstige Kunstdüngerherstellung und einen expansiven Maschineneinsatz ermöglichte, sowie neokolonialistische Handelsstrukturen begünstigten den Sieg der Technokraten. Die Biolandbau-Bewegung wurde als Flause nicht ernst zu nehmender Naturkäuze und Gesundheitsköstler belächelt. Derweil merkte man kaum, dass die Bodenstruktur immer schlechter wurde, dass es ständig mehr chemischer Hilfsmittel bedurfte, um die Erträge auf der Höhe zu halten, und dass Schmetterlinge und Singvögel verschwanden, während Schädlinge nur mit starken Giftbehandlungen in Schach gehalten werden konnten. Wer dachte schon, dass die Zunahme an Zahnkaries, Kreislaufstörungen und Krebs vielleicht etwas mit der so erzeugten Nahrung zu tun haben könnte?
Die blinde Euphorie bezüglich der Ertragssteigerung durch Gift und Chemie hielt an, bis die Biologin Rachel Carson das inzwischen klassische Werk »Der stumme Frühling« (1962) herausgab. Als Stimme der um ihre Kinder besorgten Mutter Erde erhob sie die Klage, so dass sogar Präsident Kennedy aufhorchte und das Wort ecology (Ökologie) zum allgemein geläufigen Modewort avancierte. Als das Buch erschien, fragte ich meinen Entomologie-Professor, der auch als Ratgeber einer Chemiefirma tätig war, wie er das Buch von Rachel Carson beurteile. »Ach, diese hysterische Frau! Wir brauchen das Gift, denn entweder sind wir es oder die Schädlinge, die überleben werden«, gab er zur Antwort.
In den Sechzigerjahren wurden die »Grenzen des Wachstums« zunehmend spürbar. Der materialistische Fortschrittsglaube geriet ins Wanken. Junge Idealisten suchten nach Alternativen, reisten in fremde, »unterentwickelte« Länder und versuchten Auswege zu finden. Die Gedankengänge der so genannten Naturapostel und Reformköstler fanden wieder Gehör. Viele experimentierten mit anderen Bewusstseinsformen, mit Meditationspraktiken und mit Pflanzendrogen. Nicht wenige haben den Gärtner in sich entdeckt, als sie Zauberdrogen suchten und ihr eigenes Marihuana oder Ololiuqui anzubauen begannen. Inzwischen klingen viele dieser Ideen schon gar nicht mehr so verrückt. Fortschreitende Verwüstung der Landschaft, drohende Energieknappheit und die damit verbundene allgemeine Teuerung machen Selbstversorgergärten und Gemeindegärten nach biologischem Prinzip immer beliebter, bis schließlich sogar gutmeinende, aber hinter den avantgardistischen Entwicklungen hinterherhinkende Akademiker und zuletzt die Behörden sich dafür stark machten.
Inzwischen haben viele Bauern und Gärtner umgestellt. Biologische Produkte werden in der Schweiz sogar in den großen Supermarktketten angeboten. Die BSE-Krise hat viele Verbraucher hellhörig gemacht. Dennoch ist nichts entschieden. Technologischer Machbarkeitswahn beherrscht die Großkonzerne, die sich fette Profite auf einem globalisierten Markt versprechen. Mehr als 40000 000 000 US-Dollar werden weltweit pro Jahr mit chemisch-biologischen Produkten für die Landwirtschaft umgesetzt – eine astronomische Ziffer, deren Bedeutung sich der normale Mensch kaum vorstellen kann.9 Ohne dass die Folgen für die Ökologie und die Gesundheit abzuschätzen sind, wird weiterhin mit gezielten Erbgutveränderungen experimentiert. Allein in Deutschland werden 38000 Tonnen Pestizide pro Jahr eingesetzt – das ist auf die Bevölkerung umgerechnet ein Pfund pro Person. Die gesundheitlichen Schäden sind enorm. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation vergiften sich weltweit eine Millionen Menschen an Pflanzenschutzgiften, 20000 von ihnen sterben (Grimm 1999: 199). Auch der Energieverschleiß geht unvermindert weiter. Ein Beispiel: In Südspanien bedecken Plastikfolien hunderttausende Hektar Land. Hier und da ragt ein Kirchturm aus dem Plastikmeer – da weiß man, dass sich dort ein Dorf befindet. Unter den Folien werden meist in künstlichen Nährlösungen genormte Tomaten, Paprikaschoten, Salat, Gurken und andere Gemüse gezüchtet. Tausende von Lkws mit Kühlsystemen fahren auf neu gebauten, mit EU-Geldern finanzierten sechsspurigen Autobahnen Tausende von Kilometern bis in die entferntesten Länder der EU, um die Gemüse in die Supermärkte zu bringen. Zweites Beispiel: Die industriellen Gartenprodukte der Niederlande haben einen dermaßen schlechten Ruf, dass viele Verbraucher sie meiden. Daher werden diese Gewächshauserzeugnisse nach Spanien verfrachtet, dort in andere Kisten umgeladen und – im Einklang mit EU-Recht – als »spanische Erzeugnisse« wieder zurück ins nördliche Europa gebracht.
Organische Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft, Permakultur
Haben wir es da nicht mit den gleichen Begriffen und Praktiken zu tun? Wenn man die Literatur zum biologisch-dynamischen Landbau liest, könnte man meinen, dass es sich, abgesehen von einigen Präparaten aus Heilkräutern, um ein und dieselbe Sache handelt. Überall, wo biologische oder organische Landwirtschaft betrieben wird, hat man es mit einer ganzheitlichen, ökologisch orientierten Praxis zu tun. Dem gesunden Menschenverstand wird gegenüber den Abstraktionen der Labortechniker der Vorzug gegeben. Man arbeitet mit der Natur, nicht gegen sie; man vollzieht natürliche Prozesse nach, denn die Natur ist weiser als wir. Statt Düngersalze nimmt man Kompost, statt chemischer Gifte nimmt man die Mittel, die die Natur selbst anbietet. So bekämpft man Schädlinge mit Marienkäfern, Gottesanbeterinnen, Trichogrammawespen oder spritzt zur biologischen Abwehr mit Knoblauch- und Chilipfefferbrühen. Das Ziel ist, auf der Basis eines gesunden, lebendigen Bodens gesunde Nahrung zu ernten.
Die biologisch-dynamische Landwirtschaft widersetzt sich diesen Zielen nicht, ihr Anliegen ist jedoch viel weiter gefasst. Zur Ganzheit gehören nicht nur die unmittelbaren Gegebenheiten wie der Boden, die Pflanzen, Tiere und Werkzeuge, sondern auch die geologischen Bedingungen, der Längen- und Breitengrad, der Einfluss der Sonne, des Mondes, der Sterne und des Menschen selbst. Nicht nur, wie er den Boden bearbeitet, sondern auch was er dabei fühlt und denkt, ob er ihn liebt oder ob er ihm gleichgültig ist, all das zeigt seine Wirkung. Um sich über die Kräfte und die großen Kreise der Natur (Makrokosmos) und ihren Zusammenhang mit dem Denken, Wollen und Fühlen des Menschen (Mikrokosmos) klar zu werden, braucht es eine Bewusstseinserweiterung über den gewöhnlichen Grad des Bewusstseins hinaus. Diese Bewusstseinserweiterung – Geistesschulung genannt – ist ein Bestandteil der biologisch-dynamischen Methode. Wenn das Bewusstsein entsprechend geschult ist, erkennt man auch, dass die Erde selbst ein lebender Organismus ist. Man wird auf wunderbare, ja magische Zusammenhänge aufmerksam, und man empfindet, wie man karmisch mit diesem Erdorganismus verbunden ist.
Das Gärtnern und Bauern wird dann ein Dienst an der Erde. Was man ihr antut, bestimmt das Karma des eigenen Lebens und der Menschheit mit. Man arbeitet an der Zukunft des Universums. Aus dem richtigen Verhältnis zur Erde und zum Kosmos wird dann, fast nebenbei, eine menschenwürdige Nahrung hergestellt. Biologisch zu gärtnern, um gesunde Nahrung zu haben, ist verfeinerter Materialismus. Die gesunde Nahrung ergibt sich von selbst, wenn der Mensch seine Aufgabe an der Erde erfüllt. Wichtiger als die gesunde Nahrung ist, was man mit der Kraft, die einem die Nahrung spendet, anfängt.
Der Biodynamiker sieht sich als Alchemist, der einer alt werdenden Natur neue Sternenkräfte vermittelt, der nicht nur die Natur walten lässt, sondern sie mit Präparaten und Heilmitteln unterstützt und ihr durch bewusstes Handeln gute Impulse vermittelt. Ein Hauptaxiom des Biodynamikers ist es, die positiven Kräfte zu unterstützen und nicht Energien zu verschwenden, indem man verbissen die vermeintlich negativen Kräfte bekämpft und unterdrückt. Man bekämpft nicht die Schädlinge, von einer Notmaßnahme abgesehen, auch nicht mit »biologischen« Mitteln, sondern man unterstützt die Gesundung der Felder und Gärten durch Humuspflege, Tierschutz, Anlegen von Hecken und Teichen und ähnliche Maßnahmen. Man arbeitet an den Ursachen, die oft so tief verborgen liegen, dass es dem Unwissenden »mystisch« oder seltsam vorkommen mag, wenn er einem bei der Arbeit zusieht. Man schult sich in der genauesten Beobachtung, damit auch jeder Zugriff folgerichtig ist.
Der Begriff Permakultur wurde 1978 als Antwort auf die globale ökologische Krise von den Australiern Bill Morrison und David Holgren geprägt. Morrison hatte einige Zeit seines Lebens mit den australischen Ureinwohnern im Busch verbracht und gesehen, wie diese naturverbundenen Menschen harmonisch mit ihrer Umwelt leben und diese nicht »verbrauchen« oder zerstören, wie es in der Konsumgesellschaft der Fall ist. Ihm schwebt eine Landwirtschaft vor, die nachhaltig ist. Kernpunkte sind Selbstversorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, lokale Märkte für Überschüsse, sparsame und effektive Nutzung der immer knapper werdenden Ressourcen, organische Vernetzung von Natur und Kultur, Ende der Verschwendung fossiler Brennstoffe durch energieaufwendige chemische Düngemittel, Gifte und lange Transportwege. Auch Städte sind in das Konzept mit einbezogen – Sonnenkollektoren und Regenwassersammlung, Gewächshäuser, Kleingetier, Mischkulturen in den Hausgärten.
Vorbild für die Permakultur ist das Ökosystem Wald, insbesondere die Urwaldgärten, wie man sie in Kerala oder Tansania findet. Dort werden Nutzpflanzen, Kräuter und Gemüse, Beerenbüsche und Obstbäume in Nachahmung des Waldes »etagenweise« übereinander angeordnet; Tiere, wie Schweine oder Hühner, helfen durch Scharren und Wühlen bei der Bodenarbeit. Vorbild ist auch der Versuch des Japaners Masanobu Fukuoda, in der Landwirtschaft die natürlichen Bedingungen so genau wie möglich nachzubilden, so dass sich die Nutzpflanzen selbst aussäen, das Pflügen überflüssig wird, die Wildkräuter als Nahrung, Gewürz oder Bodenbedeckung mit einbezogen werden usw. Problematisch beim Konzept der Permakultur ist jedoch, dass viele in den tropischen Ländern erarbeitete Konzepte theoretisch sehr schön sind, sich aber in der Praxis schwer auf unsere klimatischen und ökologischen Gegebenheiten übertragen lassen.
7 Anscheinend war sich Steiner nicht bewusst, dass auch in seinen Visionen viel »atavistisches« beziehungsweise altkeltisches Wissen steckt. Siehe dazu: Storl, Wolf-Dieter: Pflanzen der Kelten, Aarau, AT Verlag 2000.
8 Mit dem Kunstdünger Ammoniumsulfat tötet man absichtlich die Regenwürmer auf den Golfplätzen, damit auf dem kurzgeschorenen Rasen ihre Häufchen den Golfbällen nicht in die Quere kommen.
9 Die beiden wichtigsten Sparten auf dem Agromarkt sind Pflanzenschutz und Saatgut: Im Pflanzenschutzmarkt wurden 1999 rund 28 Milliarden Dollar umgesetzt. Davon entfallen 51% auf Unkrautvertilger, 25% auf Schädlingsvernichter und 20% auf Fungizide. Die Wachstumsrate des Marktes beträgt 1,5% bis 2% pro Jahr (Baumgartner 2000: 115).