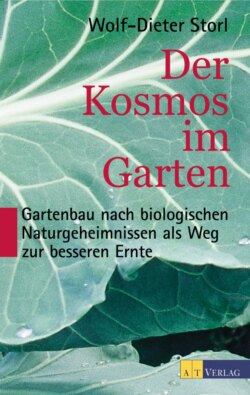Читать книгу Der Kosmos im Garten - Wolf-Dieter Storl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеES WAR EINMAL …
Kürbisblüten im Abfallhaufen.
Anfang des Ackerbaus.
Kühe lassen sich nicht vertreiben.
Anfang der Herden.
Gary Snyder
Die verschütteten Grundrisse der ersten festen Hütten, verkohlte Körner, Tonscherben und Ziegenknochen – diese zaghaften Anfänge des sesshaften Bauern- und Gärtnertums fanden Archäologen im Zagrosgebirge oberhalb des Zwischenstromlandes. Nach neuesten Datierungen muss das Neolithikum vor rund elftausend Jahren begonnen haben. Elftausend Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viele Beobachtungen und Erfahrungen ansammeln können, denen obendrein noch hunderttausendjährige Urerfahrungen naturverbundener Jäger und Sammler zugrunde liegen.
Aus den Stämmen der Wanderfeldbauern und Brandroder gingen allmählich die ersten Zivilisationen hervor. Feudale Standes- oder Kastengesellschaften bildeten sich im alten Asien, in Ägypten und in Mittelamerika auf der Grundlage der von Bauern erzeugten Nahrungsmittel und Rohstoffe. Städtische Handwerker verarbeiteten die Waren weiter, und Händler sorgten für deren Verteilung. Krieger, die die Gesellschaft schützten, und Priester, die den Willen der Götter erkundeten, bildeten die oberen Kasten in einem System erblicher Arbeitsteilung. Von Tempeln, Pyramiden und Zikkurats (babylonischer Stufenturm) aus wurden die Sterne als Schriftzeichen der Götter gedeutet, die lebenswichtigen landwirtschaftlichen Kalender errechnet, Opfer vorgeschrieben und magische, fruchtbarkeitserhaltende Zeremonien ausgeführt.
Im Gegensatz zu den Schamanen der frei lebenden Wildbeuter und den autarken Wanderfeldbauern wurde den Priestern dieser Hochkulturen der direkte Zugang zu den Geistern und Göttern, der Seelenflug, immer mehr verschlossen. Die Hierophanten, die Oberpriester, machten sich daran, das überlieferte Wissen über die Götter und Kräfte der Welt zu großen Lehrgebäuden aufzubauen, deren Inhalte mit der Zeit in die religiösen und naturkundlichen Vorstellungen der Bauern eingingen und zum Teil bis in die Neuzeit erhalten blieben. Anderer seits aber blieben beim einfachen Landvolk viele schamanistische Eigenschaften erhalten, und das Wissen darüber wurde mündlich von einer Generation zur anderen weitergegeben.
Eine ähnliche Entwicklung setzte später bei den Stämmen nördlich der Alpen ein. Zuerst betrieben sie Wanderfeldbau. Landes- und Ortsnamen wie Schweden, Schweiz, Schwanden, Rüti, Rode usw. gehen auf die Praktik des Brandrodens (Schwendens) zurück. Mit der Bevölkerungsvermehrung und dem Zusammenwachsen mit römischen Kulturelementen zur Zeit Karls des Großen nahm die europäische Bauernkultur ihre charakteristischen Züge an. Es regierte der Waffen tragende Adel, und die römische Kirche besaß das weltanschauliche Monopol. Die Bauern lebten in eingefriedeten Dörfern (Markgenossenschaften), umgeben von drei großen Feldern (Zelgen), wo jede Familie je nach der Größe der Familie einen Ackerstreifen (Gewann) bearbeiten durfte. Ein vorgeschriebener Fruchtwechsel fand statt, indem in einem Feld das Wintergetreide (Korn, Roggen) und in einem anderen das Sommergetreide (Gerste, Hafer oder auch Bohnen) gesät wurde. Die dritte Zelge lag brach und wurde als Weide benutzt, bis dann im Juni (Brachmonat) gepflügt wurde, damit im Herbst die neue Wintersaat eingesät werden konnte. In dieser Dreifelderwirtschaft mussten alle zur selben Zeit ihren Streifen im Zelg bearbeiten, denn es gab keine Wege zwischen den Gewannen. Man konnte daher nicht zu jeder beliebigen Zeit auf sein Feld fahren, ohne des Nachbarn Getreide zu zertrampeln. Die gemeinsame Arbeit führte zu gemeinsamen Jahresfesten und erzeugte ein festgefügtes Gesellschaftsleben.
Das Vieh wurde vom Dorfhirten auf die gemeinsame Weide (Allmende) geführt. Der Schweinehirt trieb die Schweine des Dorfes im Herbst in den Eichenwald, und Kinder hüteten die Gänse. Im Gemeindewald konnte jeder Holz, Pilze und Kräuter suchen und seine Schweine mit Eicheln, Bucheckern oder Kastanien mästen. Die Jagd war jedoch den Rittern vorbehalten. Im Dorf gab es Gärten (Pünten) als Privateigentum, in denen die Frauen Küchengemüse, Hanf, Flachs und Ölpflanzen anbauen konnten. Im Dorf waren auch die Baumgärten angelegt, in denen die Hühner Auslauf hatten und die Bienenstöcke standen. Diese Gärten waren von der genossenschaftlichen Flurnutzung ausgenommen und bildeten einen Arbeitsbereich der Frauen.
Das Leben der Bauern, wie das der naturverbundenen Völker überhaupt, stand nicht in einem weltanschaulichen Leerraum, sondern wurde durch halb christliche, halb heidnische Rituale und zeremonielle Verrichtungen untermauert. Durch die jahreszeitlich bedingten Feste – Maibaumsetzen, Johannisfeuer, Erntekranz, Flurprozession und Winterorakel – wurde das Leben geleitet. In Sprichwörtern, Bildern, heiligen Statuen, Balladen, Tänzen und Märchen machte man sich die tradierten Weisheiten und kollektiven Erfahrungen anschaulich. Die Ältesten, die den größten Erfahrungsschatz hatten und ungewöhnliche Erscheinungen zu deuten vermochten, waren die Kulturträger. Für jede Sachlage kannten sie ein Sprichwort, eine Regel oder ein Lied. Auch wussten sie Rätsel aufzugeben, die die Sinne und Gedanken schärften.
Das naturverbundene, bäuerliche Bewusstsein
Schwere körperliche Arbeit mit den Tieren und der Erdscholle verankern das Bewusstsein tief in den Leib hinein. Es handelt sich vorerst um eine nur dumpf bewusste Erfahrung in den Muskeln, im Rücken, in keuchenden Lungen, im Puls- und Herzschlag, ehe es zu einer erkenntnismäßigen Bewusstwerdung im Kopf kommt. Die Glieder sind von Kindheit an in rhythmischer Bewegung – beim Hacken, Melken, Heuen, Säen und anderen Arbeiten. Sie stehen unmittelbar mit dem Makrokosmos, mit der äußeren Natur, mit Erde, Steinen, Lebewesen, Wetter, Tages- und Nachtrhythmen und dem Jahreskreislauf in Verbindung. Dadurch entwickelt sich ein ganz anderes Bewusstsein, als wir es in unserer intellektualistischen bürgerlichen Zivilisation erleben. Kühe und Hühner sind unter demselben Dach, keine elektrische Geräuschkulisse oder Luftkühlung wehrt die Elemente ab, und nichts Geschriebenes erklärt und vermittelt das Erlebte. Wie viel stärker müssen damals die Natureindrücke gewesen sein!
Durch die eintönigen, rhythmischen Arbeiten wird das kombinierende, diskursive Kopfdenken – nicht anders als bei dem eintönigen Trommeln, Tanzen und Singen des Schamanen – zurückgedrängt. Da denkt man nicht mehr, sondern erlebt Bilder, die in ihren unzähligen Verwandlungen der Natur zugrunde liegen. Da steigt die Innenseite der Welt vor dem geistigen Auge auf, die Trennung zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Natürlich und Übernatürlich verschwimmt.3 Man erlebte damals die durch das kulturelle Erbe vermittelte mythische Ausgestaltung der Naturkräfte unmittelbar. Man erlebte die Riesen, Zwerge, Nixen, Hausgeister, Waldfrauen, Kobolde oder Frau Holle. Die Mittagsfrau erschien den müden Schnittern in der Mittagspause bei der Ernte, oder ein Mädchen wurde ins Moor geschickt, um die Regentrude zu wecken, wenn eine Dürre herrschte.
Solchen in der Natur waltenden Wesen begegnete man mit Besprechungen und Zauberworten, oder man hielt sie mit kraftgeladenen Gegenständen, mit Knoblauch, Zwiebeln oder Brennnesseln, mit dem Kruzifix oder der Hostie, die man aus der Kirche gestohlen hatte, fern. Man sah, wie die Wesen wandeln und sich verwandeln konnten, wie sie zu erscheinen und zu verschwinden vermochten, wie alle Dinge unter bestimmten Umständen von Zauber erfüllt sein und manchmal sogar reden konnten.
Alles ist wandelbar! Verwandelt die Kuh nicht Gras zu Milch, das Feuer Wasser zu Dampf, ein nasses Jahr die Gerste zu Lorch und den Roggen zu Trespe? Wenn die schöne Nachtigall aufhört zu schlagen, verwandelt sie sich nicht in einen einfachen Sperling? Entstehen nicht Würmer und Geschmeiß im Kuhdung? Können Hexen nicht mit Wölfen und Raben, ja sogar mit Bäumen und Steinen reden, wenn sie die richtigen Beschwörungen wissen, in der Form von Krähen durch die Lüfte fliegen oder in der Gestalt einer schwarzen Katze durch die Nacht streichen? Gibt es nicht kraftgeladene Wesen wie die Kreuzspinne, die das Kreuz des Heilands als Zeichen tragen, und den Marienkäfer, der von der heiligen Jungfrau gesandt wird? Mit all diesem muss man umgehen können. Für die Baumgeister lässt man als Opfergabe die letzten Kirschen oder Äpfel hängen, einige Beeren und Pilze lässt man den Waldgeistern übrig, eine Schüssel Milch und Brei den Hausgeistern, den Toten pflanzt man Blumen auf das Grab. Böse Geister vertreibt man mit frommen Gesängen, mit Blumen oder mit dem Kreuz. Man sperrt den Ziegenbock in den Pferdestall, damit der Teufel in diesen fahre und nicht in die Rosse.
Da alles lebt und alles in Sympathie miteinander verbunden ist, kann man die Saat durch Enthaltsamkeit oder rauschende Lustbarkeit beeinflussen. Wenn die Weiber ihren Flachs säen, sollen sie Röcke so blau wie die Flachsblüten tragen und in die Höhe springen, damit der Flachs recht hoch wachse. Ihre Schürzen sollen sie beim Kohlpflanzen zwischen den Beinen ballen, damit die Kohlköpfe recht fest werden, und Zwiebeln im Zorn stecken, damit sie scharf und hitzig werden.
Die alten Weißhaarigen im Dorf wussten viel über diese Zusammenhänge, mehr noch als die Pfaffen. Noch mehr wussten die alten Weiber, die Kräuter sammelnd Wälder und Felder durchstreiften. Als Hebammen wussten sie, wie man die neuen Menschen über die Schwelle bringt, und auch, wie man die Kranken heilt, die an dieser Schwelle liegen. Am meisten wussten aber die Hirten, die lange Zeit in der Wildnis hausten, über diese magischen Zusammenhänge. Bis in die Neuzeit waren Schäfer die bevorzugten Tierärzte der Bauern, denn sie konnten »in die Tiefen steigen«, mit den Tieren reden und erkennen, welcher Geist oder welcher Zauber das Tier siech machte.
Dieses aus der Urzeit übermittelte Wissen blieb auch im volkstümlichen Christentum erhalten. Vieles wurde zwar als Aberglaube gebrandmarkt, aber ansonsten kümmerten sich die Pfaffen nicht um die so genannte niedere Mythologie. Es galt hauptsächlich, den Menschen klar zu machen, dass über den zu Teufeln degradierten oder zu Engeln verwandelten alten Göttern Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch waltet. Erst lange nach der Reformation, im Zeitalter der Hexenverfolgungen und dann in der Periode der Aufklärung, versuchte man, mit Gnomen, Hexen, Sylphen und anderen Geschöpfen der niederen Mythologie aufzuräumen.
Noch lange wurden die einzelnen Tage im Jahreslauf mit den Namen von Heiligen belegt. So waren die Tage nicht nur abstrakte Ziffern auf dem Kalenderblatt, sondern erhielten die ganz besonderen Eigenschaften des jeweiligen Heiligen. So gehörte es zum Wesen des Pankratius, Servatius und Bonifazius (12., 13. und 14. Mai), kaltes Wetter mit sich zu bringen; sie wurden deshalb die »Eisheiligen« genannt. Die besondere Eigenart der einzelnen Tagesheiligen wurde von den analphabetischen Bauern mündlich in gereimten Regeln weitergegeben. Da heißt es zum Beispiel (Hauser 1973):
»Vinzent Sonnenschein [22. Januar]
bringt Korn und Wein.«
»Georg [23. April] und Marx [25. April]
bringen oft viel Args.«
»Regnets am St.-Peters-Tag [29. Juni]
drohen dreißig Regentag.«
Petrus ist schließlich der Wetterherr, der die Stelle des heidnischen Donnergottes einnahm. Die heilige Barbara (4. Dezember) konnte dem hoffnungsvollen Jungfräulein zeigen, ob sie im nächsten Jahr heiraten werde. Daran, ob die Kirschzweige, die sie am Barbaratag in einer Vase in die warme Stube stellt, blühen oder nicht, kann sie die begehrte Antwort ablesen. Mit dem Heiligen, an dessen Namenstag man geboren war, hatte man ein besonderes Verhältnis und trug auch oft dessen Namen, ein Brauch, der bei den lateinamerikanischen Campesinos noch heute lebendig ist.
Die Heiligen waren auch die Schutzpatrone aller Gewerbe und Tätigkeiten. So war der heilige Georg Beschützer des ackernden Bauern und Gambrinus der Heilige der Bierbrauerkunst. Der heilige Fiaker, dessen Tag auf den 30. August fällt, ist der Beschützer des Gemüsebaus. Er wird mit einem Spaten und einem aufgeschlagenen Buch dargestellt. Sein Name ist übrigens als Synonym für Droschke in die Sprache eingegangen, weil die Pariser Lohnkutschen beim Hotel St-Fiacre standen. Aber auch von dort aus wirkte der Heilige segnend auf den Gemüsebau, denn der Pferdemist dieser Droschken wurde die Grundlage der Düngung in den berühmten Pariser Marktgärten.
Der heilige Fiacre.
Wie die anderen übersinnlichen Wesen konnten diese Tagesregenten angesprochen werden; man konnte ihnen Blumen und Kerzen opfern oder sie im Zustand der Verzückung »sehen«. Wenn diese nichts auszurichten vermochten, konnte der mittelalterliche Mensch immer noch heimlich zur Frau Holle gehen oder die älteren Naturgeister zu Hilfe rufen. Man brauchte nur dreimal an Holz zu klopfen und ihren Namen zu rufen, dann kamen sie. Die Beziehung der Landbevölkerung zu den Heiligen gleicht der Verehrung der Ahnen und Vorfahren bei den afrikanischen Pflanzern oder den chinesischen Gartenbauern.
Klostergärten
Natürlich gab es im Mittelalter nichts, was sich mit der modernen wissenschaftlichen Forschung vergleichen lässt. Was man am ehesten als Forschung auffassen könnte, war die Tätigkeit der Mönche, besonders der Zisterzienser und Benediktiner, die überall Klostergärten und Klosterhöfe anlegten. Grobgemüse, Bohnen, Erbsen und Rüben kamen nicht in die Gärten, sondern wurden feldmäßig angebaut. Die feineren Gemüse kamen in den von einer Mauer umgebenen Hortus.
Im berühmten karolingischen Klostergarten von St. Gallen tritt uns wieder die anthropomorphe Gartengestaltung vor Augen: Der Hortus ist durch ein Wegkreuz in zwei Hälften geteilt. Nach beiden Seiten laufen zehn fest angelegte Wege, die wie die zehn Rippenpaare zwischen den Beeten liegen. Am Ende ist ein Herbularius, der als Gewürz- und Kräutergarten eine wichtige Rolle in der mittelalterlichen Arzneiversorgung spielte. In manchen Klöstern findet man noch einen Meditationsgarten mit Kreuzgang, in dem die der Jungfrau Maria geweihten Pflanzen, Veilchen, Margeriten, Majoran und Rosmarin, neben weißen Lilien, die die Reinheit darstellen, und roten Rosen, die das Martyrium symbolisieren, wachsen. Im Hortus gedeihen Zwiebeln, Lauch, Gurken, Salat, Pastinaken, Mohn, Kerbel, Kümmel und andere uns bekannte Arten. Daneben sprießen die seither verwilderten Pflanzen, die man heute zu den Unkräutern zählt, wie Bürzelkraut (Portulaca oleracea), Gemüsesenf, Malve oder Käsepappel und die Melde. Auch Pflanzen zum Färben und zur Textilbereitung wie Karde (Dipsacus sativa), Schafgarbe und Färberwaid (Isatis tinctoria) wurden hier gepflegt. Zu neuen Einsichten gelangte man durch Meditation, Kontemplation und die Autorität der alten Manuskripte anstatt durch kontrollierte Experimente. Die Erfahrungen der alten Griechen und Römer blieben uns durch das fleißige Kopieren der landwirtschaftlichen Manuskripte des Plinius, Cato, Theophrastus und Vergilius erhalten. Diese Kenntnisse wurden teilweise in den Schatz der Bauernregeln und Sprichwörter des einfachen Volkes mit aufgenommen und durch eigene Beobachtungen ergänzt.
Renaissance
Im 12. und 13. Jahrhundert gelangten viele alte griechische Texte, darunter astrologische, meteorologische und landwirtschaftliche Abhandlungen, die die Araber aufbewahrt hatten, in den Westen. Ein neues Interesse an Gartengestaltung, seltenen Pflanzenarten und Kräuterkunde erwachte. Mit dem neuen Zugang zur Antike drängten die mythologischen Gestalten, die Götter und Heroen, erneut in das Bewusstsein der abendländischen Völker. Die neuplatonische Philosophie hob die sieben Planetengötter, mit oder ohne christliche Übertünchung versehen, in den Bereich des seriösen, wissenschaftlichen Gesprächs. Dazu kam die Astrologie, die sich erneut mit den Tierkreiszeichen, mit dem Meganthropus und dem Wirken der Götter im Kosmos und auf der Erde befasste. Es handelte sich um eine Wissenschaft, die hauptsächlich Qualitäten zu ermitteln suchte, nicht Quantitäten wie unsere moderne Wissenschaft. Die kosmologischen Bilder, die uns hier entgegentreten, sind Ausdruck qualitativer Verhältnisse. Viele dieser Qualitäten sind heute noch bedingt gültig und haben ihre Zufluchtsstätte in den Gärtnerweisheiten und Bauernregeln gefunden.
Die sieben Bereiche der antiken Götter, die auch vage mit den Sphären der Engel und Erzengel identifiziert wurden, sind nicht nur in den Wandelsternen zu suchen, sondern hauptsächlich hier auf Erden. Ihr Einfluss ist durch die Signaturen (lat. signatura = Siegelzeichen), die sie allen Geschöpfen aufprägen, zu erkennen. Jedes Metall, jeder Stein, jede Blume, jedes Tier, jeder Tag, die Landschaft wie auch jede seelische und moralische Eigenschaft in Mensch und Natur tragen diese planetarischen Siegeleindrücke. Man versuchte die Welt nach diesen sieben Mustern einzuteilen.
Wenn Arthur Hermes die roten Nacktschnecken mit einer Brühe aus gekochten frischen Rottannenzweigen (Picea abies) aus seinem Garten vertrieb, bewegte er sich ganz in der Tradition der Renaissance-Philosophen. Die weichen, schleimigen Schnecken gehören dem wässrigen Mond an, aber ihre rötliche Farbe und ihre gierige Fresslust verrät, dass auch der aggressive Mars in ihnen ist. Dem nassen, kalten Mond setzt man nach dem Prinzip »contraria contrariis« den trockenen, warmen Saturn entgegen, indem man aus Zapfen und Zweigen der Fichte, welche die Signatur des Saturns trägt, eine duftende Brühe bereitet, die man mit der Gießkanne um den Garten herumgießt. Wenn die Mondtierchen in diese Saturnzone kommen, kehren sie eiligst um, denn sie fürchten, in einen trockenen, warmen Tannenwald zu kommen. Am Samstag, dem Tag des Saturns, ausgeführt, steigert sich diese Wirkung noch. Arthur Hermes legte im Winter auch Fichtenzweige auf die Gartenbeete, damit die »für die äußeren Sinne nicht spürbare« Saturnwärme die Knollen und Stauden schützt.
Man kann die Schnecken aber auch nach dem Prinzip »similia similibus« mit dem Mond selbst bekämpfen, indem man sie mit Bier, das man in Konservendosen in den Boden setzt, anlockt, in der Hoffnung, dass sie hineinfallen und ertrinken. Bier ist aus Gerste gemacht, die das Siegel Jupiters trägt, ist aber durch den Vergärungsprozess ganz »Mond« geworden.
Ein Gärtner oder Bauer arbeitet mit dem Signaturdenken, wenn er einen sandigen Boden (der Mars, Jupiter und Saturn angehört), auf dem natürlicherweise als dominante Vegetation Wacholder (Jupiter), Heidelbeeren (Saturn) und Tannen (Saturn) wachsen, mit Kalk (Mond) und Kuhmist (hauptsächlich Mond) düngt. Er gleicht dadurch die obersonnigen mit den untersonnigen Planeten aus.
Auf die Signaturenlehre kommen wir später zurück; wir wollen erst einen kurzen Überblick über die »ländliche« Wissenschaft geben.
Bauernregeln
Der Tierkreis ist ein Ring von Fixsternen, an denen die Planeten, die Sonne und der Mond in ihrem vorgegebenen Lauf vorbeiziehen. Dieser Ring wurde schon seit babylonischen Zeiten in zwölf Regionen unterteilt, die jeweils einer Körperstelle des Menschen entsprachen. Es handelt sich hier wiederum um den großen kosmischen Menschen, den Meganthropus, dessen Abbild der Mikrokosmos, der kleine Mensch auf Erden, ist. Vom Tierkreiszeichen des Widders empfand man herunterströmende Kopfkräfte, vom Stier Halskräfte, von den Zwillingen Schulter- und Armkräfte und so weiter durch den ganzen Tierkreis, bis man zum Zeichen der Fische kam, von dem die Fußkräfte des Meganthropus herunterstrahlten.
Durch den Tierkreis wirken die Urbilder auf die Erde herab. Die Kräfte der Urbilder werden aber verändert, verstärkt oder geschwächt, wenn sich ein Planet in einem der Zeichen befindet. Man kann sagen, dass ein Mars, der vom Skorpion her leuchtet, weniger Gutes verheißt, als wenn er von der Jungfrau her leuchtet. Eine Sonne im Löwen (August) ist eine heißere, stärkere Sonne, als wenn sie matt aus der Richtung des Steinbocks oder Wassermanns (Februar) her scheint. Ein Vollmond im Stier hat eine andere Qualität als einer in den Fischen. Für den Landmann waren diese Qualitätsunterschiede wichtig genug, dafür etliche Regeln mündlich zu überliefern.
Meganthropus. Augsburger Holzschnitt: Versehung des Leibes, 1491.
Karotten (Möhren) sollen nicht im Krebs gesät werden, heißt es da, sonst treiben sie zu viele kleine Würzelchen. Zwiebeln, im Steinbock gesetzt, werden fest wie Stein, im Wassermann aber faulen sie. Die bayerischen Bauersfrauen säten Hanf und Flachs in den Zeichen des haarigen Widders und des Löwen. Bei den Hillbillies im Appalachengebirge ist es noch immer Brauch, das Gemüse, das zum Einmachen bestimmt ist, nicht im Zeichen des Skorpions oder der Fische zu pflanzen, denn sonst würden die Konserven sehr unangenehm riechen.
Viele Regeln bezogen sich auf die Mondphasen, die mit dem Wachsen und Vergehen, Aufbauen und Faulen zu tun haben. Man soll Hecken, Reben und die Klauen der Tiere im abnehmenden Mond schneiden, Gemüse mit oberirdischen Teilen im zunehmenden Mond pflanzen und Wurzelgemüse im abnehmenden Mond säen. Bohnen setzt man bei Neumond.
Weitere Regeln bezogen sich weniger auf kosmologische Zeichen als auf Naturbeobachtungen, mit denen man die nähere Zukunft deuten konnte:
»Bienenschwarm im Mai
ist wert ein Fuder Heu.
Aber ein Schwarm im Juli,
der lohnt sich kaum der Müh.«
»Gibt’s der Eichenblüten viel,
füllt sich auch des Kornes Stiel.«
»Sonnt der Dachs in der Lichtmesswoche [2. Februar],
geht er vier Wochen wieder zu Loche.«
Vier Wochen bedeutet hier nicht unbedingt vier Kalenderwochen, sondern eine recht lange Zeit, in der das Wetter noch winterlich ist.
»Regnet es Johanni sehr [24. Juni],
sind die Haselnüsse leer.«
Andere Regeln geben dem Landmann Anleitung, worauf er zu achten hat, um sein Werk zum günstigsten Zeitpunkt zu verrichten:
»Frühe Saat hat nie gelogen,
allzuspät hat oft betrogen.«
Das gilt vor allem für das Getreide, weniger für den Garten.
»Zur Gartenarbeit lass dir raten
wenn die Erde sich löst vom Spaten.«
Solange der Boden gefroren oder zu nass ist, so dass die Erde an den Geräten klebt, soll man nicht auf die Beete.
»Benedikt [21. März]
macht Zwiebeln dick.«
»Gertrud [17. März]
säe das Chrut.«
Andere Regeln sind wiederum einfach Bauernhumor:
»Fällt der Regen auf den Roggen,
bleibt der Weizen auch nicht trocken.«
Jeder, der längere Zeit mit einem naturverbundenen Landvolk zusammengelebt hat, wird diese Regeln und Sprichwörter, die jeder Begebenheit und Angelegenheit einen Inhalt geben, gehört haben. Dazu kommen die Rätsel, deren Lösung ein anstrengendes Denken in Analogien, Gleichnissen und Signaturen erfordert. An manchem kaltem Winterabend, wenn ich bei Arthur Hermes zu Besuch war, unterhielten wir uns, indem wir einander uralte Rätsel aufgaben. Oft dauerte es mehrere Tage, bis einem die treffende Antwort einfiel:
»Aus dem Igel, eins, zwei, drei,
schlüpft das braune, runde Ei.«4
»Schdeht ebbis am Rai
hat nummä ei Bäi,
hets Härz im Kopf.«5
»Vorn lebendig,
Mitten tot,
Hinten mags gern Käs und Brot.«6
Diese bunte Volkswissenschaft wurde nach der Erfindung der Buchdruckerkunst von Wissenden wie Paracelsus, Agrippa und Trithemius mit neuplatonischem und kabbalistischem Gedankengut kombiniert und systematisiert und führte zu einer großen Anzahl von Zauberbüchern, Kräuterbüchern und Kalendern, die ihrerseits wiederum die Volkswissenschaft befruchteten.
Die Kalender
Sonnen- und Mondstellung, das Blühen und Reifen der Vegetation und das Verhalten der Tiere, etwa die Wiederkehr der Singvögel, war der sichtbare, lebendige Kalender des Landvolkes. Die Rhythmen des Säens und Erntens standen im Einklang damit. Der aufgeschriebene Kalender war Angelegenheit der Pfaffen und Gelehrten. Erst nach der Reformation, als immer mehr Leute lesen und schreiben konnten, wurden gedruckte Kalender bei den Bauern beliebt. Sie enthielten Bauernregeln, gaben astronomische Daten an, erteilten Ratschläge und nannten auch die Tage der Heiligen. Großes Ansehen genoss der »Hundertjährige Kalender« (1702), der aufgrund einer siebenjährigen Periodizität der Planeten das Wetter für ein Jahrhundert voraussagte. Da einige Planeten heiße, andere kalte, einige feuchte, andere wiederum trockene Eigenschaften haben, meinte der Zisterzienserabt Mauritius Knauer (1612–1664), man könne errechnen, wie das Wetter wird, wenn man weiß, welcher Planet in welchem Jahr herrscht.
Die Kosmologie, auf der diese Kalender und das Bauernwissen aufbauten, verfiel immer mehr. Das allmähliche Fortschreiten des Frühlingspunktes und das damit verbundene Auseinandergehen der Erfahrungen mit den Regeln sowie die Kalenderreform von Papst Gregor XIII. im 16. Jahrhundert, durch die der Kalender um elf Tage verschoben und der bäuerliche Jahresbeginn vom 25. März (Maria Verkündigung) auf den 1. Januar verlegt wurde, brachte viel Verwirrung um die Regeln. Die Qualitäten der Heiligen wurden immer weniger glaubwürdig, und dies nicht nur bei den Protestanten. Die Kalender enthielten Regeln, die nicht überall und in jedem Ökotop anwendbar waren. Das war besonders der Fall bei den Einwanderern in Amerika, wo ganz andere ökologische Bedingungen herrschten, die den Kalender und die damit verbundene Weltanschauung ungültig machten.
Der Strukturwandel auf dem Lande, der Wandel von der selbstversorgenden Naturalienwirtschaft zur Geldwirtschaft und die damit verbundene weltanschauliche Veränderung, die ihren Höhepunkt in der Aufklärung fand, ließ die alte Bauernwissenschaft zum Aberglauben werden. Man schüttete das Kind mit dem Bade aus und wandte sich der materialistischen, naturwissenschaftlichen Denkweise zu. Nur einige Hinterwäldler und Kräuterseppen hielten an ihren alten Anschauungen fest. In der DDR, wo die industrialisierte, produktionsgenossenschaftliche Landwirtschaft allein maßgebend war, traf ich zum Beispiel Bäuerinnen, die noch am Karfreitag Osterwasser schöpften und sich jedes Jahr einen astrologischen Bauernkalender aus dem Westen herüberschmuggeln ließen.
Der biologisch-hermetische Gartenbau hat also tiefe Wurzeln, die jahrtausendeweit bis zu den Urerfahrungen der Schamanen und dem Weisheitsgut alter Kulturen zurückreichen. Verborgenes Gold liegt da unter dem Schutt des Aberglaubens, verachtet von der aufgeklärten, skeptischen Wissenschaft. Wir werden sehen, ob wir dieses Gold nicht durch die Scheidekunst der Alchemie läutern können, um dann die kränkelnde Landwirtschaft unserer Tage damit zu tingieren.
3 Der russische Sozialgeschichtler Gurjewitsch schreibt in seinem klassischen Werk, Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen: »Die Bauern (…) bauten ihre Beziehungen zur Natur nicht nach dem Typ der Subjekt-Objekt-Beziehung auf, sondern gingen von der Überzeugung aus, dass Natur und Mensch organisch verwandt und magisch gleichermaßen beteiligt sind, dass sie eine intime Einheit bilden und sich wechselseitig durchdringen.« (Gurjewitsch 1978: 379.)
4 Kastanie in der Schale.
5 »Steht etwas am Rain, hat nur zwei Bein’, hat’s Herz im Kopf.«: Der Krautkopf.
6 Ochse, Pflug und Bauer.