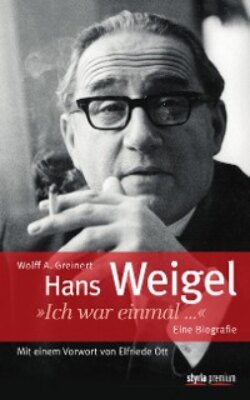Читать книгу Hans Weigel - Wolff A. Greinert - Страница 10
Lehrjahre in Hamburg, Berlin, Paris und Wien
Оглавление„Mein Vater wünschte sich für mich einen kaufmännischen Beruf; er war bereit, mich studieren zu lassen, was ich wollte.“1 Außerdem sollte der Maturant Hans Weigel die Welt kennenlernen. Da sein Vater alles Britische verehrte, sollte er zunächst die Londoner School of Economics besuchen. Diese und andere Handelshochschulen sagten ihm jedoch nicht sonderlich zu. „So kam die undezidierte Entscheidung zustande: Jus-Studium, das kann man immer brauchen, und zwar in Hamburg, wo eine kaufmännische Atmosphäre herrschte.“2
Mit gutbürgerlichem Taschengeld wohnte Hans Weigel in seinem ersten Semester von September 1926 bis zum Frühjahr 1927 bei zwei alten, für Thomas Mann schwärmenden Damen in einem möblierten Zimmer in Harvestehude, Isestraße 51. Er belegte alle Rechtsfächer, die für die Erstsemestrigen vorgesehen waren, aber auch Philosophie und Psychologie. Darüber hinaus besuchte er Musikvorlesungen und einige über russische Literatur, hatte zum letzten Mal Flötenunterricht, besuchte Symphoniekonzerte und die Oper. Großen Eindruck hinterließ eine Orpheus-Aufführung von Jacques Offenbach im Thalia Theater mit singenden Schauspielern wie Gustaf Gründgens und Viktor de Kowa als Hans Stix.
Auch begann Weigel in Hamburg zu schreiben, „nur so für mich und gar nicht begabt“.3 In Das Land der Deutschen mit der Seele suchend war er 1978 der Ansicht: „Hätte es damals den Hans Weigel gegeben und ich hätte ihm Arbeitsproben geschickt, er hätte mich nicht zum Weiterschreiben animiert.“ Ebendort hielt er fest, dass ihm immer, wenn er später nach Hamburg kam, wegen der Erinnerungen an 1926 „das Herz aufging“, er seinen Glauben an Deutschland wiedergefunden habe, da es dort nicht nur nach See, sondern vor allem „nach Demokratie duftet“.4
Am Ende dieses ersten und einzigen ernst genommenen Wintersemesters 1926/27 reiste Weigel – seiner Erinnerung nach im Februar 1927 – nach Berlin, um in einem Verlag eine Stelle zu finden, die Literatur und kaufmännischen Beruf verband. Nachdem er bei S. Fischer und anderen „freundlich unverbindlich abgefertigt“ worden war, fand er ab April 1927 eine Anstellung für 28 Mark im Monat als Lehrling bei Die literarische Welt, einer von Ernst Rowohlt und Willy Haas 1925 gegründeten Wochenzeitschrift, dem Unabhängigen Organ für das deutsche Schrifttum, die sich zum Zeitpunkt seiner Vorsprache gerade als selbstständige GmbH von Rowohlt gelöst hatte und daher für zusätzliche Mitarbeiter offen war.
Weigel wohnte in einer Pension am Nürnberger Platz und war überwältigt von dem, was er in Berlin vorfand: Er sah Werner Krauß, wie er sich zu erinnern glaubte, in Fritz von Unruhs Bonaparte in der Regie von Gustav Hartung mit Dagny Servaes als Joséphine sowie den ein Jahr zuvor, am 14. Dezember 1925, unter Erich Kleiber an der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführten Wozzeck von Alban Berg. Weigel fühlte sich wohl in dieser Stadt, „von der man sofort adoptiert wurde“.5 Doch nicht allein Theater, Opern und Konzerte ließen ihn in Berlin seine „Menschwerdung“ widerfahren, sondern auch die Tatsache, dass diese Hauptstadt der Künste Begabungen und Genies anzog: Musiker, Schauspieler, Regisseure, Sänger und Schriftsteller wie Arnold Schönberg, Franz Schreker, Max Reinhardt, Robert Musil, Alfred Polgar, Erich Kästner, Bert Brecht … Weigel gefiel, „dass in Berlin auf den Strassen spät abends ein so dichter Verkehr wimmelte wie in Wien am späten Nachmittag. Berlin war hell, Berlin war schnell, Berlin hatte einen höheren Blutdruck und einen besseren Tonus, Berlin war, und das gehört zu seiner Attraktivität, von Berlinern bewohnt“.6 Ähnliches sollte er 21 Jahre später an seinem ersten Abend in New York feststellen.
In diesen Monaten war er begierig darauf, Theater und Musik zu konsumieren, und kam bei all den Berliner Größen der damaligen Zeit voll auf seine Kosten: bei Erwin Piscator am Nollendorfplatz, im Staatlichen Schauspielhaus, bei Fritz Kortner als Oscar in Gespenster, Werner Krauß in Peer Gynt von Henrik Ibsen mit Frida Richard als Aase in Bertold Viertels Inszenierung, im Schillertheater mit Frank Wedekinds Musik mit Maria Koppenhöfer, den beiden Opernhäusern, den Konzerten unter Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Erich Kleiber und Otto Klemperer … Doch war er auch als „reiner Konsument“ schon kritisch, zählte die eine oder andere Piscator-Inszenierung zu den dummen, Fritzi Massary sah er als überschätzte Diva an. Er sah schreckliche Klassikeraufführungen wie Heinrich VI. mit Eugen Klöpfer, Paul Wegener und Ernst Deutsch, ebenso langweilig zelebrierten Naturalismus wie die von Karlheinz Martin „fad“ inszenierte Rosa Bernd mit Käthe Dorsch … Dagegen aber standen: Werner Krauß, Grete Mosheim, Carola Neher, Curt Bois, Oskar Homolka, Fritz Kortner, Maria Koppenhöfer, Paul Bildt, Aribert Wäscher, Walter Franck, Rosa Valetti, der schon erwähnte Wozzeck von Alban Berg, die 3. Sinfonie von Gustav Mahler unter Erich Kleiber, die Sinfonietta von Leoš Janáček im Beisein des Komponisten, Troilus und Cressida, inszeniert von Heinz Hilpert etc. All die Kammerrevuen am Kurfürstendamm gingen ihm so nahe wie zuvor der Hamburger Orpheus und bildeten den Nährboden für Weigels Tätigkeiten in der Wiener Kleinkunst wenige Jahre später.
Er schrieb weiterhin, „doch es blieb quantitativ und qualitativ unbedeutend. Unbegabt.“7 Eine kleine Blödelei und Aphorismen erschienen in den Lustigen Blättern und im Tagebuch, doch fehlte ihm die Ermutigung weiterzuschreiben. Dies sollte noch einige Jahre andauern, weshalb er über sich selbst bis zum Beginn seiner Tätigkeit in der Wiener Kleinkunst – als 24-Jähriger – in seiner Autobiografie bekannte: „Ich betrieb allerlei Brotloses und sehnte mich sehr danach, dass jemand mir sagen möge, was ich eigentlich tun sollte. Wenn ich je etwas werde, nahm ich mir vor, würde ich begabten jungen Leuten so helfen, wie ich mir damals gewünscht habe, dass mir geholfen werde.“8 Diesen Vorsatz sollte er nach 1945 mit seinem Einsatz für junge österreichische Literaten einlösen, nicht nur mit der Herausgabe der Anthologiebände Stimmen der Gegenwart …
Bei der Literarischen Welt, wo Weigel von 1. April 1927 bis 1. April 1928 arbeitete, schrieb er Adressen und Aufforderungen für Inserate, bearbeitete Einzelbestellungen und betreute das Mahnwesen. Doch seine wichtigste und für ihn lohnendste Aufgabe war es, Besuchern die Tür zu öffnen und sie anzumelden. Wen sah er da nicht alles: Bekannte Literaten der Vorkriegsjahre wie Ernst Toller, Walter Hasenclever, Joachim Ringelnatz, Felix Braun, Jakob Wassermann oder Hugo von Hofmannsthal bekam er neben vielen anderen zu Gesicht. Fast alle von ihnen konnte seine Erinnerung viele Jahre später in seiner Autobiografie mit einer Anekdote verknüpfen.
Wenn er etwas für die Literarische Welt schreiben sollte, Buchbesprechungen, einen Weihnachtsratgeber für Musik oder über einen stürmisch verlaufenen Abend mit Adolf Loos, so war das nicht nur in seinen Augen „unterdurchschnittlich“, denn er war „mit zwanzig noch ein miserabler oder gar kein Schriftsteller“.9
Weigel belegte zwar weiterhin Jusvorlesungen für den Fall, dass er wirklich weiterstudieren sollte, spielte sogar kurzfristig mit dem Gedanken, zur Germanistik zu wechseln, doch sein Schutzengel, „auch sonst nicht faul“, sollte ihn vor der Germanistik bewahren, denn in seinen Augen verhielt sich „Germanistik zu Literatur wie Gynäkologie zu Liebe“.10
Erst im Frühjahr 1928 kehrte Hans Weigel nach über einem Jahr in Berlin nach Wien zurück. Im Zeugnis, das sich im Nachlass in der Wienbibliothek befindet, wurde ihm „gern bestätigt, dass er alle ihm übertragenen Arbeiten und Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt hat, aber darüber hinaus, durch eigene Initiative, eigentlich vielmehr ein wertvoller Mitarbeiter für uns war, als eine untergeordnete Hilfskraft“.
Die Vorgänge des Jahres 1927 in Österreich – die Erschießung zweier sozialistischer Schutzbündler durch christlichsoziale Frontkämpfer in Schattendorf und deren Freispruch, der Brand des Justizpalastes und die Niederschlagung der sogenannten Julirevolution durch die christlichsoziale Regierung von Ignaz Seipel – hatte er in den Zeitungen in Berlin genau mitverfolgt. Mit scharfen Worten verurteilte er viele Jahre später in seiner Autobiografie Ignaz Seipels Reaktion sowie das Vorgehen des verantwortlichen Wiener Polizeipräsidenten Johann Schober und fragte sich, warum er nach Wien zurückgekehrt war, während Ödön von Horváth, Karl Kraus, Alfred Polgar und Robert Musil zu dieser Zeit Berlin vorzogen. Er gab sich selbst nach längerem Nachdenken eine Antwort: „[…] vermutlich aus Loyalität gegenüber jenen vierzig Prozent Verfolgter, denen ich mich verbunden fühlte“.11 Schon hier zeigt sich, dass er als eingefleischter Österreicher Österreich sein Leben lang liebte und gleichzeitig daran litt. Es war für ihn keine Kunst, dass er Österreicher war, wohl aber eine, dass er es nach diesen Vorfällen und dem späteren „Anschluss“ Österreichs an das Dritte Reich nicht nur blieb, sondern auch nach seiner Emigration mit Überzeugung wieder Österreicher wurde, „was ihm so viele Österreicher mosaischer Konfession [sein Leben lang] übelnahmen“.12 Dabei war er aber, so oft er konnte, noch vor 1933 in Berlin, wie er in Das Land der Deutschen mit der Seele suchend vermerkte: „[…] so, wie man sonst eine geliebte Landschaft immer wieder aufsuchte. Ich wollte das Hier-zu-Hause-Sein wiedererleben, auskosten, ich wollte versuchen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gab, hier zu arbeiten. Im Sommer 1932 zum letzten Mal. Hätte ich damals eine Stelle gefunden, wäre ich gewiß, freudig und erfüllt, um diese Fünf-Minuten-vor-zwölf-Zeit nach Berlin übersiedelt. Ich riet noch damals allen Wiener Freunden, doch unbedingt nach Berlin zu gehen.“ Und: „[…] seit ich damals, 1932, von Berlin weggefahren bin, war nun doch dieses Berlin die Stadt meiner Träume geworden. – Eine Sehnsucht, die sich niemals erfüllte.“13 Berlin hatte ihn auf seinem ersten großen Umweg „von Wien nach Wien“14 zu sich selbst geführt. Später sollte er es als persönlichen Affront empfinden, dass trotz seiner Liebe zu Berlin durch die Nürnberger Gesetze des Dritten Reichs ein „unüberwindliches Ehehindernis“ zwischen ihm und Berlin gleich einer Mauer aufgerichtet worden war.
Die literarische Situation in Österreich in der Zwischenkriegszeit schilderte Weigel rückblickend so: Es gab die Etablierten wie Anton Wildgans, Franz Karl Ginzkey, Rudolf Hans Bartsch, Franz Werfel, Stefan Zweig, Felix Salten, während Robert Musil, Hermann Broch und Franz Kafka in den Dreißigerjahren kaum wahrgenommen wurden und die Jungen in Weigels Alter keine Chance hatten. Friedrich Torbergs Roman Der Schüler Gerber dürfte die Ausnahme der Regel gewesen sein: „Wäre ich der nächste Rilke oder der nächste Schnitzler gewesen, wäre dies nicht bemerkt worden und hätte nichts bewirkt.“15 Doch war er nach eigener Aussage damals noch weit davon entfernt.
In einem undatierten Manuskript für ein Interview mit der Kärntner Tageszeitung, im Nachlass erhalten, antwortete Hans Weigel auf die Frage, welche Kontakte er mit den „jüdisch-österreichischen Intellektuellen“ der Zwischenkriegszeit gepflegt hatte: „Ich war befreundet mit Medizinern und Ärzten, die mit Freud und Adler sympathisierten und war selber von deren Theorien sehr fasziniert. Ich stand aber in leidenschaftlicher Opposition zum literarischen Establishment der 1. Republik, also Leuten wie Franz Werfel, Stefan Zweig und Hugo von Hofmannsthal […, da ich sie] wahrscheinlich für die schreckliche Zeit mitverantwortlich machte, obwohl Bundeskanzler Prälat Seipel das Judentum beschimpfte, unternahmen diese Literaten nichts gegen ihn. Die Literatur stagnierte […] Die neue Musik war im Ghetto. Nur wenige wirklich bedeutende Denker konnten erfolgreich arbeiten. Werfel und Zweig waren Exponenten des Systems und mussten für mich als einen jungen Oppositionellen als Galionsfiguren der Seipel-Ära erscheinen.“
Bis 1932 war Weigel Hörer und Leser von Karl Kraus, der ihn sehr beeinflusste und auf den er sich später des Öfteren berief. Zeugnis dafür ist sein viel beachtetes, 1986 Elfriede Ott gewidmetes Buch Karl Kraus oder die Macht der Ohnmacht, ein Versuch eines Motivberichtes zur Erhellung eines vielfachen Lebenswerks, wie der Untertitel erläutert. Doch unterstützte er die polemischen Angriffe seines kritischen Vorgängers nicht immer und wandte sich von ihm ab, als dieser mit dem Dollfuß-Regime sympathisierte.
Durch die Freimaurerbeziehungen seines Onkels erhielt Hans Weigel in der Abteilung für Herstellung und Vertrieb im Paul Zsolnay Verlag in den Jahren 1929 und 1930 eine Stelle. Dafür hatte er sich mit einem Buchdruckkurs an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, damals noch in der Westbahnstraße, weiters mit einem Kurs für Prinzipale und einem ergänzenden Volontariat in der Druckerei Waldheim-Eberle vorbereitet. Auch später sollte Weigel sicher noch so manche Druckerei besuchen, denn noch 1983 betonte er in Das Schwarze sind die Buchstaben: „Ich war so gern in Setzereien und Druckereien, ich sah in jedem, der dort arbeitete, meinen Freund und Helfer.“16
Für Weigel waren diese zwei Jahre bei Zsolnay eine ruhige, gemächliche Zeit, ein „Aschenputtel-Dasein“, wie er es nannte, in denen er jedoch Anstoß an der Kommerzialisierung der Literatur nahm. Einen Platz in diesem Verlag, „der mir zusagte, der mich und den ich ausgefüllt hätte“17, sah er nicht, er zog die Konsequenzen und verließ den Verlag. Im am 31. Dezember 1930 ausgestellten Zeugnis wurde er dennoch sehr gelobt: „Wir hatten in Herrn Weigel einen ungewöhnlich befähigten, hingebungsvollen und äusserst strebsamen Mitarbeiter, der der Abteilungsleitung dank seiner besonderen Begabung tatkräftigst zur Seite stand und ihr wertvolle Dienste leistete.“ Doch zumindest den Umgang mit dem grafischen Gewerbe empfand er als lehrreich. Zudem hörte er im Verlag zum ersten Mal den Namen Doderer, weil seine Kollegin Lisa Ludassy, Tochter eines heute vergessenen, doch zu seinen Lebzeiten am Beginn des vorigen Jahrhunderts beliebten Schriftstellers, ein Buch von Doderer ihrer Freundin Lili Bier empfahl. Über die Jahre und den Krieg hinweg blieb dieser nicht gerade gewöhnliche Name in Hans Weigels Gedächtnis hängen. Bei einer großen Kunstausstellung 1946 in der Ausstellungshalle Zedlitzgasse wurde er dem damals nur wenigen bekannten Heimito von Doderer schließlich vorgestellt. Seit damals, seit seinem aus der Erinnerung emportauchenden, bewundernden „Jöh!“ entwickelte sich eine über den Tod hinausgehende Freundschaft, die sich durch die „Einbeziehung des Ganzen in Zustimmung“, der „ganzen Person namens Heimito von Doderer mitsamt allen Schrullen und Menschlichkeiten“18 auszeichnete.
Im Café mit Heimito von Doderer, 1970er-Jahre
Im Zsolnay Verlag begegnete Weigel auch durch das Manuskript Der Schüler Gerber hat absolviert dem ihm bis dahin unbekannten Friedrich Torberg. „Das war ein Buch“, bekannte Weigel 1980 in Große Mücken, kleine Elefanten, „das ich gern geschrieben hätte.“19 Dieses Manuskript war dem Verlag von Max Brod empfohlen worden und Weigel hatte den genauen Umfang durch Zählen der Anschläge festzustellen. „Es war der Mittelschüler-Roman“, der „die Institution der Mittelschule genauso in Frage stellte wie ich.“20
Weigel bezeichnete Torberg und sich selbst später als „eine Art Vettern im Geist. (Vor allem, weil Polgar unser Vorbild war.) Unsere Beziehung war eine der bestentwickelten Hasslieben dieses Jahrhunderts“.21 Denn ihre Variationen des Themas Wiener Autor Jahrgang 1908 „berühr[t]en und kreuz[t]en einander immer wieder und rieben sich auch immer wieder aneinander. Wir sind fast immer einig, wenn auch, wie man zu sagen pflegt, oft nur darüber, dass wir uneinig sind. F. T. ist mein ältester literarischer Freund. […] Er kam gerade noch dran, erfreulich und erstaunlich früh. Aber kaum dass er Zsolnay-Autor geworden war, warf Zsolnay Ballast ab, welcher dem grossen Nachbarn missfiel, und hielt sich lieber an Jakob Schaffner [den Schweizer Schriftsteller, der die nationalsozialistische Ideologie unterstützte]. Torberg war auf einen Aussenseiterverlag in Mährisch Ostrau, dann auf einen Verlag in Zürich angewiesen. Schwer, ein Romancier zu sein! Wir sind durch alles hindurch und über alles hinweg in Kontakt geblieben. Es blödelt sich so gut mit ihm, es ist auch ein Vergnügen auf höherer Ebene, mit ihm verschiedener Meinung zu sein“.22
1931 wurde Hans Weigel durch die Geduld, das Verständnis und die Großzügigkeit seiner Eltern ein einjähriger Aufenthalt in Paris ermöglicht, den er, der „fanatische Admirateur der französischen Sprache“, die er „so gern hörte und sprach“23, vor allem dazu nutzte, die Stadt kennen und lieben zu lernen. Er wohnte im Hotel Riviera – 22, Rue Saint-Sulpice im 6. Arrondissement – in einem sehr kleinen Zimmer im fünften Stock, studierte nicht, las viel, faulenzte eigentlich, ging ins Theater und in Konzerte. Diese Liebe zu Paris und zur französischen Sprache sollte mit eine Voraussetzung für seine hinreißenden Molière-Übersetzungen nach 1962 sein.
Als Weigel aus den Zeitungen vom Tod Arthur Schnitzlers am 21. Oktober 1931 erfuhr, schrieb er für die französische Literaturzeitschrift Les Nouvelles littéraires ein paar Zeilen – es war übrigens der einzige kleine Artikel, den er je in Französisch schrieb – „mehr Nachricht als Nekrolog“: „Als er starb, habe ich schon um ihn getrauert, nach dem Zweiten Weltkrieg begann ich ihn allmählich zu erkennen. Die Schuld an dem Lebenden kann nicht getilgt, nur eingestanden und bereut werden.“24 Immer wieder sollte Weigel sich nach dem Zweiten Weltkrieg für Schnitzlers literarisches Fortleben einsetzen. Er sah sich selbst als „Wiederentdecker der ersten Stunde“.25 Und Schnitzler sollte später für Elfriede Ott und ihn „eine Art Familienheiliger“26 werden, zu dem er eine starke Beziehung hatte.
Aber ganz untätig war Weigel in Paris dann doch nicht: Er übersetzte Jules Supervielles L’enfant de la haute mer (Das Kind der hohen See) und die Novelle Les Mots (Die Worte) (immerhin 34 DIN-A4-Seiten) von André Baillon aus dem Französischen ins Deutsche.
Nach seiner Rückkehr aus Paris kam Weigel zum ersten Mal aktiv in Berührung mit der Welt der Bühne: Zu Beginn des Jahres 1932 gründeten der Leiter der Bühnenabteilung der Universal Edition, Hans Heinsheimer, und der Komponist Max Brand die „Wiener Opernproduktion“, um Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny von Bertolt Brecht und Kurt Weill am Wiener Raimund Theater, das damals dem Volkstheater angeschlossen war, in Szene gehen zu lassen. Bereits 1929 war Die Dreigroschenoper aufgeführt worden. Formell befand sich der Sitz der Gesellschaft in der Margaretenstraße 22, der großen Wohnung von Weigels Eltern, seiner offiziellen Adresse. Weigel wurde mit in die abenteuerliche Produktion eingebunden, indem er für die Organisation der gesamten Vorbereitung und für die Verrechnung verantwortlich war.
Lotte Lenya und Kurt Weill
Nachdem ein Orchester und ein Ensemble zusammengestellt worden waren, konnten Kurt Weills Frau Lotte Lenya für die weibliche Hauptrolle der Jenny und der vortreffliche junge Tenor Otto Pasetti, der 1945 eine wichtige Rolle bei Hans Weigels Rückkehr nach Österreich spielen sollte, für die Rolle des Jimmy engagiert werden. Für die einzige Sprechrolle fiel die Wahl auf einen Anfänger: Kurt Meisel, der später als Schauspieler und Regisseur bekannt werden sollte. Die einfache Dekoration – sie bestand im Wesentlichen aus drei verschieden langen Stangen – stammte von Lizzi Pisk, die als Reinhardt-Seminaristin hauptberuflich Leiterin einer Gymnastikschule und die als Regisseurin, Zeichnerin und Choreografin „genialisch allround begabt“27 war. Mit ihr sollte Weigel in der Folge eine jahrelange Freundschaft verbinden, die nach dem Krieg wiedererstand.
Selbst Proben fanden in Weigels elterlicher Wohnung statt, da sein Vater damals beruflich halb in Prag tätig war. Nachdem Weigel bei diesen die stumme Rolle des Tobby Higgins in der großen Gerichtsszene markiert hatte, entschied Regisseur Heinsheimer, diese Rolle bei Weigel zu belassen. Higgins wird in diesem Stück des vorsätzlichen Mordes zwecks Erprobung eines alten Revolvers angeklagt. Da er sich mimisch mit dem Gericht über eine Bestechungssumme einigt, wird er freigesprochen, geht danach „triumphierend über die Bühne und wird von den Gerichtssaalkiebitzen gefeiert. […] Es war meine erste und letzte Rolle auf der Bühne, ich stand nicht auf dem Theaterzettel, aber ich musste immerhin: sitzen, deuten, gehen. Das würde ich mich heute [Anfang der 1970er-Jahre] nicht mehr getrauen“.28
Waren die Hauptproben chaotisch, so gestaltete sich die Generalprobe als Katastrophe. Die Premiere am Dienstag, dem 26. April 1932, lief dann jedoch ohne gröbere Zwischenfälle ab, wie sich Weigel später erinnerte: „Lotte Lenya war grossartig und wurde bejubelt. Die Gerichtsszene hatte (auch bei allen Wiederholungen) spontanen Applaus. Aber das Ganze bewirkte nichts.“29
Die österreichischen Zeitungen lehnten Musik und Inhalt der Oper ab, manche ließen zumindest die Aufführung und die Protagonisten der Hauptrollen gelten, wie in der konservativen Neuen Freien Presse am 28. April 1932: „Und das Ganze soll eine Oper sein! Schon alleine eine solche Gattungsbezeichnung ist eine Brüskierung jeglichen Stilgefühls. […] Für die vielen kleinen Rollen hatte man junge Talente geworben, die, wenn auch nicht immer ausreichend, mit Feuereifer bei der Sache waren. [Armella Bauer und Otto Pasetti wurden vom Ensemble hervorgehoben.] Als der Star der Truppe ist Lotte Lenya anzusprechen, die mit klagender Kinderstimme, verschwollenen Augenlidern und geradezu fatalistischer Apathie der Dirne Jenny die charakteristischen Züge einer erschreckenden Dekadenz verlieh.“
Unter dem Titel Oper der Zeit würdigte Das Kleine Blatt, ebenfalls am 28. April, die Weill’sche Musik: „Wie schon in ihrer berühmten Dreigroschenoper haben sie die Oper des Geldes geschrieben. […] Zu diesem Thema, das für eine Oper neuartig in seiner Unerbittlichkeit, in seiner schneidenden Ironie, in seiner Gesinnung ist, hat Kurt Weill eine neuartige Musik geschrieben, die von schmissigen Songs bis zur Fuge und der Nachahmung klassischer Muster vielerlei Elemente enthält […]“
Die Reichspost jedoch verriss am selben Tag Inhalt und Musik: „Der dramatische Gehalt: Kaum der Rede wert – eine so sinnlos zügellose Orgie rohester Instinkte und Ansichten – die oft schier tollhäuslerische Musik: den Jazzrhythmus bevorzugende Musik schreckt vor grellsten Kakophonien nicht zurück – eine Pein der ganze Abend mit der Dürftigkeit fast sämtlicher Leistungen, mit seiner schon unerlaubt primitiven Bühne.“
Die ebenfalls negative Stückkritik von Hans Ewald Heller auf der ersten Seite der Wiener Zeitung gipfelte in einem Vorwurf: „Dass aber Sensationslust einen an sich kaum nennenswerten künstlerischen Gedanken mit dem Pseudoflitter eines nicht existenten Ethos behängt, das ist der große Vorwurf, den man dem musikalischen Kampfgenossen Bert Brechts nicht ersparen kann. […] – Was soll das alles?“ Lediglich die Aufführung selbst, das Dirigat von Gottfried Kassowitz und die Leistung von Lotte Lenya fanden Anerkennung. Bei ihr steigerte Heller seine Anerkennung: „[…] eine meisterhafte Darstellerin, eine Persönlichkeit, die so eigenartig wirkt, dass die Frage, ob sie überhaupt singen, sprechen oder tanzen kann, völlig belanglos wird.“
In seinem Schreiben vom 10. Mai 1932 dankte Hans Heinsheimer seinem jungen Mitarbeiter Weigel aus einem „wirklichen Bedürfnis heraus“: „Ich möchte Ihnen nochmals aufs allerherzlichste und aufrichtigste für die wirklich unmenschliche Arbeit danken, mit der Sie in den letzten Wochen unsere Unternehmung unterstützt haben. Es ist nicht eine Phrase, sondern meine feste Überzeugung, dass ohne Ihre hingebungsvolle, unglaublich genaue und gleichzeitig wirklich inspirierte Mitarbeit diese ganze Aufführung in dieser Form gar nicht hätte zustande kommen können […]“
Doch trotz dieses ersten Schrittes in die Bühnenwirklichkeit sah Hans Weigel sich in dieser Zeit als mehrfach gescheiterter „Möchtegern-Autor“: „Ich war [1933] allerdings noch immer nicht Schriftsteller, ich hatte den Beruf weiter umkreist wie ein Trabant einen Stern und mich von einer neuen Seite her einem Zugang gegenüber gesehen; doch der Bühneneingang des Theater schloss sich wieder.“30
Nicht umsonst bezeichnete er sich an anderer Stelle als „Spätblüher“. Viel hatte er bisher nicht geschrieben, doch erinnerte er sich später an seine erste Kritik für irgendeine „obskure Tageszeitung“, die er für eine an ihn weitergegebene Freikarte fürs Volkstheater zu schreiben hatte. Es war eine sehr positive Besprechung gewesen, worauf er im Nachhinein stolz war, da er zu einem damals völlig unbekannten französischen Autor gestanden hatte, der später berühmt werden sollte: Es war Marcel Pagnol, das Stück hieß Marius.
Aus Paris war er immerhin mit einer Talentprobe, dem Libretto zu seiner satirischen Oper Zweibettzimmer, zurückgekehrt, das ein Freund vertonen sollte, was aber nie geschah. Auch das Verschicken des Librettos an verschiedene Kunstschaffende blieb ohne Reaktionen. Die Jahre 1932 und 1933 empfand Weigel also als Jahre „der vergeblichen Versuche und der Ratlosigkeit“31. 1932 versuchte er anlässlich einer weiteren Reise nach Berlin noch einmal „vergeblich“ in der von ihm so sehr geschätzten Stadt Fuß zu fassen. Die Ausgangssituation in seinem posthum veröffentlichten Roman Niemandsland, den er am Beginn seiner Emigrationszeit 1938 geschrieben hatte, zeigt hier eine gewisse Parallele auf: Dem Wiener Protagonisten Peter ist dieses Fußfassen in Deutschland als Regisseur an einem Theater geglückt, nach der Machtübergabe an Hitler muss er aber als Jude Deutschland verlassen. Weigel hatte in dieser Zeit ernsthaft daran gedacht, sein Glück in Deutschland zu finden, wie dies vielen Österreichern in der Zwischenkriegszeit bis 1933 möglich war. Auch war er in dieser Zeit „ein politischer Ignorant, verschwommen links, weil man damals als vernünftiger österreichischer Vierundzwanzigjähriger wirklich nicht anders konnte“.32 Und mehr oder weniger links blieb er sein ganzes Leben eingestellt, ohne sich jedoch je vor den Karren der Parteipolitik spannen zu lassen.