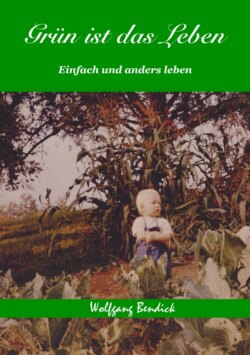Читать книгу Grün ist das Leben - Wolfgang Bendick - Страница 5
Bio - Welt
ОглавлениеUnsere Freunde aus Österreich kauften ihr Gemüse bei einem Bio-Bauern in Deutschland. Manchmal halfen sie auch etwas beim Ernten mit, das gehörte anscheinend dazu. Sie hatten uns gesagt, dass dieser immer auf der Suche nach Hilfskräften wäre. Nur würde er nichts für die Arbeit bezahlen. Da die biologische Landwirtschaft uns noch ziemlich fremd war und da wir im Augenblick nicht so recht wussten, wie wir unser gemeinsames Leben verbringen wollten, fuhren wir zu diesem Bio-Bauern hin.
Es war Mitte Januar, und die Natur war, selbst in Bodenseenähe, noch weitgehend „im Ruhestand“. Das ließ uns der Bauer auch gleich von Anfang an wissen. Und dass, wenn er wirklich jemanden bräuchte, dieses erst später im Frühjahr wäre. Doch zeigte er uns trotzdem den Hof und umriss in groben Zügen den biologischen Landbau: Eigentlich seien richtige Bauern nur diejenigen, die nach den kosmischen Gesetzmäßigkeiten, also den Richtlinien Rudolf Steiners arbeiteten, alle anderen seien Stümper. Sie seien vielleicht gute Arbeiter, hätten aber von den wahren Dingen wie Leben und Wachstum nichts begriffen.
Was blieb uns anderes übrig, als zu allem zu nicken und zu versuchen, von den wichtigen Dingen etwas im Gedächtnis zu behalten, und irgendwann auch mal eine Bemerkung anzubringen. Auf jeden Fall geht man nicht zu einem Bio-Bauern einfach so zum Helfen! Es ist eher so, als würde man in einen Orden eintreten, oder in einen Aschram. Es geht weniger um die hilfreichen Handgriffe, sondern um die Einstellung, in der man sie macht. Und außerdem machten alle alles falsch, und eigentlich müssten die Helfer noch dafür bezahlen, dass sie helfen dürfen, da sie doch dem Bauern seine wertvolle Zeit nähmen und zudem in ihrem Unwissen Material und Pflanzen beschädigten…
Wir liefen durch die Obstwiesen, die weitgehend brachliegenden Felder (nur ein paar Reihen Lauch und Rosenkohl spitzten aus dem schneebedeckten Boden), durch den Beerengarten, während der Bauer mit fast theatralischen Gesten versuchte, uns die Grundzüge der einzig wahren Anbauweise zu vermitteln: Die Natur gäbe nicht einfach so. Das sei kein automatischer Mechanismus. Das Säen, Pflegen und Ernten sei etwas Ganzheitliches. Das sei ein Zusammenspiel von Weltall, Erde und Mensch. Man müsse Teil davon sein, oder zumindest, was uns beträfe, es noch werden!
Irgendwie war der Gedankengang schon faszinierend! Auf diese Weise hatten wir etwas so Einfaches wie Säen, Ernten und Essen noch nie betrachtet! Ich dachte an meine Kindheit, wo alle wichtigen Gesten des bäuerlichen Alltags von Gebeten oder Segnungen begleitet waren. Ich sagte das dem Bauern. Der stutzte einen Moment. „Da ist schon auch etwas dran. Man muss sich bewusst sein, dass es universelle Kräfte sind, früher hätte man gesagt göttliche, die da wirken, dass wir Menschen und das ganze Weltall eine Art Einheit bilden, wo alles alles beeinflusst. Und das kann auf zweierlei Weise geschehen, zum Positiven als auch zum Negativen, zum Heil oder zum Unheil, zur Gesundheit oder zur Krankheit des Wesens, ob es nun ein Mensch oder eine Pflanze ist.“
Doch all das waren vorerst nur Worte in den Wind gesprochen, denn der Bauer machte uns klar, dass es jetzt im Winter keine Arbeit gäbe, und nur eine warme Unterkunft zur Verfügung zu stellen, die wir dann wieder verließen, sobald die schöne Jahreszeit käme, dazu sei er nicht da! „Arbeit gibt es doch auch im Winter“, warfen wir ein, „Holz machen, Reparaturen, aufräumen!“ „Ja könnt ihr das überhaupt? Ihr jungen Leute heutzutage glaubt alles zu wissen, alles zu können und habt doch jeder zwei linke Hände… wenn man bedenkt, wer hier alles schon versucht hat, zu arbeiten…!“. Wir kamen in den engen, dämmerigen Kuhstall. Sechs Kühe fristeten hier ihr ganzheitliches Dasein. Es war warm und roch süßlich nach Heu, Mist und Milch. „Wir könnten jeden Tag misten, die Tiere striegeln…“. „Melken tu aber nur ich! Denn bei jemand anderem verlieren die Kühe gleich ihre Milch!“ Die Kühe machten lange Hälse. Sie streckten weit ihre Zunge hinaus, um uns zu abzulecken, und leckten sich anschließend ihr glänzendes Maul und die Nasenlöcher. „Kühe sehen nicht gut. Sie besitzen nur dreißig Prozent des Sichtvermögens eines Menschen. Auch sehen sie kein Rot. Ihr Blickwinkel ist 330 Grad, das heißt, fast rundum. Dafür aber ist ihr Geruchsinn sehr ausgeprägt“, erklärte der Bauer. „Den Duft, den sie an euch gefunden haben, bringen sie mit ihrer Zunge in ihre Nase und machen sich dann ein ‚Bild‘ vom Gerochenen. Sie scheinen euch zu mögen!“ War es das, was den Ausschlag gegeben hatte?
Jedenfalls kamen wir überein, dass wir auf dem Hof bleiben könnten. Bis zum Herbst. Wenn dann weniger Arbeit wäre, müssten wir aber gehen! Den nächsten Winter könnten wir jedenfalls nicht bleiben! Man nähme uns aus reiner Nächstenliebe, denn effektive Arbeit zu leisten, wären wir erst in ein paar Jahren imstande. Auch bekämen wir nur die vier Wände zur Verfügung gestellt! Holz und Essen müssten wir selber besorgen, wir bekämen keinen Lohn, würden nicht versichert, müssten aber im Winter mindestens einen halben Tag, und wenn dann die Arbeit losginge, einen ganzen Tag arbeiten! Ein Tag in der Woche sei frei. Wir sagten zu, aber unter der Bedingung, dass einer von uns unter diesen Umständen später auswärts Arbeit suchen müsste, denn etwas Geld bräuchten wir doch noch. „Ihr wisst gar nichts von eurem Glück, denn im Schwarzwald gibt es einen Bauern, der sich 800 Mark im Monat zahlen lässt dafür, dass man dort arbeiten kann! Da geht es morgens um 5 Uhr raus und bis zum Sonnenuntergang, und alles wird von Hand gemacht und mit Pferden...“ Und dieser Landwirt, „der Rödelberger“, war ab jetzt der große ‚Buhmann‘, wenn wir mal mit unserem Los bei unserem Bauern nicht zufrieden waren.
Unser Zimmer lag über der Küche der Bauernfamilie, unterm Dach des Hauses. Das Klo war im Flur, das Bad unten. Dieses konnten wir einmal pro Woche benutzen und es musste vorher eingeheizt werden. Ein alter Küchenherd war das Hauptmöbel unseres Raumes. Am ersten Abend durften wir ein paar Holzscheite des Bauern nehmen, dann mussten wir das Brennholz selber im Wald suchen. Als später das Feuer im Herd knisterte und die Flammen durch die schlecht schließenden Ringe der Platte hindurch unter der Zimmerdecke ihren Reigen tanzten, lagen wir auf der Matratze und waren glücklich. Man hatte uns genommen! Vom Stall dringen leise die Geräusche der Kühe zu uns herauf, ein Parfüm von Äpfeln liegt in der Luft, vermischt mit dem erdigen Geruch von Kartoffeln und dem Modergeruch aus dem Kellergewölbe, wo die Gemüse für den Hofverkauf ausliegen. Die Bäuerin hatte uns ein paar angewelkte Porree-stängel zugeschoben, aus den wir eine Suppe kochen konnten. „Das soll aber eine Ausnahme bleiben, denn die Gemüse sind zum Verkauf bestimmt!“, grummelte der Bauer. Später aßen wir dann unsere Suppe und genossen die vier ‚eigenen‘ Wände. War dies unser erster Schritt zu einem eigenen Höfle?
Am nächsten Morgen ging es dann los. Man zeigte uns den Keller, die Schuppen, den Schweinestall. Doris sollte der Frau zur Hand gehen, ich folgte dem Bauern durch die restlichen Gebäude, wobei er mir alles zeigte und zugleich schon erklärte, was in Zukunft alles zu tun sei, falls er mal nicht da sei oder ich eine freie Minute hätte. Denn ohne Arbeit ginge es mal nicht auf so einem Hof! Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie wenig in der Landwirtschaft verdient werde! „Das Beste wäre, gar nicht zu arbeiten, denn das würde wenigstens die Unkosten ersparen!“ „Aber man hat doch immer genügend zu essen, und das ist doch schon etwas!“, warf ich ein. Daraufhin bekam ich erst einmal eine lange Predigt über die Ausgaben für Versicherungen, Strom, Wasser und Maschinenreparaturen, Ernteausfälle und die schlechte Marktlage. Das kam mir zwar mehr als Ausrede vor, um uns keinen Lohn zahlen zu müssen, ließ es aber ohne Kommentar. Überall häuften sich Geräte und Dinge, die darauf warteten, repariert oder aufgeräumt zu werden, oder gleich weggeworfen oder verbrannt. Dafür, dass es die arbeitsarme Saison war, gab es überraschenderweise viel zu tun! Wie sollte das erst werden, wenn mal Hochsaison herrschte?
Am Mittag wollten wir dann, wie ausgemacht, mit der Arbeit aufhören. „Ja aber ihr seid doch noch gar nicht fertig!“, bekamen wir zu hören. „Es war doch ausgemacht, in der ruhigen Zeit nur ein halber Tag Arbeit täglich!“, warfen wir ein. „In der Landwirtschaft gibt es keine festen Zeiten! Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ihr noch lernen müsst! Fertig ist man, wenn die Arbeit beendet ist!“ Das schien uns wie eine neuartige Auslegung von ‚gleitender Arbeitszeit‘, wie sie gerade in manchen Betrieben ausprobiert wurde. Gut, wir hatten zugesagt, wollten außerdem, vor allem zu Anfang, auch niemanden enttäuschen. Also machten wir am Nachmittag weiter, bis unsere Aufgabe beendet war. Doch dann machten wir uns aus dem Staub, ohne dem Bauern etwas zu sagen.
Wir erkundeten die nähere Umgebung. Wir gingen einfach der kleinen Teerstraße nach, die an dem Haus vorbei führte. Wir liefen durch eine vom Frost vergilbte Streuobstwiese zu einem kleinen Hügel. Wir schwangen uns über einen hölzernen Zaun und stiegen zwischen den grobrindigen, leicht gedrehten Stämmen bis hinauf auf den Moränenhügel. In der Ferne glitzerte der blasse Spiegel des Bodensees, umrahmt von den majestätischen, schneebedeckten Schweizer Bergen. War das schön! Wir setzten uns auf einen Anorak, schmiegten uns aneinander und ließen den Blick schweifen. Es roch leicht nach feuchtem Laub. Wir waren glücklich und verspürten so etwas wie das Gefühl von Heimat…
Die Arbeit begann mit Sonnenaufgang. Auch, wenn sie nicht zu sehen war. Das war im Winter ganz angenehm, wenn es auch in der Früh nicht gerade ein Vergnügen war, wenn der Reif unter den Schritten knirschte und die Hände am eiskalten Werkzeug festklebten. Der Atem wehte wie eine weiße Fahne und kondensierte im Bart zu Tropfen. Langsam hob sich der Nebel und die Silberwelt wurde durchsichtiger. Wie Weihrauch lag der Geruch der Holzfeuer in der Luft, bis bald die ersten Sonnenblitze die Welt mit Farben bespritzten. Doch das war hier in Bodenseenähe leider nicht die Regel. Oft blieb es grau, und man vergaß schnell, dass irgendwo auch eine Lichtwelt existierte. So gegen zehn Uhr machten die Bauern Kaffeepause. Das war unsere Frühstückszeit. Außerdem waren wir keine Kaffeetrinker. Das war weniger gesundheitlich bedingt. Vielleicht ging das bei mir auf eine Ablehnung der spießerischen Gesellschaft zurück, die im Kaffeeritual ihren Höhepunkt fand. Jedenfalls war diese halbe Stunde Pause unsere Frühstückszeit, wo wir unser Müesli zu uns nahmen, verbessert mit warmer Milch und geschnetzelten Früchten, die wir aus der Schweinetonne gelesen hatten. Bei Sonnenuntergang war Arbeitsende, wenn es uns nicht gelang, uns nach erledigten Pensum vorher davonzustehlen.
Nach getaner Arbeit ließen wir uns von der sich durch die Wiesen und Obstanlagen schlängelnde Straßen leiten, bis uns ein Bächle oder Pfad von dieser ablenkte. Wir folgten diesem wie Entdecker und freuten uns an jedem Wehr oder unterhöhltem Ufer, beobachteten die Forellen oder andere Tiere, die sich langsam wieder ans Tageslicht wagten, wenn wir uns eine Weile nicht bewegt hatten. Was gab es da alles zu entdecken, wenn man erst einmal still geworden war! Das Plätschern des Wassers wurde zu Musik, das Wehen des Windes zu einer Melodie, zu der sich mit dem Längerwerden der Tage auch noch die Stimmen der zurückgekehrten Vögel gesellten. Langsam erwachte die Natur, viele uns unbekannte Pflanzen durchstachen die feuchte Erde und entrollten oder entfalteten ihre Stängel und Blätter. Wir hatten immer ein Pflanzenbestimmungsbuch bei uns und lernten bei jeder Wanderung neue Gewächse und deren Wirkungen auf die Menschen kennen. Wir fingen an, die ersten Pflanzen zu sammeln und zu trocknen. Der Bauer gab uns eine seiner auf dem Dachboden eingestaubten Tret-Nähmaschinen. Doris nähte damit kleine Säckchen, die wir mit den Kräutern füllten. Oder wir stopften sie in Schraubverschluss-Gläser, wenn sie aromatisch waren. Auch fertigten wir mit Obstler Tinkturen an, die uns bei Erkältungen halfen oder die wir unseren Freunden als Schnaps servierten. Wir begannen in dieser Zeit ein Herbarium anzulegen. Nicht weit vom Hof stand ein verwahrlostes Haus, an dem wir manchmal bei unseren Exkursionen vorbeikamen. Es war das einzige verwahrloste Haus in der Umgebung und drohte, bald einzufallen. Es muss vor langer Zeit eine Mühle gewesen sein, denn ein ausgetrockneter Kanal führte dort hin. Der Ort gefiel uns, vor allem die Inschrift in gotischen Buchstaben über der Tür: „Was von deinen Vätern du ererbt, erwirb es, um es zu besitzen!“ Wir sprachen den Bauern darauf an. „Der Spruch ist von Goethe! Das Haus ist irgendwie verwunschen. Die da gewohnt haben, sind alle spinnet geworden. Es gibt schon noch einen Eigentümer. Aber der hat es wohl nicht nötig, etwas damit zu machen…“
Manchmal spielte ich in Gedanken mit einem Studium. Warum nicht Medizin? Oder doch eher Heilpraktiker? Jedenfalls bewarb ich mich dafür und auch für Germanistik und Sinologie. Das wäre doch was, die chinesischen Weisen wie Laotse in ihrer Sprache lesen zu können! Was solls… Man würde mich ja sowieso nicht nehmen… Doris war nicht vom Studieren angetan, sie hatte ihr Pensum schon hinter sich. Nie wieder!
War sehr viel Arbeit, lud uns die Bäuerin schon mal zum Essen ein, damit Doris´ Arbeitszeit besser genutzt wurde. Denn meist ging sie eine halbe Stunde früher weg, um unser einfaches Mahl vorzubereiten. Sonst aßen wir erst am Abend richtig. Wir ernährten uns weitgehend vegetarisch. Das schien uns die dem Menschen entsprechende Ernährungsweise zu sein. Freitag war der Tag, an dem der Sonnenuntergang nicht das Ende der Arbeit bedeutete. Am Samstag war Wochenmarkt, ein großes Ereignis, und das Gemüse musste zum Verkauf vorbereitet werden. Das war im Winter wenig, außer etwas Feldsalat, wenn das Wetter überhaupt eine Ernte zuließ, Endiviensalat, eingekellerte Rettiche, Möhren und Steckrüben. Dazu etwas Lauch, der meist schon während der Woche geerntet wurde, wenn der gefrorene Boden es erlaubte, die Gabel hineinzustechen und die manchmal glitschigen Stängel herauszuziehen. Im Keller lagen noch Zwiebeln, Kartoffeln, rote Rüben, Äpfel. Langsam lernten wir, dass alle Gemüse nur jahreszeitlich verfügbar sind. Nie ganzjährig, wie uns die Auslagen in den Supermärkten glaubhaft machen wollen! Im Keller wurden in ein paar flachen Kisten Chicorées gezogen, deren blasse spindelförmige Knospen im Winter der einzig verfügbare Salat waren. Dazu noch ein paar Eier aus dem Hühnerstall. Auch machte der Bauer abends mit seinem R4 eine Runde und sammelte bei Nachbarn ein, was essbar und verkaufbar war, um seine begrenzten Vorräte aufzustocken. In Wangen gab es außerdem einen Großhändler für Gemüse. Manchmal durfte ich mit dem Bauern dorthin fahren, wenn schwerere Kisten zu laden waren. Der Händler hatte sich in einem alten Lagerhaus eingerichtet. Vorn an der Rampe gab es normal angebautes Gemüse von der Insel Reichenau oder sonst wo, hinten gab es bestes biologisches. Hatte der Händler grüne Daumen oder irgendwelche magischen Kräfte? Denn die Gemüse für uns kamen oft von den gleichen Stapeln wie das herkömmliche. Wenn es einmal die Hintertür passiert hatte, war es plötzlich biologisch! Auf meine Bemerkung hin, dass das alles ja nicht sehr klar sei, meinte mein Bauer, dass man auch mal auf das Wort eines Anderen vertrauen sollte, selbst, wenn nicht jedes Mal ein Etikett an der Kiste angebracht sei. Es würden im Gemüsebau oft gebrauchte Steigen wiederverwendet! Außerdem gäbe es ja auch viele Haushalte, wo in den Gärten gutes Gemüse angebaut würde, und diese sollte man ebenfalls unterstützen…
Zum Glück liebte es der Bauer, alles weitläufig zu erklären. Nur durfte dabei unsere Arbeit nicht unterbrochen werden. Manchmal stand er zwischen uns und anderen gelegentlichen Aushilfskräften auf dem Feld und erklärte die kosmischen Zusammenhänge, während wir in der feuchten Erde wühlten und Pflanzen setzten oder Unkraut jäteten. Und Wissen besaß er, das muss man ihm lassen, auch wenn wir manchmal gar nicht mit seinen Äußerungen einverstanden waren! „Alles ist bipolar. Man kann in der Natur alles einteilen in erdorientierte Wesen und in kosmisch ausgerichtete, zum Beispiel! Der Mann, bedingt durch seine Erektion, ist eher nach oben, also zum Kosmos, ausgerichtet, während die Frau durch ihre Menstruationen erdgerichtet ist, und dadurch auch besser geeignet für Erdarbeiten und Unkraut jäten!“ Ich müsste mal nachlesen, ob das von Steiner ist oder seine eigene Interpretation…
Der biologisch-dynamische Anbau, wie die hier angewendete Wirtschaftsweise hieß, ging auf Rudolf Steiner zurück, einen ‚Geisteswissenschaftler‘, der in vielen Dingen seiner Zeit voraus war. Er hatte Philosophie und Physik studiert und sich mit Goethe beschäftigt. Er hatte in seinem Leben verschiedenen religiösen Strömungen wie auch der Theosophie nahegestanden, und man sagte ihm hellseherische Fähigkeiten nach. Auf ihn gehen die Anthroposophie zurück und die Waldorf-Schulen. 1924 hielt er auf dem Landgut Koberwitz in Ostpreußen mehrere Vorträge über eine alternative Wirtschaftsweise, aus denen dann der biologisch-dynamische Anbau entstand, dessen Markenzeichen der Name ‚Demeter‘ ist.
Anfangs nahm uns die Arbeit ganz schön mit. Denn meistens gebückt zu arbeiten oder auf den Knien auf dem Acker zu rutschen, waren wir nicht gewöhnt. Zum Glück waren die Tage noch kurz und Feldarbeit nur bei gutem Wetter möglich. Der Bauer besaß einen Massey Ferguson Traktor, den er eigentlich immer selber bediente. Nur, wenn es um das Rückwärtsfahren mit Anhänger ging, durfte ich seinen Platz einnehmen. Für den Traktor gab es eine Bodenfräse als Anbaugerät. Diese diente zur Ackervorbereitung. Außerdem war eine kleine Gartenfräse vorhanden, wie eine Art umgebautes Moped (Quickly), dessen lindgrüne Lackierung und Tank original waren. Weiterhin war ein Agria-Motormäher in Gebrauch, mit dem das erste grüne Futter für die Kühe gemäht wurde, damit diese nicht den weichen Boden zertraten. Außerdem diverse Heuernte-Geräte und ein auseinanderfallender Mistbreiter. Eine einfache Hand-Sämaschine, eine Motorsäge und eine elektrische Kreissäge vervollständigten den Maschinenpark. Denn die meiste Arbeit wurde von Hand gemacht.
Außer dem Bauern arbeite seine Frau vollzeitig auf dem Hof. Der erwachsene Sohn machte eine Gärtnerlehre auf einem Betrieb in der Nähe. Er war aber selten zu Hause. Die Tochter wohnte in der Schweiz. Zum Glück gab es viele Kunden, die aus Freude an der Landarbeit, aus sportlichen Gründen oder als Status-Symbol öfters mithalfen. Unser Bauer jammerte oft genug, dass der Nahrungsmittelanbau es den Bauern heutzutage nicht mehr ermöglichte zu leben und dass er sich bald gezwungen sähe aufzuhören. Das brachte viele Kunden dazu, ihre Dienste anzubieten. Manchmal kamen sie scharenweise, und im Nu war ein Acker unkrautfrei. Auch waren wir nicht die einzigen jungen Leute, die eine ‚Praktikantenstelle‘ suchten. Fast jede Woche stellten sich neue vor, langhaarig wie wir, deren erste Erfahrungen mit der Landwirtschaft bisher bestimmt in der Aussaat ihrer Hanfkörner bestanden hatten, und die nun die Grundlagen der biologischen Landwirtschaft erlernen wollten. Es war wie eine Welle, wie eine Modebewegung, zurück aufs Land zu gehen! Viele von unserer Generation hatten vom Stadtleben genug oder suchten nach einer neuen, bewussteren Lebensweise. Die meisten hatten bei einem gemeinsamen Joint den Ruf der Natur gespürt. Sie alle kannten Tolkiens Bücher ‚Der Herr der Ringe‘ und die anderen. Der Beruf des Bauern, der vor einer Generation noch als unedel, als primitiv verachtet worden war, stand plötzlich als die ideale Lebensweise da, und der Bauer, bisher eher als Tölpel karikiert, wurde zum Vorbild einer neuen Generation…
Wir und unsere Freunde waren unpolitisch. Von den Politikern fühlten wir uns verraten. Erst als die ‚Grünen‘ auftauchten, gingen wir wieder wählen. Wir merkten in der Natur eine Änderung. Nicht nur, dass der Wald durch den sauren Industrieregen starb. Wissenschaftler hatten das Ozonloch entdeckt und trotz Verbot der Treibgase in Sprühdosen würde die Zerstörung der Erde weitergehen! Der ‚Club of Rome‘, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, hatte mit seinem Report über die Grenzen des Wachstums für ein leichtes, kurzzeitiges Interesse der Menschen an der Zukunft unseres Planeten gesorgt. Jedem von uns war klar, dass ein dauerhaftes Umdenken nötig war! Doch bald wurden die Warner wieder, gleich uns, als Spinner abgetan, und der Raubbau der Rohstoffe und die Verschmutzung der Luft, der Erde und der Meere ging weiter. Wir lasen das Buch ‚Der stumme Frühling‘ und ‚Ein Planet wird geplündert‘. Wir gaben die Bücher weiter, so wie die Zeugen Jehovas den ‚Wachturm‘ weitergaben. Doch die meisten nahmen uns nicht ernst, versuchten eher noch uns von unserer Lebensweise abzubringen. „Die Technik ist vielleicht schuld an einer Verschmutzung, doch nur die Technik kann diese auch wieder beseitigen. Und der Mensch hat sich bisher durch Mutationen angepasst, warum sollte er es nicht auch in Zukunft?“ Dem stimmten wir in gewisser Weise zu. Doch wären alle sozialen Ungerechtigkeiten und Umweltprobleme gelöst, würde dem Menschen durch Mutation das Gen der Habgier genommen werden!
In Bodenseenähe gab es genügend Menschen, die sich zur Anthroposophie bekannten oder zumindest dieser Geistesrichtung nahestanden und ihre Kinder auf die Waldorfschulen schickten. Das waren natürlich oft bessergestellte Leute, die es sich leisten konnten, auch ein Pferd zu haben oder höhere Preise für manchmal unansehnliches Gemüse zu zahlen. Sie kamen meist nach einem Ausritt bei uns vorbei, um ein Schwätzchen zu halten oder zu warten, bis der Hofladen aufmachte. Dann standen Mercedes und Porsche im Hof und es roch an allen Ecken nach Pferd. Unsere Bauern kümmerten sich um diese Kundschaft, wir zogen die Einfachheit der Feldarbeit vor. Am Freitagabend glich der Platz vor dem Verkaufsraum, je mehr sich die Tage längten und sich das Angebot vergrößerte, immer mehr einem bunten Kaleidoskop von Gemüse und Früchten. Diese glänzten nass vom Waschen und waren sorgfältig aufgeschichtet. Freitagabend war hier der Treffpunkt all derer, die nach bewusster Ernährung strebten. Kinder rannten umher oder knabberten eine (gekaufte) Möhre, während die Mütter Gemüse abwiegen ließen und den neuesten Nachrichten aus der anthroposophischen Welt lauschten. Männer sah man selten.
Der Samstags-Markt war der Höhepunkt der Arbeitswoche. Doch das war Angelegenheit der Bauern. Wir halfen nur, das Auto und den Anhänger zu beladen, meist spät in der Nacht, wenn die Kunden gegangen waren oder die Feldarbeit endlich zuende war. Und wir luden auch wieder ab, am Samstagnachmittag, während die Bauern ihr Mittagsschläfchen hielten. Wir sortierten den ganzen Blätterkram durch und legten noch Brauchbares wieder säuberlich in Kisten oder schnitten es neu zurecht, das Restliche war für die Schweine oder für den Kompost. Klar, dass wir den „Rücklauf“ nochmals sortierten, sozusagen in eine vierte Kategorie, nämlich in das, was wir essen wollten. Das war zwar gegen die Abmachungen, doch sahen wir wirklich keinen Grund, die Schweine damit zu mästen und selbst am Hungertuch zu nagen!