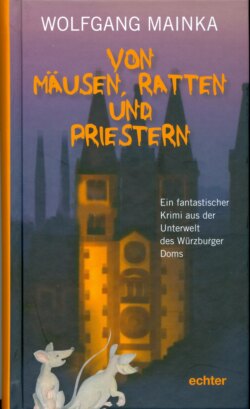Читать книгу Von Mäusen, Ratten und Priestern - Wolfgang Mainka - Страница 8
Vier Herren beim Frühschoppen in der „Himmelsleiter“
ОглавлениеZur selben Zeit, als die Morgenmesse im Dom begann, saßen nur einen Steinwurf entfernt vier ältere Herren in der verrauchten alten Weinstube „Zur Himmelsleiter“ in der Katharinengasse: der Apotheker Anton Feuerlein, ein großer, hagerer Endfünfziger mit bereits weißem Haar, Studiendirektor Meiseneier, schrulliger Gymnasiallehrer und anerkannte Autorität in Sachen Leben und Werk des romantischen Dichters Adalbert Stifter, der Kaufmann Bernhard Hüpsch, ein ausgewiesener Wein- und Frauenliebhaber, und Antiquitätenhändler Dr. Karl Plunder, profunder Kenner alter Damen und ihrer Nachlässe.
„Haben Sie gehört, liebe Stammtischbrüder, wir haben einen neuen Bischof bekommen“, informierte ein sichtlich erfreuter Professor Meiseneier die Runde: „Josef Kapellmann heißt er, kommt aus dem Rheinland und soll ein recht humorvoller Mensch sein. Und einen Spitznamen hat er bei den Würzburgern auch schon weg; sie nennen ihn ‚Happy‘, weil er so lustig ist.“
„Happy, das ist doch mal ein pfiffiger Name für einen Bischof. Der passt so gar nicht ins Bild der alten Betschwestern“, lachte Dr. Plunder. „Wenn ich an seinen Vorgänger denke, der war eher ein stiller, zurückgezogener Mann. Viel eher nach deren Geschmack.“
„Sehr richtig!“, pflichtete ihm Meiseneier bei. „Um es mit den Worten Adalbert Stifters zu sagen: Der Zustand war so nicht länger ertragenswert; man habe den Eindruck gewinnen können, es böte sich den Gläubigen ein katholisches Vakuum.“
Lachend erhoben die vier Herren ihre Weingläser und prosteten einander zu.
Das Honoratioren-Quartett versammelte sich jeden Sonntag zur Zeit der Morgenmesse in der „Himmelsleiter“. Sie nannten sich „Die Philosophen“ und über dem Stammtisch hingen, in Holz geschnitzt, die „Drei weisen Affen“ mit dem Schriftzug „Die Philosophen“.
„Liebe Cora, schenk uns noch eine Runde von dem vortrefflichen Silvaner vom ‚Escherndorfer Lump‘ ein – auf meine Rechnung“, rief Hüpsch hinüber zur Kellnerin, die am Schanktisch die grünstieligen Weingläser polierte. Die fesche Enddreißigerin war, was ihre Reize und den „Marktwert“ bei Männern anbetraf, schon etwas über dem Zenit, aber dennoch für die vier Herren wie die übrigen Gäste eine wahre Augenfreude. Vor allem der tiefe Ausschnitt des um eine Größe zu klein gewählten Dirndls ließ manch älteren männlichen Gast in Gedanken versinken: „O Herr, du nahmst mir leider das Können, so nimm mir bitte auch das Wollen!“
„Kommt sofort, meine Herren“, erklang Coras helle, freundliche Stimme.
Die „Himmelsleiter“, eine der ältesten Weinstuben der Stadt, führte ihren lustigen Namen nun seit mehr als hundert Jahren. Nach einer alten Anekdote hatte sie ihn von einer gewissen Jungfer Kathrin, die hier in der Katharinengasse einst eine Weinstube besaß. Sie war dank ihrer weiblichen Reize das Objekt manch männlicher Begierde, gleichwohl selbst aber sehr wählerisch. Besonders die Geistlichkeit hatte es ihr angetan und so kam der Großteil ihrer Gäste aus den nahen Kirchen und Klöstern. Das stete Ein- und Ausgehen von Kaplänen, Prioren, Domkapitularen und jungen Theologen zu jeder Tages- und Nachtzeit ließ in der Bevölkerung den Spruch aufkommen, in der Weinstube herrsche ein reges Treiben „wie auf der Himmelsleiter“. Und als Kathrin eines Tages einem rosigen Töchterlein das Leben schenkte, brachte dies die Gerüchteküche in der Stadt heftig zum Brodeln. Vor allem, weil sie den Kindsvater niemals benannte.
Als Kathrin später ihr Lokal aufgab und als Haushälterin bei einem Domkapitular in Dienst trat, sprach man von einem „Kardinalfehler“. Die Weinstube allerdings behielt auch danach den Namen „Himmelsleiter“ und die dralle Cora setzte Kathrins diesbezügliche Tradition in bester Manier fort.
„So, meine Herren, vier Mal der ‚Escherndorfer Lump‘, wohl bekomm’s!“, sprach Cora und senkte beim Servieren ihren Ausschnitt weit über den Tisch. Hocherfreut blickten Professor Meiseneier, Apotheker Feuerlein und Dr. Plunder auf den spendierten Trunk, Hüpsch hingegen in Coras tiefes Dekolleté.
„Ja, unsere ehrenwerten Bischöfe haben uns schon so manch merkwürdige Geschichte hinterlassen“, sinnierte Meiseneier und nippte am Silvaner. Dr. Plunder nickte.
„Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es in früherer Zeit doch ziemlich seltsam zuging, wenn ein neuer Bischof in sein Amt eingeführt wurde. Ganz anders als heute. Sagen Sie mal, Herr Professor, Sie als alter Historikus wissen doch sicher, wie das damals war!“
„Nun, es war schon recht ungewöhnlich, was sich im Mittelalter bei der Einführung des neuen Bischofs abspielte. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass diesen früher das Domkapitel aus den eigenen Reihen wählte. Das war die Versammlung aller Domherren, meist nachgeborene Söhne von Adelsfamilien aus dem Frankenland, die nicht in der Erbfolge standen und deshalb in die Würzburger Domschule geschickt wurden.“
„Die Töchter, die man nicht an den Mann bringen konnte, kamen ins Kloster“, warf Bernhard Hüpsch ein. „Und heute findet man sie im Café Michel!“, ergänzte Plunder.
„Wie war das aber mit der Einführung, Herr Professor, was passierte denn da Merkwürdiges?“, fragte Feuerlein neugierig.
„Ja richtig, mein Lieber, die Amtseinführung. Nun, der Neugewählte ritt an der Spitze seines Hofstaats von der Festung in die Stadt. Auf der Alten Mainbrücke wurde er vom Domkapitel empfangen und musste, es ist fast nicht zu glauben, alle seine Kleider ablegen und sich seines Schmuckes entledigen.“
„Nackt? Sagen Sie bloß, Meiseneier, der stand splitterfasernackt auf der Brücke!“, rief Hüpsch ungläubig. „Nicht ganz, denke ich“, beschwichtigte ihn Plunder, „die Unterhose wird er wohl noch angehabt haben.“
„Wer stand nackt auf der Mainbrücke?“, rief Cora von der Theke herüber. Ihr entging kaum ein Gespräch und das Thema machte sie natürlich neugierig.
„Der Bischof, Cora, der Bischof“, antwortete Hüpsch.
„Das glaub’ ich nicht. Sonst hätt’s bestimmt in der Main-Post gestanden“ – Cora blickte skeptisch zum Stammtisch und putzte weiter ihre Gläser.
„Meine Herren, bitte! Mit dem gebührenden Ernst! Wie dem auch sei, sein Pferd schenkte der Bischof dem Truchsess, so war es Brauch. Dann kleidete man ihn in eine grobe Kutte aus grauem Sackleinen und führte ihn mit einem Strick um den Leib an die Pforte des Domes. Dort angekommen, musste er vor dem Domdekan niederknien und um Einlass bitten. Nachdem er im Dom das Glaubensbekenntnis gesprochen hatte, wurde er in festliche Gewänder gekleidet und legte sodann an den vier Türen des Doms die Hände auf die Türringe zum Zeichen der Vermählung mit seiner Kirche.“
„Und warum soll der nackt gewesen sein?“ Cora war längst neugierig zum Tisch der Philosophen gekommen.
„Ach, meine liebe Cora, das war so ein Brauch im Mittelalter, wenn wir einen neuen Bischof bekommen haben“, beruhigte Meiseneier die Bedienung.
„Na ja, der Happy würde das sicherlich auch machen, wenn man ihm sagt, was bei uns früher so abging. Er soll ja ein lustiger Kerl sein und jeden Spaß mitmachen. Ich werde es ihm mal stecken, wenn er wieder zu mir kommt“, sprach Cora und entschwebte mit wippenden Hüften in Richtung Theke.
Die Blicke der Herren folgten jeder Schwingung ihres Körpers, nur Meiseneier schaute versonnen in sein Glas.
„Herrlich, bewegend und doch so anmutig“, strahlte Feuerlein. „Ja, die Tradition hat sich lange gehalten!“, murmelte Meiseneier. „Man kann gar nicht genug davon bekommen“, seufzte Hüpsch. Meiseneier fühlte sich geschmeichelt: „Wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen noch mehr davon.“
„Nur zu, lieber Professor, es ist eine wahre Augenweide“, stimmte Dr. Plunder seinen Stammtischbrüdern bei.
„Man wusste ja schon immer, dass der Bischof der reichste und mächtigste Mann der Stadt war“, warf Kaufmann Hüpsch ein, der sich nach Coras wahrlich formvollendetem Abgang wieder Meiseneier zuwandte. „Es würde mich mal interessieren, wie viel Vermögen der Bischof einst sein Eigen nannte.“
„Sicher war der Bischof früher der reichste Mann der Stadt und die Kirche hat ja heute noch den größten Grundbesitz von allen“, bestätigte der Professor und nahm einen Schluck Wein.
Am Tisch der Philosophen trat ein kurzes Schweigen ein. Meiseneier ließ genüsslich den Silvaner im Mund rollen, Feuerlein blies kleine Rauchwölkchen in den Himmel und Hüpsch starrte ins Nichts.
„Was, meinen Sie, Professor, ist wohl der kostbarste Besitz der Bischöfe?“, fragte Plunder mit wachsendem Interesse. Man merkte ihm an, dass ihn dieses Thema beschäftigte.
„Das lässt sich schwer sagen“, antwortete Meiseneier. „Geht man von dem aus, was für die Gläubigen eine Kostbarkeit darstellt, so kann man sicher die Gebeine der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan nennen, die in der Kiliansgruft begraben liegen.“
„Man spricht aber doch auch davon, dass es den Kelch des Abendlandes gibt, der im Altar des Doms aufbewahrt wird. Eine Kostbarkeit aus Gold von unschätzbarem Wert, ein Gefäß, das Wunder vollbringen soll“, ließ sich Plunder vernehmen.
„Kelch des Abendlandes, Wunder, Gold und Edelsteine, was hat das zu bedeuten? Sie machen uns neugierig, mein lieber Plunder. Jetzt aber auf den Tisch, was es damit auf sich hat“, forderte der Apotheker und ließ in kurzen Abständen weiße Wölkchen aus seiner Zigarre aufsteigen.
„Ja, man spricht viel von diesem Wunderkelch, aber etwas Genaues weiß ich eben auch nicht“ – der Antiquitätenhändler klang resigniert. „Aber vielleicht weiß einer von Ihnen mehr über diesen Wunderkelch?“
Man spürte förmlich, dass das Thema alle am Tisch zu interessieren begann und die Spannung allmählich wuchs. Die Herren schauten sich an, als erwarte jeder vom anderen eine Erklärung. Schließlich richteten sich die Blicke auf Meiseneier. Wenn einer etwas über das Geheimnis des Kelches wusste, dann ja wohl er. Der Studiendirektor hatte schon viele Bücher über die Geschichte der Stadt geschrieben und galt daher als Koryphäe auf diesem Gebiet.
„Nun ja, ein wenig weiß ich darüber Bescheid.“ Man merkte Meiseneier an, dass er nicht gerne über dieses Thema redete. „Nun kommen Sie schon, Professor“, drängte Bernhard Hüpsch, „heraus damit! Wir wollen jetzt wissen, was es mit dem Kelch auf sich hat!“
„Ja, dieser Kelch des Abendlandes hat eine merkwürdige Geschichte“, begann der so Bedrängte und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Dabei senkte er die Stimme, damit die übrigen Gäste ihn nicht verstehen konnten. Seine Tischgenossen lauschten andächtig, als er fortfuhr:
„Sie geht zurück bis zu Jesus und seinen Jüngern. Sie alle kennen ja die Geschichte vom letzten Abendmahl. Nachdem Jesus das Brot gebrochen und es den Jüngern als seinen Leib gereicht hatte, nahm er auch den Kelch, füllte ihn mit Wein und reichte ihn als sein Blut. Seitdem, so die Legende, besitzt der Kelch die Fähigkeit des Verwandelns. Das Geheimnis des Kelches, der seitdem ‚Kelch des Abendlandes‘ genannt wurde, liegt darin, dass sein Besitzer bestimmen kann, in was für ein Getränk, ein Heilmittel oder eine sonstige Flüssigkeit sich der Inhalt verwandeln soll.“
Atemlose Stille herrschte am Tisch und man hätte eine Stecknadel im Raum fallen hören können. Auch Cora schien am Schanktisch mit dem Polieren der Gläser beschäftigt zu sein und nahm keine Notiz vom Gespräch der Herren.
Die Philosophen steckten die Köpfe zusammen. „Heißt das etwa, wer den Kelch in Händen hält, kann sich jeden beliebigen Trank wünschen?“, flüsterte Hüpsch.
„Also könnte ich mir zum Beispiel jeden noch so teuren Rotwein, etwa einen 1947er Château Lafite oder einen Margaux aus dem sagenhaften Jahrgang 1899 wünschen? Wenn ich Wasser in den Kelch schütte, verwandelt es sich dann in meinen Lieblingswein?“
Hüpschs Augen glänzten. Jeder in der Runde kannte seine Leidenschaft für erlesene Rotweine und seine Kenntnisse auf diesem Gebiet waren im Freundeskreis bekannt und geschätzt. Er verfügte über einen vortrefflich sortierten Weinkeller, den er einmal im Jahr seinen Stammtischbrüdern öffnete. Voller Stolz präsentierte er dabei stets die Sammlung von Bouteillen aus dem legendären Hause Rothschild.
„Und ich wäre in der Lage, jede nur erdenkliche Medizin zu erschaffen und meinen Kunden jeden Wunsch nach Heilung zu erfüllen“, fieberte Feuerlein. Vor lauter Spannung und Aufregung hatte er vergessen, an seiner Zigarre zu ziehen, sodass diese zur Hälfte aus weißer Asche bestand.
„Ja sogar ein Elixier für ewige Jugend wäre möglich!“
„Und würde Sie als Besitzer des Kelches reich machen“, warf Hüpsch ein.
„Stellen Sie sich vor, Feuerlein, das spräche sich in der Stadt herum. Gar nicht auszudenken, welch einen Ansturm an Kunden Sie dann hätten. Alle würden doch nur noch bei Ihnen kaufen. Die anderen Apotheken könnten schließen.“
Stimmung kam auf in der Runde, ein Wort ergab das andere. Besonders Plunder lauschte erregt. Er hatte nicht erwartet, dass sein Halbwissen ob der Gerüchte um diesen Kelch zu solchen Gedankengängen führen würde.
„Unvorstellbar, was für ein Schatz sich in unserem Dom befindet“, murmelte er staunend.
„Weiß eigentlich die Kirche davon, mein lieber Meiseneier?“
„Ja natürlich ist dem Bischof und dem Domkapitel dieses Geheimnis bekannt, doch es wird streng gehütet. Ich selbst bin nur durch Zufall auf seine Spur gekommen, als ich in den alten Schriften der Dombibliothek Nachforschungen zur Geschichte der Bischöfe anstellte. Dabei stieß ich auf die Notiz eines Domherrn aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Schwedenarmee des Königs Gustav Adolf stand vor den Toren der Stadt und man befürchtete – zu Recht, wie sich später herausstellte –, dass es nach einer Eroberung zu Plünderungen kommen würde. Also wies der Domherr den Dompfarrer an, den Kelch des Abendlandes an einen sicheren Ort außerhalb der Stadt, in ein zum Hochstift gehörendes Kloster, zu bringen. Dabei berichtete er auch von der Wunderkraft des Kelches, erwähnte aber ebenso, dass nur ein redlicher Besitzer diese nutzen kann. Wollte man mit Hilfe des Kelches Unredliches, gar Böses bewirken, so würde der Kelch seine Wunderkraft versagen.“
„Und wie kam nun dieser Schatz ausgerechnet in unseren Dom? Würzburg liegt doch eindeutig nicht in Palästina und mir ist nicht bekannt, dass unser Bistum gute Beziehungen nach Rom gehabt hätte“, warf Feuerlein ein.
„Eine gute Frage“, nickte Dr. Meiseneier. „Ich habe seinerzeit nach dem Auffinden der Notiz eigene Nachforschungen über die Herkunft des Kelches angestellt. Und, meine Herren, ich kann Ihnen sagen, diese Geschichte ist so spannend wie ein guter Krimi.“
„Wer A sagt, muss auch B sagen, mein guter Meiseneier“, forderte Bernhard Hüpsch den Erzähler heraus: „Ein solch spannendes Stammtischgespräch haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Noch ist Zeit bis zum Mittagessen und eine gute Geschichte ist mir noch eine Runde Wein wert. Hallo Cora, bring uns eine Flasche von deinem besten Tropfen!“
„Ich hätte da noch einen Bocksbeutel Riesling Spätlese Jahrgang 1981 von der Harfe aus dem ‚Würzburger Stein‘, wahrlich ein Göttertrank, meine Herren“, rief Cora vom Schanktisch herüber.
„Her damit!“ Bernhard Hüpsch war ganz euphorisch. „Wir haben wahrlich Anlass für einen guten Tropfen!“