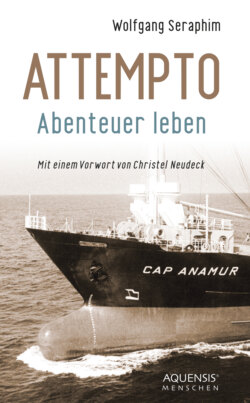Читать книгу Attempto - Wolfgang Seraphim - Страница 17
Winter 1945 – 1947 Zur Großmutter nach Esslingen oder Paradies ade – Hunger tut weh!
ОглавлениеWie alles, das sich so glücklich anfühlt: Eine nur allzu schnell vorbeirauschende Gegenwart mutiert in ein Stück goldene Vergangenheit. „Glück ist, kaum hat man es empfunden, ein Zustand, welcher rasch entschwunden.“ Nicht Wilhelm Busch, sondern Wolfgang Seraphim, Jahrzehnte später als Reim kreiert – oder eventuell doch nur ein zweites Mal von mir nach Busch aus der Taufe gehoben? In Murrhardt ein Leben voll Abenteuer und Herausforderungen ohne erkennbare Verpflichtungen. Als eines Tages ein Brief von der Großmutter mütterlicherseits aus Esslingen bei Stuttgart eintraf. Mit ihm kündigte sich der nächste Wechsel in eine andere Welt an. Der Brief war ein einziger Hilferuf der betagten Großmutter, die sich in ihrem Einfamilienhaus, ohne den vier Jahre zuvor gestorbenen Ehemann, den komplizierten Anforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen sah. Man ahnte, dass die bisher so fantastisch funktionierende Lebensmittelversorgung mit dem Umzug nach Esslingen in ein völlig neues Stadium treten würde. Ohne allerdings vorherzusehen, wie dramatisch sich die Dinge entwickeln sollten. Für meine Mutter war auf jeden Fall völlig klar, sich dem Ruf ihrer Mutter nicht verschließen zu können. Sie wollte es auch nicht: Die Vorgaben ihrer in jungen Jahren genossenen Erziehung ließen ihr gar keine andere Wahl.
Bei den wenigen Dingen, die von Freystadt gerettet und den noch bescheideneren Neuerwerbungen aus Murrhardt, gestaltete sich der Umzug nicht problematisch. Nur die Zugverbindungen glichen immer noch einem Lotteriespiel: Man erfuhr zwar auf Nachfrage, in welche Richtung der auf dem Bahnsteig stehende Zug fahren sollte, aber nicht, wann er abfahren und wie weit er letztendlich fahren würde. Oft blieb man stundenlang auf freier Strecke stehen – Blümchen pflücken während der Fahrt verboten …
Die Großmutter war eine Seele von Frau, die ohne groß darüber zu reden, ein überzeugtes Christentum vorlebte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie jemals über einen anderen Menschen ein böses Wort verlor. „Unser Herrgott hat gar mancherlei Kostgänger.“ Dieser verschmitzt lächelnd vorgebrachte Satz gehörte zu ihren schärfsten Waffen offener Kritik. Unausgesprochen stand dahinter die Mahnung: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.“ Es gab keinerlei Anpassungsprobleme. Im Gegenteil, ich hatte die liebevolle Frau bald in mein Herz geschlossen, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte. Meisterhaft erzählte sie spannend biblische Geschichten – Frucht detaillierter Bibelkenntnis. Hatten sie doch in ihrer langjährigen, glücklichen Ehe Abend für Abend zusammen ein Kapitel nach dem anderen in der Familienbibel gelesen und auf diese Weise das dicke Buch mehrfach von vorne bis hinten durchgeackert. Sie war vielleicht nicht überdurchschnittlich gebildet, weil das nach Stand und Herkunft als Tochter der Wirtin aus dem „Gasthaus zum Rössle“ in einem kleinen Nest auf der Schwäbischen Alb zu damaliger Zeit gar nicht im Bereich des Möglichen lag. Sie hatte etwas viel Wertvolleres: Die tief von innen ausstrahlende unaufdringliche Herzlichkeit einer weisen Frau. Sozusagen ein wandelnder Beweis der Botschaft von Blaise Pascal, dass das Herz eine Vernunft hat, die der Verstand nicht kennt. Sie trug ihre Frömmigkeit nicht wie eine Monstranz vor sich her. Aber sie hat sie still und unaufdringlich gelebt. Sie hatte viel Humor und konnte sehr herzhaft lachen – auch über sich selbst. Noch nach Jahrzehnten keine Erinnerung an sie ohne ihre Lachfalten vor Augen. Alles an ihr war einfach, unkompliziert und authentisch. Kurzum eine Frau, die auf den Entwicklungsprozess eines jungen Menschen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss nahm. Ohne sich von ihr erzogen zu fühlen. Als sie drei Jahre später, 1948, für immer die Augen schloss, empfand ich zum ersten Mal tiefe Trauer. Am Morgen grub sie im kleinen Garten hinter dem Haus noch etwas Land um. Nach dem Mittagessen legte sie sich in ihr Bett: „Ich bin ein bisschen müde“. Es waren ihre letzten Worte. Sie hatte sich ganz leise von dieser Welt verabschiedet. Unspektakulär, wie ihr Leben – authentisch bis in den Tod. Als sie die Mutter zwei Stunden später wecken wollte, hatte sie sanft die Reise in eine andere Welt angetreten. Ein schöner Tod, wie sie sich ihn immer gewünscht hatte …
Entsprechend der allgegenwärtigen Wohnungsnot hatte die Großmutter noch ein kinderloses Ehepaar im Haus aufnehmen müssen. Das Miteinander auf nicht großzügig bemessenem Raum war keineswegs konfliktfrei. Der Herr der Schöpfung sprach gelegentlich, mehr als ihm guttat, dem Alkohol zu. Eigentlich nicht problematisch, wenn er sich dabei auf sein stilles Kämmerlein zurückgezogen hätte. Leider fühlte er sich aber im daraus resultierenden Hochgefühl eher ermuntert, in freie Wildbahn auszubrechen. Unbeschadet der Anwesenheit seiner eigenen Ehefrau, begann er der Kriegerwitwe aus Schlesien heftige Avancen zu machen. Erst nachdem man mehrfach auf dem Wohnungsamt der Stadt vorstellig geworden war, gelang es, die Leute auszuquartieren. Im Gegenzug wurde umgehend ein anderes kinderloses Ehepaar zugewiesen: Flüchtlinge aus Mährisch Ostrau, die sich durch ungebremsten Knoblauchverbrauch auszeichneten. Dieses offenbar unverzichtbare Symbol böhmisch-ungarischer Kochkunst sollte als penetranter Duft jedenfalls noch über Jahre, beinahe täglich, durch alle Ritzen des Hauses ziehen …
Der kleine Garten hinter dem Haus, so wichtig er in Zeiten der Not auch war, er reichte in keiner Weise, die Zahl der hungrigen Mäuler zu stopfen. Unvergessen der erste Gang in den Vorratskeller nach gemeinsamer Ankunft in Esslingen. Inmitten eines geräumigen Gewölbekellers mit gestampftem Boden lag ein nur noch handbreit gefüllter Kartoffelsack, dessen weitgehend leere Hülle traurige Falten warf. In einer kleinen Holzkiste standen einsam drei Marmeladengläser. Unweit daneben einige wohl verkorkte, völlig verstaubte Flaschen: Gefüllt mit noch vom Großvater angesetztem Beerenwein. So deprimierend leer und öd er sich auch präsentierte, es war der schlechthin ideale Vorratskeller, wie ihn heutzutage leider niemand mehr baut. Ein Vorratskeller ohne Vorrat. Als Jahre später wieder Normalität in die Versorgungsstrukturen einkehrte, ließ sich hier völlig problemlos über die Winterszeit Obst und Gemüse einlagern: Es schimmelte und faulte nicht, bekam auch keine Runzeln.
Das Haus lag zwischen zwei Kasernen, der Funker- und der Becelaire-Kaserne, die nur ca. 500 Meter voneinander entfernt im sogenannten Gebiet „Hohenkreuz“ oberhalb der Burg standen. Daran anschließend der nächste Esslinger Vorort „Wäldenbronn“. Dorthin musste zur Gärtnerei Rayer pilgern, wer zur Gemüsezeit selbiges gegen Geld zu erstehen versuchte. Das „Erstehen“ war durchaus wörtlich zu nehmen: Um einigermaßen Aussicht auf Erfolg zu haben, begab man sich morgens gegen sechs Uhr auf den Weg. Nach ca. 40 Minuten konnte die Gärtnerei gar nicht verfehlt werden: Erkennbar an einer langen Menschenschlange, in die ich mich in den Sommerferien geduldig einreihte, um stundenlang zu warten, bis ich meine leere Einkaufstasche präsentieren durfte. Unsinnig die Vorstellung, eventuell einen Wunsch zu äußern. Genommen wurde, was es gab und wie viel es gab – wenn es überhaupt etwas gab. Nicht selten blieb der Betrieb einfach geschlossen, man hatte dann bewegungsmäßig etwas für seine Gesundheit getan. Jedenfalls konnte ich mich nicht daran erinnern, zu irgendeinem Zeitpunkt einmal Schwierigkeiten mit dem Heimtransport der Einkaufstasche gehabt zu haben. Ihr Gewicht sprengte nie den kindgerechten Rahmen, so sehr man sich das auch gewünscht hätte.
Der Broteinkauf gestaltete sich, was den Anmarsch betraf, nicht zeitaufwendig. Die Einkaufsquelle – Bäckerei Konzelmann – lag nur wenige Meter vom Haus entfernt. Gegenüber der Funker-Kaserne, strategisch günstig gelegen. Die Länge der Warteschlange stand allerdings der vor der Gärtnerei in nichts nach. Auch die Milchquelle war nicht weit von zu Hause, gegenüber der Becelaire-Kaserne, bequem erreichbar. Erstaunlich, dass es hier keinen Engpass zu geben schien: Ohne allzu langes Warten wurde – wie beim Brot gegen Marken versteht sich – die leere Milchkanne gefüllt. Es war Magermilch mit der untrüglich blass-blauen Farbe, die jedes eventuell noch anzutreffende Fettmolekül ausschloss. Wurst gab es keine, manchmal aber in der Metzgerei eine seltsame Mischung undefinierbaren Inhalts in Cellophan gepresst. Quell sehnsüchtiger Erinnerung an goldene Zeiten der „Sonne-Post“ in Murrhardt. Trockenes Brot, scheibenweise rationiert, gelegentlich mit dünnem Aufstrich selbst gemachter Marmelade, kaschierten notdürftig allgegenwärtige Hungerattacken. Mittags versuchte die Mutter eine mit Brot und Gemüse angereicherte Maggi-Brühe nicht allzu kalorienarm auf den Tisch zu bringen. Abends gab es meist Dickmilch in kleinen Schälchen und für jeden drei kleine oder zwei größere Pellkartoffeln. Es dauerte nicht allzu lange, dann zeigte die Mangelernährung deutliche Spuren. Ich bekam eine Kinderkrankheit nach der anderen: Masern, Scharlach, Keuchhusten, Mumps mit begleitender Orchitis. Eine Art Pemphigus mit großen Eiterbeulen auf behaartem Kopf, aber auch am Oberschenkel. Hiob lässt grüßen. Ich entwickelte den klassischen aufgetriebenen Hungerbauch mit Wassereinlagerung in den Beinen. Oberhalb des Nabels konnte man jede einzelne Rippe zählen. Wie frisch aus Biafra importiert. Den Geschwistern und Erwachsenen ging es auch nicht besser …
In dieser recht verzweifelten Situation entschloss sich die Mutter, betteln zu gehen. Es gelang ihr, einen Lastwagen aufzutreiben, der nach Stuttgart fuhr und uns zusammen auf der Ladefläche mitnahm. Wir hielten uns auf den dort gestapelten Milchkannen fest und hofften, dass das klapprige Gefährt unterwegs nicht schlapp macht. Der alte Holzvergaser überschritt wohl nur selten seine Grundgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern und musste besonders vor Steigungen durch kräftiges Stochern mit einem Metallstab an der Vergaserklappe zu Höchstleistungen stimuliert werden. Dann stolperte der kleine Junge an der Hand der Mutter auf der Suche nach einer ominösen Adresse, die zu einer Metzgerei führen sollte, durch das völlig zerbombte Stuttgart. In den Ruinen hockten, im Schatten gespenstisch in den Himmel ragender Mauerreste, müde wirkende Frauen verschiedenster Altersgruppen in abgerissenen Klamotten und klopften mit Hämmern gegen in der Hand gehaltene, aus dem Schutt aufgelesene Ziegelsteine. Bescheidener Beitrag zur Gewinnung von neuem Rohmaterial für den dringend notwendigen Wiederaufbau. Nur klopfendes Hämmern drang an das Ohr, sonst schien die Großstadt akustisch ausgestorben: kein Motorenlärm eines Autos oder sonstiges geschäftiges Klappern. An verrußten Hauswänden, die kein Innenleben mehr kannten, standen flüchtig eingeritzte Mitteilungen: Namen mit dem lapidaren Zusatz „noch am Leben“ oder „bei Tante Erna“. Nicht selten auch: „Familie Müller“ und dahinter ein Kreuz.
Ich erinnerte mich an das Happening auf grüner Wiese mit der Phosphorbombe in Freystadt und der Schippe Sand als Patentlösung. Beim Weiterstolpern an der Hand der Mutter summte ich leise vor mich hin: „Am Abend auf der Heide, da küssten wir uns beide …“. Die Mutter fand das der Lage entsprechend unangemessen – ich erntete einen strafenden Blick. Jahre später bekam ich ein Buch mit dem Titel „In Stahlgewittern“ eines gewissen Ernst Jünger in die Hand. Dort war von heldenhaften, kampferprobten Lichtgestalten die Rede, die weder Tod noch Teufel fürchteten. Bei seiner Lektüre musste ich unwillkürlich an meinen Marsch durch das zerbombte Stuttgart denken. Es wurde mir klar: Sinn und Unsinn vieler Bücher erschließen sich dem Leser in Abhängigkeit seiner Lebenserfahrung. Wenn ich an Helden dachte, standen diese Trümmerfrauen vor mir. Die „Lichtgestalten“ des Herrn Jünger schrumpften zu bedauernswerten Würstchen, die ihnen unbekannte Menschen massakrierten. Dies alles angestiftet von Figuren, die immerhin meist so klug waren, selbst ungefährdet hinter dem warmen Ofen sitzen zu bleiben, während „auf dem Feld der Ehre“ in ihrem Namen verstümmelt und gestorben wurde. Bestürzend und ernüchternd zugleich: Der Vorgang hatte nichts Einmaliges an sich, er zog sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des „Homo sapiens“ – wer gab nur diesem Erdbewohner, dessen humanitäres Handeln seine evolutionäre Lücke demonstriert, solch irreführend hochtrabenden Namen? „Homo homini lupus“ – der Mensch ist des Menschen Wolf.
Derlei Gedankengänge beim Gang durch Stuttgart waren mir natürlich fremd und schnuppe. Ich hatte Hunger, war müde und quengelte. Die Anlaufstelle Metzgerei, betrieben von einer um viele Ecken mit der Esslinger Großmutter ververwandten Familie, erwies sich nicht nur als schwer auffindbar, sie entpuppte sich auch sonst in keiner Weise als Hauptgewinn im „Nahrungsmittel-Lotto“. Mühsam wurde der Verwandtschaftsgrad auseinander klamüsert. Das Ergebnis muss so ernüchternd gewesen sein, dass für die zwei einfallenden hungrigen Gestalten nur eine dünne, von jeglicher Fleischeinlage ungetrübte Wassersuppe nebst einer mal etwa fingerlangen Blutwurst als Wegzehrung für den Heimweg heraussprang. Zu Hause erwies sich die Wurst in erster Linie knorpelhaltig. Es war offensichtlich keine sehr gute Idee, zu diesen Zeiten von einer Stadt in eine noch größere Stadt zwecks Nahrungssuche zu pilgern. Außerdem reifte in mir schon in sehr jungen Jahren die Erkenntnis, dass ganz entfernte Freunde in der Not eine verlässlichere Stütze sein konnten als mehr oder weniger nahe Verwandte. Murrhardt hatte da guten Anschauungsunterricht geliefert.
Jedenfalls besann man sich nach diesem Ausflug auf ortsnähere Gefilde, z. B. die Region um Katharinenlinde und Jägerhaus. Beide in Spaziergangnähe des großmütterlichen Hauses. Im Herbst Fundstelle von Bucheckern, die mühsam vom Boden aufgeklaubt, in der Ölmühle gegen Öl eingetauscht wurden. In derselben Gegend beheimatete Eichen sorgten zu damaliger Zeit, dank Abschuss der Wildschweine und sonstigem Wild, als Nahrungsquelle für Zweibeiner. Auf dem Bollerofen geröstete Eicheln verloren ihre Bitterstoffe. Das aus ihnen mit Hilfe einer Kaffeemühle gewonnene Mehl konnte mittels Salz- und Wasserzusatz zu einer Art Brot gebacken werden. Dessen Geschmack wurde unter dem Motto: „Der Hunger treibt es rein“ mit dementsprechender Begeisterung konsumiert. Solange das Gebäck schwer wie Blei im Magen schlummerte, bewahrte es vor bohrendem Hungergefühl. Eine alternative, sozusagen edle Variante, bestand in der Anreicherung des Eichelmehls mit süßem Rübensirup. Letzteren gab es damals auch nicht beim Kaufmann um die Ecke. Aber dessen Grundsubstanz, die Zuckerrübe, war im Herbst mit etwas Glück durchaus aufzutreiben. Wohl dem, der da in seiner Behausung stolzer Besitzer eines großen Kupferkessels war, wie er in Großmutters Keller stand. Wo sonst jeden Samstagnachmittag ein lustiges Feuerchen unter dem Kessel für warmes Badewasser in einer kleinen Zinkwanne sorgte, schwammen Zuckerrübenschnitzel mit Wasser vermengt über dem Feuer. In stundenlanger mühsamer Prozedur, ständig mit einem großen Holzstab rührend, gelang es, dem Rohprodukt seine süßen Seiten zu entlocken. Ein dunkelbrauner, klebrig-zäher Sirup mit unverwechselbarem Geschmack hart an der Grenze zu leicht verbranntem Karamell. Natürlich wuchs das dafür benötigte Brennholz auch nicht um die Ecke. Es musste mühsam auf einem altersschwachen Leiterwägelchen aus dem Wald herbeigeschafft werden. Dieser war von frierenden Zeitgenossen bereits nach Brennbarem durchforstet worden, und zwar umso intensiver, je näher er einer menschlichen Behausung stand. Leider ließ der liebe Gott nicht so viele morsche Zweige wie wünschenswert von den Bäumen fallen. So mutierten die rassereinen Arier, wo immer sie konnten, vorübergehend zu einer Nation der Sammler und Holzfäller. Vom Größenwahn ein Schritt zurück Richtung Steinzeit.
Dieser aus der Not geborenen Leidenschaft fiel in Esslingen gegenüber der Becelaire-Kaserne ein Baumbestand zum Opfer, der unter dem Namen Palmscher Park zum Besitz einer einst hochherrschaftlichen Familie gehörte. Die Stadtverwaltung ließ die uralten, teils gewaltigen Baumriesen fällen, deren Holz versteigern. Das dazugehörige Land, in Parzellen aufgeteilt, wurde an Bürger zur Anlage von Schrebergärten verpachtet. Diese nur wenigen Quadratmeter großen Gärtchen waren natürlich heiß begehrt. Kleiner Schönheitsfehler: Die Pächter mussten zuvor die Baumwurzeln in Eigenarbeit aus dem Boden wuchten, ehe an eine Bebauung des Grundstücks zu denken war. Es entpuppte sich als Sisyphusarbeit, mehr Kraftreserven fordernd als durch Gemüseanbau zu gewinnen. Die Axt federte auf dem mühsam im Erdreich freigelegten Wurzelwerk zurück, durchtrennte das Holz oft erst nach dem wuchtig geführten fünften oder sechsten Hieb. Der noch verbliebene Reststamm war, nur mittels Eisenkeilen zerlegt, in eine der Ofenöffnung zugängliche Portion zu zerlegen. Der anfängliche Jubel über unverhofftes Pächterglück erwies sich als verfrüht. Zu allem Übel entwickelte sich der Sommer im Jahre 1947, an dem erstmals die harte Arbeit Früchte tragen sollte, zu einem sogenannten „Jahrhundertsommer“. Zwei Monate lang brannte jeden Tag, den Gott werden ließ, von morgens bis abends gnadenlos die Sonne vom Himmel. Drohten all die mühsam erworbenen, in den Boden gebetteten Pflänzchen, zu verdorren. Vor zentraler Wasserzapfstelle sammelten sich morgens und abends ganze Menschenschlangen mit Eimer und Gießkanne, um das dürftig aus dem Hahn tröpfelnde Nass oft hunderte von Metern zum bebauten Grundstück zu schleppen. Dort sog es der durstige Boden in geradezu unverschämter Geschwindigkeit in sich auf. So fiel die Ernte erwartungsgemäß nicht üppig aus. Obendrein musste das, was die Sonnenglut heil überstand, in nächtlicher Dunkelheit vor diebischem Zugriff mit Schlagstock und anderweitig martialischem Gerät mutig verteidigt werden. Zu diesem Zweck gründete man einen nächtlichen Wachdienst, der in wechselndem Turnus zu mehreren, mit Trillerpfeifen zusätzlich ausgerüsteten Personen das Areal bewachte. Oft genug fehlte am nächsten Morgen dennoch die am Abend zuvor noch halbreife Tomate, die man im Geiste schon vorweg genüsslich geerntet und verspeist hatte. Wilde Verdächtigungen kursierten ob solch schmerzlicher Verluste. Hatte die Aufsicht ihr Mandat zum unerwünschten Erntehelfer ausgeweitet oder einfach nur geschlafen, statt zu bewachen? Wie auch immer: Mir erschloss sich die ganze Wucht von Gottes Wort gegenüber Adam und Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies – „im Schweiße Eures Angesichtes sollt ihr …“ – in sehr anschaulicher Weise. Mit dem Herrn war offensichtlich nicht gut Kirschen essen, wenn in grauer Vorzeit das erste menschliche Pärchen am Baum der Erkenntnis verbotswidrig genascht hatte. Warum allerdings auch denjenigen das Verdikt in voller Härte traf, dem solch fürwitzige Erkenntniswut auch ohne vorhergehendes Verbot nie in den Sinn gekommen wäre, blieb unbegreiflich. Die Brücke zwischen Ursache in grauer Vorzeit und harter Realität in der Gegenwart erschien zu lang, um daraus eine für mich nachvollziehbare Kausalität zu basteln. Später lernte ich, dass der Theologe in diesem und ähnlich gelagerten Fällen mit der Erklärung aufzuwarten pflegte, dass Gottes Gerechtigkeit eben eine andere sei, als die des Menschen. Wer wollte da widersprechen? Zu solch tiefgründiger Erkenntnis hätte es keines Theologen bedurft. Mich hätte weiter brennend interessiert, warum Gott der Herr das so eingerichtet hat? An dieser Frage hatten sich schon vor Thomas von Aquin die Scholastiker abgearbeitet. Er selbst war unversehens wieder am Baume der Erkenntnis angelangt. Nein, eine Verbannung aus dem Paradies genügt. Man muss das Spielchen ja nicht unaufhörlich weiter treiben.
Nicht nur der Kampf um das tägliche Brot war wenig paradiesisch. Es gab auch andere hart umkämpfte Errungenschaften des Daseins, wie zum Beispiel Schnürsenkel. Sie sprengten den Etat eines Sozialhilfeempfängers zu damaliger Zeit. Der Versuch auf Ersatz auszuweichen, z. B. durch Verwendung eines Bindfadens, erwies sich als untauglich. Bei Regen löste sich die aus Zellulose zusammengezwirbelte Nachkriegsware in Wohlgefallen auf. Nun gab es schon damals auf dem Sozialamt für solche Härtefälle die Möglichkeit des Erwerbs eines Bezugsscheines. Zum Nachweis eines wahrhaft vorliegenden Härtefalls bedurfte es allerdings eines gewissen, peinlich genau einzuhaltenden Rituals: Der verschlissene Schnürsenkel war dem Beamten unaufgefordert bei Beantragung von Ersatz vorzulegen. Hoffnung auf Bewilligung war nicht nur daran gebunden, dass man sich als Sozialhilfeempfänger auswies. Zusätzlich musste der Schnürsenkel zuvor mindestens viermal gerissen und wieder verknotet sein, um vor den gestrengen Auflagen der Sozialgesetzgebung die Anerkennung seiner Hinfälligkeit zu erlangen. Noch heute unvergessen die zitternde Hand der Mutter, mit der sie die traurigen Restbestände eines Schnürsenkels dem Beamten über den Tisch schob. Der Herr trug Schnurrbart, fingerte aus der Schublade ein Vergrößerungsglas und begann, andächtig das Corpus delicti im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe zu nehmen. „Scheint ja tatsächlich verschlissen und nicht durchgeschnitten zu sein“, ließ er sich endlich vernehmen. „Wir kennen ja unsere Pappenheimer, die sich vorzeitig den ungerechtfertigten Bezug von Volksvermögen ergaunern wollen“, fügte er wie zur Entschuldigung erklärend hinzu, während die Lupe wieder in der Schublade verschwand. Die Wortwahl stammte noch aus dem „Tausendjährigen Reich“, war noch nicht in der bitteren Realität späterer Zeitrechnung angekommen. Ich beobachtete aus den Augenwinkeln die Reaktion der Mutter. Erhaschte nur ein kaum merkliches Zittern der Oberlippe, auf der ein paar kleine Schweißperlen standen, die sie sich schnell mit dem Handrücken wegwischte. Es war ein tiefer Fall von der Frau eines angesehenen Arztes mit dienstbaren Geistern, Haus und Garten hinab zur alleinstehenden Sozialhilfeempfängerin mit drei Kindern. Inzwischen brachte das verbeamtete Gegenüber ungemein schwungvoll seine fast den ganzen Bezugsschein einnehmende, großspurige Unterschrift auf das kleine Stück Papier und reichte es mit der Geste eines Menschen, der soeben ein Vermögen verschenkt hat, über den Tisch. Den Bezugsschein für einen einzigen Schnürsenkel, versteht sich. Hätte sich der Schnürsenkel zu einem Paar verdoppelt, der Sozialstaat wäre womöglich aus den Fugen geraten. Seit dieser Zeit besteht für mich eine, genau besehen, durch nichts gerechtfertigte Aversion gegen Verwaltungsbeamte mit Oberlippenbärtchen, bei gleichzeitig raumgreifender Unterschrift. Ob man mit Gottes Gerechtigkeit doch besser bedient ist als mit der menschlichen Variante? Dem Beamtentempel entronnen macht der angestaute Groll Luft: „Ich hätte den Kerl in der Luft zerreißen mögen. Wie hältst du einen solch demütigenden und beleidigenden Umgang nur aus?“ Die lächelnd gegebene Antwort der Mutter blieb ebenso tief im Gedächtnis wie das Geschehen zuvor: „Mein Junge, wer mich beleidigt, bestimme ausschließlich ich selbst, sonst niemand!“ Welch wunderbarer Schutz vor der Nichtigkeit kleiner Geister und deren bewusst oder unbewusst in Szene gesetzten Bosheiten. Derart in Drachenblut gebadet spielt auch keine Rolle mehr, wenn bei Einlösung eines solchen Bezugsscheins dem Verkäufer im Laden gleich signalisiert wird: Hier bekommt ein Sozialhilfeempfänger, was ihm großzügig gewährt wird. Obendrein winkt dem Ladenbesitzer statt Gewinn nur lästige Lauferei. Er muss auf dem Sozialamt nachweisen, dass der von ihm als Vorschuss gewährte Verkaufspreis nach Abzug einer angemessenen Bearbeitungsgebühr durch das Amt nicht als Wucher ausgelegt werden kann. Kein Wunder, dass der Mutter erst im fünften Laden gelang, ein Stück Papier in einen Schnürsenkel zu verwandeln.
Auch die Möblierung des Esslinger Hauses war natürlich nicht auf die zusätzliche Unterbringung von vier Personen eingestellt. Im Gebrauchtmöbelmarkt wurden an Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger kostenlos Einrichtungsgegenstände ausgegeben, die sich allerdings in einem solch traurigen Zustand befanden, dass ihre Integrierung in das eigene Lebensumfeld große Überwindung kostete. Im Volksmund sprach man von „Wanzenholz“, das vor Aufstellung in der Wohnung erst peinlicher Säuberung mit Lauge und Wurzelbürste unterzogen werden musste. Aber es war natürlich besser als nichts. Obendrein für die Stadtväter zu damaliger Zeit eine beachtliche Leistung, solch eine Einrichtung auf die Beine zu stellen. Viele Jahre später landete eine Kommode dieser Herkunft, blau angestrichen, in meinem ersten Hausstand. Sie blieb mir auch bei mehreren Umzügen treu.
Provisorien, laut Stresemann durch besondere Langlebigkeit charakterisiert, dominierten das Zeitgeschehen. Es galt nicht nur für Besiegte. Auch Sieger mussten sich damit auseinandersetzen. Als provisorisch entpuppte sich zum Beispiel auch der Einzug des französischen Militärs in die Funker-Kaserne, die sie schon vor Monaten in Beschlag genommen hatten. Eines Nachmittags fuhren amerikanische Armeefahrzeuge vor die Kaserne, denen der Einlass verwehrt wurde – die Schranke blieb geschlossen. Gespannt harrte ich mit Spielkameraden der Dinge, die da kommen sollten. Es entwickelten sich allerlei diplomatische Aktivitäten. Französische und amerikanische Offiziere redeten heftig gestikulierend aufeinander ein. Die Amerikaner bemühten ihr Feldtelefon, offensichtlich mit dem Ziel, sich höheren Orts bezüglich des weiteren Procedere abzustimmen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Der amerikanische Konvoi zog sich um einige Meter zurück. Sandsäcke wurden aus den Lastkraftwagen abgeladen, zu einer Barrikade aufgeschichtet und einige Geschütze dahinter in Stellung gebracht – Zielrichtung Kaserne. Die Kinderschar hielt es jetzt für angemessen, den Rückzug anzutreten. Zwar nicht restlos, dafür war die Angelegenheit viel zu spannend. Aber doch in einen zurückliegenden Garten, aus dem der weitere Verlauf beobachtet werden konnte. Die Geschütze waren offensichtlich zunächst nur als Drohgebärde gedacht, sie wurden wohl noch nicht einmal geladen, verfehlten aber doch nicht ihre Wirkung. Nach ungefähr einer halben Stunde, die wie eine Ewigkeit vorkam, erschienen am Kasernentor einige französische Offiziere in schicken Uniformen mit ordensgeschmückter Brust und einer weißen Fahne. Die amerikanischen Offiziere beschränkten sich auf schlichtes Olivgrün, verzichteten auch auf jegliche Fahne und traten erneut in Verhandlungen ein, die jetzt aber sehr kurz ausfielen. Die Franzosen gewährten Einlass und räumten am Tag danach sang- und klanglos das Feld. So alliiert, wie es das Wort vorgibt, waren die Alliierten wohl doch nicht. Zumindest gab es vereinzelt Schnittstellen, die Irritationen hervorriefen, wie das Gesehene zeigt.
Kurz darauf begannen die Amerikaner Wohnungen für ihre Offiziere in der Flandernstraße zu requirieren. Ihr Vorgehen war nicht gerade zimperlich. Sie klingelten auch am Haus der Großmutter, murmelten Unverständliches in ihren nicht vorhandenen Bart, schoben die Bewohner einfach zur Seite und stapften durch das ganze Haus. Es missfiel offensichtlich das fehlende Bad, weshalb sie wortlos wieder abzogen. In Krisenzeiten kann eine bescheidene Raumausstattung ungeahnten Vorteil bedeuten. Gegenüber wohnenden Nachbarn ging es weniger gut: Zwei Häuser mussten innerhalb vierundzwanzig Stunden geräumt werden. Den Herren Siegern war schnuppe, wo die Besiegten Unterschlupf finden. In eines der Häuser durften die Besitzer nach zwei Jahren wieder einziehen, das andere blieb länger beschlagnahmt. In ihm wohnte noch viele Jahre ein amerikanischer Offizier mit Weib und zahlreicher Kinderschar. Letzteren bereitete es besonderes Vergnügen, das Autodach des Vaters zu erklimmen und als Trampolin umzufunktionieren. Das Blech bog sich wie eine zusammengedrückte Schuhcremedose und schnellte mit metallischem Klirren wieder nach oben. Die Kinderseele jauchzte. Alle vier Wochen rückte der Vater dem Haarwuchs seiner Söhne zu Leibe. Er bediente sich eines Maschinchens, das in wenigen Minuten Kind für Kind zu einer Glatze verhalf. Je nach Wetterlage fand die Schur vor der Haustüre oder in der Wohnung statt. Amerika präsentierte sich nicht als Hort besonders gepflegter Konventionen. Aber es beeindruckte doch ein Stück weit durch viel ungeniert offen zur Schau gestelltes Selbstverständnis.
Die Segnungen des Marshallplanes sollten erst später ihre Wirkung entfalten. So auch die nach Herrn Hoover benannte Schulspeisung. Wie der Name sagt, bedurfte es zur Erlangung solcher Köstlichkeit des Schulbesuchs. Der führte in die am Marktplatz gelegene Esslinger Waisenhofschule. Sie konnte von zuhause über die Beutauklinge oder, etwas romantischer mit kleinem Umweg, über die Burg erreicht werden. Weglänge ca. 2 km bergab auf dem Hinweg. Der Rückweg geriet bergauf etwas zeitaufwendiger. Neben dem Tornister mit Schiefertafel – Papier war zunächst noch Mangelware – und einigen zerfledderten Lehrbüchern aus der Kriegszeit, gehörte im Winter die Spende von einem Brikett oder ähnlich Brennbarem pro Schüler zur Wegbegleitung. Letzteres blieb mangels Masse oft nur ein frommer Wunsch. Schließlich fror man in den eigenen vier Wänden schon erbärmlich. Mein Beitrag bestand schwerpunktmäßig im Einsammeln von nachts abgebrochenen Zweigen auf dem Weg zur Schule. Bei Schnee und Regen das richtige Substrat, um dem gusseisernen Koloss im Klassenzimmer statt Wärme gewaltige Rauchschwaden zu entlocken. Zumal die Heizungsspenden der Schulkameraden qualitativ ähnlich dürftig ausfielen. Bei Sonnenschein und klirrender Kälte sorgte die über dem Schornstein geringfügig erhöhte Wärme, dass der Ofen auch da nicht ziehen wollte. Sozusagen angewandte Physik in Sachen Thermik und deren Einfluss auf die Ausdehnung von Gasen. Die kleinen Wölkchen ausgeatmeter Luft verschwanden in den gewaltigen, dem Ofen entweichenden Rauchwolken. Alsbald tränten die Augen, setzten Hustenattacken ein. Im Eiltempo aufgerissene Fenster verhinderten eventuelle Evakuierungsmaßnahmen. Man war nicht verwöhnt und zitterte sich warm. Dabei half die drangvolle Enge von über 40 Kindern in dem kleinen Klassenzimmer. Der sich dabei langsam entwickelnde Mief trug zu wohlig allumfassendem Gemeinschaftsgefühl bei. In der großen Pause stürmte die hungrige Meute, das mitgebrachte Essgeschirr unter dem Arm, zu den Futtertrögen im Schulhof. Eine wahrhaft segensreiche Spende aus Amerika, die sich mit dem Namen „Hoover’sche Schulspeisung“ einen unauslöschlichen Ehrenplatz in uns Kindern eroberte. Klassenweise geduldig eine Schlange bildend, sah man erwartungsvoll den Köstlichkeiten entgegen, die jeder portionsweise zugeteilt erhielt. In der Hoffnung, eventuell einen Nachschlag zu ergattern, stellte man sich, fleißig aus dem Napf löffelnd, umgehend hinten wieder an. Der Speisezettel war nicht sehr abwechslungsreich: Erbsensuppe, Reispampe, Haferflockenbrei mit Kakao, sowie eine atemberaubende Kombination von einem Stück fetten Speck mit einer Dampfnudel und einer süßsäuerlichen lila Soße. Deren Farbe hätte jedem Kreuz auf der Fahne eines Kirchentages zur Ehre gereicht. Alles schmeckte herrlich, und wer glücklicher Besitzer eines Kochgeschirrs aus alten Heeresbeständen war, brachte vom eventuellen Nachschlag noch eine Kleinigkeit mit nach Hause.
Es war eben alles ein wenig ärmlich, aber die Masse der Habenichtse von wohltuender Homogenität. Diese Einheit in Armut war friedensstiftend. Der Blick zum Nachbarn ließ keinen Neid aufkommen. Nur einmal im Winter beim Schlittenfahren unterhalb des Waisenhauses fühlte ich mich etwas verlassen und ausgegrenzt. Niemand war bereit, mich wenigstens einmal den Berg runterrutschen zu lassen. Ein lächerlich kindlicher Schmerz. Und doch, 60 Jahre später, immer noch erstaunlich gegenwärtig.
Schwimmen, die andere spielerische Form der Fortbewegung, lag der Mutter bei ihrem Sohn besonders am Herzen. Fünf Reichsmark wurden in einen Kurs investiert. Nun schwebte der Adlatus im Merkel’schen Schwimmbad beim Bademeister an der Angel. Anfänglich noch mit Schwimmflügeln legte man sich mit dem Bauch auf dem von der Angel getragenen Gurt und erlebte überrascht, wie die sinnvolle Koordinierung von Arm- und Beinbewegungen, begleitet von vernünftiger Atemtechnik, zu angenehm dahingleitender Vorwärtsbewegung führte – fern von hastig nach Luft japsender Zappelei. Die Luft entwich langsam den immer schmalbrüstiger werdenden Schwimmflügeln, bis sie völlig überflüssig wurden. Der Gurt unter dem Bauch hing nicht mehr so straff an der Angel, und nach wenigen Übungsstunden reichte es, wenn sich der Bademeister irgendwo in Sichtweite aufhielt. Selten haben sich fünf Reichsmark als so segensreiche Investition erwiesen. Was wären all die späteren Ferienerlebnisse ohne ihr schwimmendes Badevergnügen gewesen?!
Meine Geschwister sollten das Gymnasium besuchen. Die höheren Lehranstalten waren jedoch 1946/47 in Esslingen noch nicht so richtig in Schwung geraten. So landeten sie auf der Schwäbischen Alb in einem Internat in Urspring, nicht weit von Schelklingen bzw. Blaubeuren und Ulm entfernt, damals in der französisch besetzten Zone gelegen. Zu häuslichen Besuchen in Esslingen war ein Passierschein erforderlich, den zu erlangen es einiger bürokratischer Klimmzüge bedurfte. Grund genug die Grenzüberschreitung, manchmal auch bei Nacht, heimlich still und leise, ohne Passierschein zu bewerkstelligen.
Bei einem Ferienaufenthalt in Esslingen gelang es dem Bruder, im hinteren Teil des Gartens einen Hühnerstall zu errichten. Das dazugehörige Federvieh wusste, was sich gehörte: Die Hennen legten fleißig Eier, die Hähne landeten im Kochtopf. So sorgte jedes Tier auf seine Weise für die dringend benötigte Eiweißzufuhr. Dennoch, wie schon beschrieben, die Folgen der Mangelernährung waren unübersehbar. Ich absolvierte innerhalb weniger Monate die schon beschriebene Rallye durch fast alle gängigen Kinderkrankheiten. Der Hausarzt beantragte eine Kindererholungskur im Otto-Hofmeister-Haus auf der Schwäbischen Alb. An diese wohlmeinende Initiative knüpfen sich allerdings keine erfreulichen Erinnerungen. Die für das leibliche Wohl zuständigen Rotkreuzschwestern ließen mit hartnäckiger Regelmäßigkeit jeden Morgen, den Gott werden ließ, eine aus dünner Magermilch gefertigte Milchsuppe anbrennen. Deren Produkt waberte ganztägig durch die lieblos kasernenähnlichen Räume. Zusätzlich plagte mich nicht ganz Elfjährigen ein kaum zu stillendes Heimweh. Es mündete, zu meinem Entsetzen, in nächtliches Bettnässen. Um die Blamage zu vervollständigen, blieb das Malheur in dem großen Schlafsaal nicht verborgen. Zum Schaden gesellte sich somit der Spott, der das Heimweh noch heftiger beflügelte. Zu allem Überfluss lief ich mir auf einer der zahlreichen Waldspaziergänge in den wieder einmal zu eng gewordenen Schuhen auch noch eine Blase an die rechte Großzehe. Sie vereiterte und zog eine mehrtägige Bettruhe nach sich. Während dieser Zwangspause genas ich eines prächtigen Bandwurmes, der sich plötzlich in der Toilettenschüssel fand. Zum Dank für diese Tortur durfte abschließend noch ein möglichst individuell gestalteter Dankesbrief an die Spender dieses „Jugendglücks“ nach Amerika auf den Weg gebracht werden. Ich schrieb mich in einen wahren Dankesrausch. Weder früher noch später konnte ich mich erinnern, einmal so ausdauernd inbrünstig gelogen zu haben.
Nach vierjähriger Volksschulzeit war eine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium fällig, die ich auch bestand. Trotzdem empfahl man, noch ein Jahr Volksschule anzuhängen: In den drei Zügen der Sexta herrschte mit je 50 Schülern drangvolle Enge. An einen vierten Zug war wegen Lehrermangels nicht zu denken. Im Herbst 1947 erfolgte dann der Wechsel auf das humanistisch orientierte Georgii-Gymnasium – es sollte für die nächsten Jahre der Beginn eines schmerzlichen Leidensweges werden.