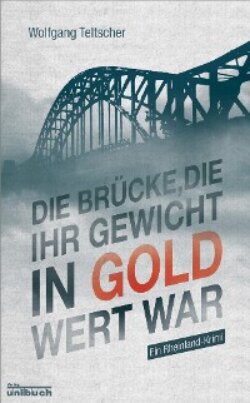Читать книгу Die Brücke, die ihr Gewicht in Gold wert war - Wolfgang Teltscher - Страница 9
ОглавлениеBeim Lesen rutschten die letzten Worte am Ende der Zeilen immer wieder aus seinen Augenwinkeln. Das ging zwei Tage so, wurde nicht besser, aber er dachte an nichts Böses, am wenigsten an einen Schlaganfall oder daran, dass er hätte tot umfallen können. Es wird Zeit, meine Brille überprüfen zu lassen, beruhigte er sich und ging zur Augenärztin. Die machte die üblichen Untersuchungen, um seine Sehstärken zu überprüfen, und schickte ihn als dringenden Fall in die Notaufnahme des Krankenhauses in Stade, denn damals lebte er noch in Niedersachsen.
Im Eingangsbereich der Notaufnahme herrschte Hochbetrieb, trotzdem fragte man ihn sofort, warum er gekommen sei. Er erzählte von seinem Besuch bei der Augenärztin, sie habe ihm geraten, sich hier zu melden, um sich wegen Verdachts auf einen Schlaganfall untersuchen zu lassen. Dann beschrieb er seine Symptome.
»Wann sind die zum ersten Mal aufgetreten?«
Er versuchte, sich zu erinnern. »Ich glaube, das war irgendwann gestern Morgen, vielleicht auch vorgestern Abend. Es geht mir schon viel besser.«
Warum er nicht eher gekommen sei, fragte die Dame hinter dem Empfangstresen überrascht. Auf jeden Fall sei er kein Notfall mehr, er möge bitte im Wartebereich Platz nehmen, man würde ihn aufrufen, wenn er an der Reihe sei. Er wartete eine gute Stunde, bis er zu den Ärzten durfte. Die bestätigten die Diagnose der Augenärztin; er hatte tatsächlich einen Schlaganfall erlitten. Er versicherte auch ihnen, es ginge ihm schon viel besser, aber darauf wollten sich die Mediziner nicht einlassen. Er wurde in einem fahrbaren Krankenbett in die Stroke-Unit im dritten Stock transportiert und während der nächsten Stunden an verschiedene komplexe Apparaturen angeschlossen. Die bestätigten die Diagnose noch einmal.
Er verbrachte zehn Tage im Krankenhaus, wurde ständig mit seinem Bett durch kahle Gänge zu neuen Untersuchungen geschoben und an weitere Maschinen angeschlossen. Er hatte keine Vorstellung gehabt, was die moderne Medizin für Patienten wie ihn bereithielt. Seine Frau besuchte ihn täglich und ließ ihn wissen, wer von den Freunden und Bekannten angerufen hatte und ihm eine baldige und völlige Genesung wünsche. Er wunderte sich, dass so viele Leute an seinem Schicksal Anteil nahmen. Manche von den Namen, die seine Frau erwähnte, sagten ihm nicht viel, aber er freute sich über jeden.
Wenn er nicht gerade an einem Schlauch oder Kabel hing, durfte er sich auf den Gängen des Krankenhauses frei bewegen. Kam seine Frau in solchen Momenten zu Besuch, lud er sie zu Kaffee und Kuchen ins Restaurant im Erdgeschoss ein. Sie saßen dort im Halbdunkeln zwischen Patienten in Trainingsanzügen und Bademänteln und deren Besuchern. Im Raum herrschte gedrückte Stimmung und Marder fühlte sich dann ziemlich krank. Er war froh, danach wieder in sein helles Einbettzimmer zurückkehren zu dürfen. Diesen Luxus hatte er sich gegen einen Aufschlag geleistet, weil er Angst gehabt hatte, mit einem oder mehreren Kranken in einem Zimmer eingesperrt zu sein, die nachts schnarchten und tagsüber dummes Zeug redeten.
Am Wochenende besuchte ihn sein Sohn Andreas, der mit seiner Familie in Aachen wohnte. Er brachte Grüße und beste Wünsche von seiner Schwiegertochter und eine selbst gebastelte Karte »für meinen libsten Oppa« von seiner Enkelin mit. Er freute sich darüber sehr, denn so etwas Schönes hatte sie vorher noch nie zu ihm gesagt. Andreas meinte, er sei vor allem deswegen gekommen, weil er dienstlich ohnehin in Hamburg zu tun habe. Das hielt Marder für die halbe Wahrheit, sein Sohn wollte wahrscheinlich sichergehen, dass sein Vater nicht im Sterben lag und es nicht an der Zeit war, von ihm Abschied zu nehmen. Als Andreas verkündete, dass in einigen Monaten ein weiteres Enkelkind das Licht der Welt erblicken würde, fand Marder, das war ein weiterer Grund, noch nicht ans Sterben zu denken.
Martin, sein jüngerer Sohn, meldete sich über das Telefon. Er entschuldigte sich, dass er nicht kommen könne, da er ja vor wenigen Wochen wieder Vater geworden sei und er seine Frau im Moment nicht gern allein lasse. Sollte sich der Zustand jedoch verschlechtern, würde er natürlich sofort –
»Nein, nein«, unterbrach Marder ihn. »Mach dir wegen mir keine Sorgen. Mir geht es wirklich schon viel besser. Ich habe volles Verständnis für dich, und liebe Grüße an Melanie und Paula, und natürlich auch an den kleinen … also den kleinen …« Der Name des Kleinen wollte ihm partout nicht einfallen, vielleicht hatte der Schlaganfall doch mehr Schaden angerichtet, als er bereit war einzugestehen.
Sein Bruder Manfred aus der Nähe von Hannover besuchte ihn ebenfalls und umarmte ihn kräftig, ohne auf seinen Krankenstand Rücksicht zu nehmen. Ihre Leben waren in ähnlichen Bahnen verlaufen, beide waren bei der Kriminalpolizei gelandet. Das war kein Zufall, sondern seit ihrer Jugend so geplant. Als Kinder hatten sie mit Leidenschaft Bücher gelesen oder im Kinderfunk Hörspiele gehört, in denen kleine Jungen große Verbrecher zur Strecke bringen. Sie hatten sich gegenseitig versprochen, das auch zu tun, wenn sie einmal groß waren. Niemand hatte sie ernst genommen, aber als sie erwachsen geworden waren, hatten sie ihr Versprechen eingelöst. Sie hatten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, stets im Gleichschritt gelebt, waren in die gleiche Schule gegangen, hatten ein gleich gutes, nach Ansicht ihrer Eltern eher gleich schlechtes Abitur gemacht und sich danach bei der Polizei beworben. Erhard Marder immer zwei Jahre später als sein Bruder Manfred. Nur den Schlaganfall hatte Manfred ihm nicht »vorgemacht«.
Nach zehn Tagen im Krankenhaus meinten die Ärzte, dass die größte Gefahr vorbei sei, und Marder durfte nach Hause. Man ließ ihn wissen, dass er aus medizinischer Sicht großes Glück gehabt habe. Die Ursache für den Schlaganfall sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Blutgerinnsel in der rechten Halsschlagader gewesen und das hätte schlimm enden können. Man riet ihm dringend zu einer Rehabilitationskur in einer entsprechenden Klinik. Das Beste für ihn sei, nie wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, sondern den vorgezogenen Ruhestand zu beantragen. Da er bereits in der zweiten Hälfte seiner Fünfziger sei, meinten die Mediziner, ließe sich das im Rahmen der sozialen Gesetzgebung problemlos einrichten, es sei ja bekannt, wie ernst die Bundesrepublik die Fürsorgepflicht gegenüber ihren Bediensteten nehme.
Marder fand das nicht gut. Rehabilitation okay, das musste wohl sein, aber ein derart früher Ruhestand kam nicht in Frage. Er wollte noch einige Jahre das Verbrechen bekämpfen, nicht aus Idealismus, sondern weil er nicht wusste, wie er ohne Beruf seine Tage ausfüllen sollte. Jeden Tag nur Frau, Kinder und Enkel, dazu war er noch nicht bereit. Der Gedanke an einen Sessel vor dem Fernseher für den Rest des Lebens erfüllte ihn mit Schrecken. Tagesschau oder Sportsendungen, das war in Ordnung, auch der eine oder andere Spielfilm, solange es kein Tatort war. Von Krimis im Fernsehen hatte er sich vor Jahren verabschiedet, nicht, weil er sie unrealistisch fand, sondern eher, weil sie nach seiner Auffassung übertrieben realistisch und unnötig grausam waren. Wenn jede Ermittlung so aufregend wäre, jeder Verbrecher so gewissenlos oder gnadenlos wie die im Fernsehen, hätte er seinen Beruf wahrscheinlich längst an den Nagel gehängt. Auf gefälschte Dokumentarberichte oder Reality-Soaps mit schlechten Laienschauspielern hatte er erst recht keine Lust. Lieber noch ein paar Jahre hinter seinem Schreibtisch verbringen, auch wenn es dort nicht immer so heiter zuging wie im Büro des Kommissars im Tatort in Münster.
Seine Frau stand auf der Seite der Ärzte, sie konnte sich einen vorzeitigen Ruhestand ihres Mannes gut vorstellen und sah sich bereits die Länder der Welt bereisen, die sie immer schon hatte erkunden wollen. Es gab die eine oder andere erregte Diskussion zwischen ihnen, bis man sich auf einen Kompromiss einigte. Er würde um Versetzung bitten, weg von der stressigen Dienststelle im Hamburger Umland, hin zu einem ländlicheren, wenn möglich romantischeren Umfeld. Das musste nicht unbedingt in Niedersachsen sein. Besser, irgendwo südlicher in Deutschland, wo man sich für den kommenden Ruhestand einrichten konnte. Das Rheinland wäre nicht schlecht, meinte die Gattin, dann käme man den Kindern und den sich vermehrenden Enkeln näher, denn beide Söhne hatten sich mit ihren Familien im Rahmen ihrer beruflichen Karrieren am Rhein oder in dessen Nähe angesiedelt.
Das Rheinland war nicht unbedingt Marders Traumziel, das klang nach Karneval während vieler Monate im Jahr. Von den Dienstvorschriften her war es ohnehin nicht üblich, in ein anderes Bundesland versetzt zu werden, Polizeiarbeit sowie Versetzungen des Personals waren schließlich Ländersache. Nur wenn alle betroffenen Dienststellen guten Willens waren, konnte das Unmögliche möglich gemacht werden. Vor allem, wenn man einen guten Ruf genoss und sich über Jahre und Landesgrenzen hinweg Freunde gemacht hatte. Seine Frau war der Ansicht, das treffe auf ihn zu. Das Rheinland sei von allen schönen Landschaften in Deutschland eine der besten Alternativen. Man brauche nur die wunderbaren Burgen und die Fröhlichkeit der rheinischen Menschen zu bedenken. Natürlich setzte sie sich mit ihrer Meinung durch.
So waren die Marders in Remagen gelandet. Eine Stadt nahe genug an Köln und Aachen, um die Beziehungen mit den nächsten Generationen der Familie zu intensivieren, ohne in ihrer direkten Nachbarschaft zu wohnen. Das war gut so, fand er jedenfalls.
Remagen war eine kleine Stadt am linken Rheinufer mit einer langen Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückging. Wenn ihre Einwohnerzahl in den letzten Jahrzehnten gestiegen war, lag das vor allem an der Gebietsreform und den Eingemeindungen weiterer Ortschaften der Umgebung. Die Region war unterwegs in die Zukunft. Um auf diesem Weg Kosten zu sparen, befand man sich jedes Mal, wenn eine Position in einer Behörde frei wurde, in Versuchung, diese zu streichen oder zumindest erst einmal abzuwarten, ob es auch ohne sie ging. Die Stelle des Remagener Kommissars, der in den Ruhestand gegangen war, sollte trotzdem neu besetzt werden.
Die dafür zuständige Behörde hatte mit dem Gedanken gespielt, diese Position dem Assistenten des ehemaligen Kommissars anzuvertrauen, diesen Plan aber wieder verworfen. Dafür war Benjamin Hofrichter zu jung und unerfahren. Er hatte in seiner bisherigen Karriere mehr als einmal seine Unerfahrenheit bewiesen und deutlich gemacht, dass er noch nicht bereit war, den Kampf gegen das Verbrechen in der Stadt anzuführen. Er benötigte weitere Lehrjahre. Marder mit seiner Erfahrung schien der vorgesetzten Dienststelle ein geeigneter Lehrmeister zu sein. Der Kommissar hielt das für ein ausgezeichnetes Arrangement; mit dem jungen Mann hatte er jemanden, der ihm Laufwege abnehmen und den Teil von Ermittlungen führen konnte, die den Einsatz eines hochkarätigen Fachmannes wie ihn selbst nicht wert waren.
Hofrichter war in Marders Augen der Urtyp eines Rheinländers. Niemand käme auf die Idee, ihn für einen Zugereisten zu halten, vor allem nicht, wenn er redete. Dann war seine tiefe Verbundenheit mit dem Rheinland nicht zu überhören. So wie sich im Gegensatz Marder nicht einbildete, jemals für einen gebürtigen Rheinländer gehalten zu werden. Seine Sprache würde ihn immer und ewig als einen Mann aus dem kühlen Norden verraten.
Selbstverständlich hatte Benjamin Hofrichter trotz seiner mangelnden Erfahrung auch gute Eigenschaften, und Marder wusste sie durchaus zu schätzen. Er war kommunikativ, freundlich und hilfsbereit, nur eben noch nicht klarsichtig und entscheidungsfähig genug, um die Verantwortung eines leitenden Kriminalbeamten zu übernehmen. Er war auf jeden Fall ein geselliger Mensch. Das sah Marder als typisch für die Rheinländer an. Nicht nur luden Hofrichter und seine Freunde sich unentwegt gegenseitig zum Essen ein, er erzählte auch ausführlich am Morgen danach, wie köstlich die gestrige Mahlzeit geschmeckt hatte. Das nervte Marder mitunter. Es interessierte ihn einfach nicht, wie gut es seinem Assistenten am letzten Abend gemundet hatte und welchen Wein er zum Essen getrunken hatte.
Marders Vorgänger, Bernhard Kampfer, war bedauerlicherweise ebenfalls von einem Schlaganfall getroffen worden. Leider mit schlimmeren Auswirkungen als für seinen Nachfolger, und er galt für den Rest seiner Dienstzeit als arbeitsunfähig. Das Tragische daran war, dass er einige Jahre jünger als Marder war, er hatte erst vor einem Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert. Marder hatte ihn nach seiner Ankunft in Oberwinter, einem Ortsteil von Remagen, besucht, wo der Mann liebevoll von seiner Frau und seiner Tochter gepflegt wurde. Marder erhoffte sich von ihm hilfreiche Ratschläge für seine neue Aufgabe, allerdings konnte sich der Kranke nicht mehr an viel erinnern, was vor dem Schlaganfall an seinem Arbeitsplatz vorgegangen war. Bernhard Kampfer weihte Marder in das ein, was er in seiner Jugend in diesem schönen Ort am Rheinufer erlebt hatte, alles, was danach in seinem Leben geschehen war, war ihm weitgehend entfallen. Marder wurde sich dadurch bewusst, welches Glück er trotz seines Schlaganfalls gehabt hatte, und schickte dem lieben Gott ein verspätetes Danke.