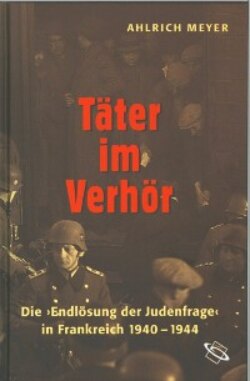Читать книгу Täter im Verhör - Ahlrich Meyer - Страница 22
Deportation als „Sühnemaßnahme“
ОглавлениеAnfang Dezember hatte der Militärbefehlshaber Otto von Stülpnagel erstmals die Deportation von 1.000 Juden angeordnet, ohne jedoch auf den Terror der Erschießung von Geiseln zu verzichten. Am 15. Januar nun verweigerte er weitere Massenexekutionen in einem Schreiben an das Oberkommando des Heeres, mit dem er faktisch seinen Rücktritt einleitete und in dem er zugleich unterstrich, er halte als Vergeltungsmaßnahme nach Attentaten „den fallweisen Abtransport einer gewissen Anzahl der bereits internierten Kommunisten und Juden nach Deutschland oder dem Osten für zweckmäßig“. Um seinem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, berichtete von Stülpnagel nach Berlin, durch gemeinsame deutsch-französische Verhaftungsaktionen seien im besetzten Gebiet etwa 10.000 Juden und 3.500 Kommunisten verhaftet worden (tatsächlich handelte es sich nach den drei Razzien des Jahres 1941 um etwa 8.700 Juden150), die Zahl der im besetzten Gebiet befindlichen Lager sei „im Haftraum beschränkt“, es mangele an Bewachungskräften und den bereits verfügten Deportationen stünden zunächst bis Februar oder März 1942 „Transportschwierigkeiten“ entgegen. In dieser Lage, so schloß die Argumentationskette von Stülpnagels, könne er „weitere Verhaftungen und Internierungen in größerer Zahl nicht mehr vornehmen“.151 Mit der seit Mitte 1941 von deutschen Stellen gebrauchten Begründung, die Lager in Frankreich reichten nicht aus, drängte also auch der Militärbefehlshaber nunmehr auf einen raschen Beginn der Deportationen. Zugleich gab er den alternativen Kurs in der deutschen Repressionspolitik vor, dem die Militärverwaltung in Zukunft weitgehend folgen sollte.
Vorerst jedoch erhielt von Stülpnagel auf sein Schreiben am 3. Februar eine Antwort, die seine ultimative Forderung nach einem Ende der Massenhinrichtungen in Frankreich zurückwies, die gleichzeitig aber den vom Militärbefehlshaber bereits eingeschlagenen Weg der Ankündigung von Deportationen als Repressionsmaßnahme bekräftigte. Generalfeldmarschall Keitel verlangte nach Vortrag bei Hitler für die seit Mitte Januar gemeldeten neuen Attentate und Sprengstoffanschläge weitere Erschießungen in großer Zahl und die „Festnahme von wenigstens eintausend Kommunisten bezw. Juden zum Abtransport“152 – eine Anordnung, die also über die vom Militärbefehlshaber im Dezember vorgeschlagenen und durch Hitler schon genehmigten Maßnahmen (Erschießung von 100 Geiseln, Deportation von 1.000 Juden und 500 Kommunisten) hinausging. Denn Ende Januar – dies ist der früheste dokumentarische Beleg aus Berlin für den Beginn der Transporte – hatte Himmler Keitel bereits zugesagt, „daß wir die in Frankreich durch den dortigen Wehrmachtsbefehlshaber festgenommenen [d.h. bei der Dezember-Razzia verhafteten; A.M.] Kommunisten und Juden en bloque übernehmen“.153 Von Stülpnagel, der zu diesem Zeitpunkt annehmen mußte, sich nicht durchgesetzt zu haben, bat um seine Demission. In einem persönlichen Schreiben an Keitel vom 15. Februar 1942 faßte er seine Politik der „Sühnemaßnahmen“ noch einmal zusammen. Er habe geglaubt, schrieb er, „die selbstverständlich notwendige Sühne bei Attentaten gegen deutsche Wehrmachtsangehörige auf anderem Wege, d.h. durch begrenzte Exekutionen, vor allem aber durch Abtransport größerer Massen von Kommunisten und Juden nach dem Osten erreichen zu können, der meiner Kenntnis nach viel abschreckender auf die französische Bevölkerung wirkt, als diese von ihr nicht verstandenen Massenerschießungen“.154
Man muß davon ausgehen, daß die deutsche Militärverwaltung in Paris – trotz des Drucks aus Berlin, der zum Revirement an der Spitze führte – über einen beträchtlichen Handlungsspielraum bei der Verhängung von Repressalien verfügte. So hatte nicht nur die Forderung Keitels keine erkennbaren Auswirkungen. Sondern die Militärverwaltung verfolgte im Zeitraum zwischen Januar und Ende Mai 1942 – auch unter dem neuen Militärbefehlshaber Carl-Heinrich von Stülpnagel und bis zur Übertragung der Polizeibefugnisse auf den Höheren SS- und Polizeiführer Oberg – genau die Politik der „begrenzten“ Geiselerschießungen (vorzugsweise von Juden), die Otto von Stülpnagel empfohlen hatte, während sie gleichzeitig nach jedem größeren Attentat der französischen Widerstandsbewegung Massendeportationen von Juden und Kommunisten bekanntgab. Ein interner Vermerk der Gruppe Polizei mit dem Betreff „Deportation als Sühnemaßnahme“ vom Frühjahr 1942 hielt diese Neuausrichtung der Repressionspolitik fest: „Auf die schlagartige Festnahme einer größeren Anzahl von Kommunisten oder Juden“, schrieb Kriegsverwaltungsrat Kübler von der Gruppe Polizei, könne auch in Zukunft nicht verzichtet werden, wobei er im übrigen darauf hinwies, die meisten „gefährlichen Kommunisten“ seien ohnehin bereits inhaftiert und Juden dürften „zu Zwecken der Deportation nur festgenommen werden, wenn sie arbeitsfähig sind“.155 Ende April schließlich, kurz bevor Oberg die Verantwortung für die Repressionspolitik im besetzten Frankreich übernahm, zog Karl-Richard Kossmann, der Chef des Kommandostabs und Nachfolger Speidels, die folgende Bilanz: Gegenüber dem kommunistischen Widerstand hätten alle befohlenen „Sühnemaßnahmen“ wenig Erfolg gehabt; wirkungsvoll seien „wohl nur Massendeportationen von Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen [...], sofern unmittelbar nach einem Anschlag in bestimmten Bezirken umfangreiche Razzien schlagartig durchgeführt werden können. Sofortiger Abtransport der Verhafteten in Zwangslager nach dem Osten muß gewährleistet sein.“156 Als Kossmann dies forderte, war der erste Transport nach Auschwitz bereits abgefahren.
Lag anfangs die Zahl der solchermaßen angekündigten Deportationen nach mehreren Anschlägen in Paris im Januar 1942 noch bei jeweils 100,157 so meldete die Militärverwaltung Ende Februar, zur „Abgeltung“ für Anschläge in Rouen, Tours und Elbeuf seien umfangreiche Razzien durchgeführt und die „Überführung von 1.000 Kommunisten und Juden in deutsche Haft“ sei angeordnet worden, die festgenommenen Personen würden „zur Deportation nach dem Osten bereitgestellt“.158 Im April 1942, zwei Monate nach dem Rücktritt Otto von Stülpnagels, wurde diese Praxis sodann aus Berlin bestätigt. In gewisser Weise handelte es sich um eine nachträgliche Sanktionierung der Vorschläge des abgelösten Militärbefehlshabers. Hitler befahl nach einem Überfall auf eine Wehrmachtunterkunft bei Paris, „daß künftig für jedes Attentat – abgesehen von der Erschießung einer Anzahl geeigneter Personen – 500 Kommunisten und Juden dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei zur Deportation nach dem Osten zu übergeben“ seien.159 Allerdings forderte er, Kommunisten in erheblicher Zahl zu berücksichtigen, was nicht zuletzt deswegen bemerkenswert ist, weil das Reichssicherheitshauptamt eine Deportation von Kommunisten in die Ostgebiete zuvor abgelehnt hatte. Die Befehlslage bezüglich der nichtjüdischen Opfer von „Sühnemaßnahmen“ war also widersprüchlich. Gleichzeitig stand damit, wie der Gesandte Schleier in einem Telegramm an Botschafter Abetz konstatierte, dem „Vorschlag, ausschließlich oder überwiegend Juden zu nehmen“, eine Führerweisung entgegen.160 In ihren folgenden Anordnungen hielt sich die Militärverwaltung an diese Zahlenvorgabe (500 Kommunisten und Juden),161 nur im Fall eines Eisenbahnanschlags bei Caen am 16. April, bei dem eine größere Anzahl von deutschen Soldaten zu Tode kam, gab Carl-Heinrich von Stülpnagel – wiederum auf Weisung Hitlers – „die sofortige Erschießung von 30 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen [...] sowie die Überführung von 1.000 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen zur Zwangsarbeit nach dem Osten“ bekannt.162 Auf diese Weise war bis Ende Mai – die über 1.000 Opfer der Dezember-Razzia und des ersten Transports vom 27. März 1942 nicht berücksichtigt – eine Zahl von insgesamt mehr als 6.000 Kommunisten und Juden zusammengekommen,163 deren Deportation angekündigt wurde, ohne daß bis dahin weitere Transporte durchgeführt worden wären.
Welche Realität verbarg sich hinter diesen Zahlen und regelmäßigen Ankündigungen? Wurden neue Massenverhaftungen organisiert, Lager eingerichtet oder Deportationszüge angefordert? Das war erstaunlicherweise nicht der Fall. Dokumentarisch gesichert ist nur der Zusammenhang zwischen der Anordnung des Militärbefehlshabers vom Dezember 1941, 1.000 Juden verhaften und deportieren zu lassen, und dem ersten Transport nach Auschwitz. Irgendein zahlenmäßiger Bezug zwischen den angekündigten Deportationen und den späteren Transporten – deren Umfang durch eine Zusage Heydrichs von Anfang März festgelegt wurde, wie noch zu zeigen ist, und die erst Anfang Juni begannen – läßt sich schon allein deswegen nicht herstellen, weil die von der Militärverwaltung zur Vergeltung angedrohten Repressalien von einer unvorhersehbaren Anzahl von Attentaten der kommunistischen Widerstandsbewegung abhingen.164
Die genannten Zahlen waren auch nicht durch neue Festnahmen gedeckt. Allerdings wurden im Zuge von „Sühnemaßnahmen“ im Frühjahr 1942 in der französischen Provinz auch Razzien gegen die jüdische Bevölkerung durchgeführt, oder es wurde die Überführung von bereits verhafteten Kommunisten und Juden aus Lagern unter französischer Verwaltung in die „Deportationsabteilung“ von Compiègne angeordnet.165 Doch diese Aktionen erreichten in keinem Fall das in den Berichten des Militärbefehlshabers verzeichnete Niveau. Um ein Beispiel zu geben: Die im Lagebericht der Ic-Abteilung des Kommandostabs Ende Februar gemeldeten „umfangreichen Razzien“ in Rouen und Tours und die „Überführung von 1.000 Kommunisten und Juden in deutsche Haft“166 lassen sich – im Gegensatz zu den außerdem befohlenen Geiselerschießungen – dokumentarisch nicht nachweisen. Dannecker und Lischka holten Anfang Februar 1942, unmittelbar nachdem sich die zwei Attentate gegen die Wehrmacht in Rouen und Tours ereignet hatten, die „formelle Zustimmung“ der Gruppe Polizei der Militärverwaltung zur Festnahme von 60 Juden aus dem Bereich der Sipo-SD-Außendienststelle Rouen ein, die Dannecker freilich schon vorher geplant hatte, und Best selbst stimmte zu. Aber die Verhaftungen verzögerten sich und wurden erst im Mai nach neuerlichen Anschlägen durchgeführt.167 Die einzigen Razzien, die für den Monat Februar in der Region Rouen bezeugt sind, führten – wie Ernst Jünger notiert hat – „zu 206 Festnahmen [...], von denen eine Anzahl zur Deportation zurückbehalten wurden“.168
Die reale Grundlage der zwischen Januar und Mai 1942 vom Militärbefehlshaber befohlenen „Sühnemaßnahmen“ bestand – was die Deportationsanordnungen betrifft – also darin, daß bereits Tausende von Gefangenen in Lagern interniert waren. Die im Verlauf der drei Razzien des Jahres 1941 verhafteten Juden wurden zu Geiseln für Transporte „nach dem Osten“: sie waren zur Deportation „bereitgestellt“, es gab Karteien, die die „jederzeitige Herausziehung dieser Juden“ ermöglichten, wie es im Jargon der Täter hieß. Offenkundig vermied die Militärverwaltung damit, massive Vergeltungsmaßnahmen im Lande selbst umsetzen zu müssen, während sie gleichzeitig die Verantwortung für die Durchführung der angedrohten Deportationen auf Berliner Stellen schieben konnte. Sie lieferte Vorgaben für Transporte nach Auschwitz, deren Realisierung zunächst gar nicht gesichert war und von Entscheidungen höheren Orts abhing. Erst im März 1942 lag die Zusage des Reichssicherheitshauptamts in Paris vor, über den Transport vom 27. März hinaus weitere 5.000 Juden aus dem besetzten Gebiet zu deportieren. Als schließlich Hitler im April das vom ersten Militärbefehlshaber eingeleitete Programm „Deportation als Sühnemaßnahme“ billigte, sahen sich Militärs in ihrer Politik bestätigt, Repressalien zu verhängen, die in Frankreich, anders als die früheren öffentlich verkündeten Massenerschießungen von Geiseln, kaum mehr auffielen und deren mörderische Folgen sich erst außer Landes zeigen sollten.