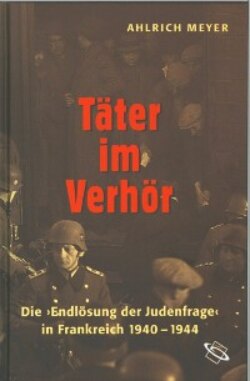Читать книгу Täter im Verhör - Ahlrich Meyer - Страница 25
Was wußte man in Paris?
ОглавлениеWelche Vorstellungen verbanden diejenigen, die innerhalb der deutschen Stellen im besetzten Frankreich an der Vorbereitung der Deportationen beteiligt waren oder die davon Kenntnis erlangt hatten und aus Schriftstücken den Namen des Konzentrationslagers Auschwitz als Zielort entnehmen konnten, mit dem Geschehen? Hält man sich nur an die offiziellen Informationsquellen, und das heißt rückblickend an die überlieferten Dokumente, dann ergibt sich folgendes Bild:
Im Lagebericht des Militärbefehlshabers für die Monate Februar und März 1942 wurde der Transport vom 27. März so angezeigt, wie es der seit Dezember verbreiteten Version entsprach, nämlich im Zusammenhang von Repressalien. Die „als Sühnemaßnahme angeordnete Deportierung von Juden zur Arbeit in den Osten“, hieß es, sei „durch die Deportierung von zunächst 1.100 Juden erstmalig durchgeführt“ worden. Somit waren auch die Transporte, die folgen sollten, für die Militärverwaltung potentielle „Sühnemaßnahmen“, ein Instrument, um auf weitere Attentate zu reagieren, und dementsprechend war im Lagebericht von „zur Deportation bestimmten Juden“ die Rede, die für das gesamte besetzte Gebiet in Compiègne konzentriert würden.247 Wenig später, nämlich am 10. April, gab der inzwischen neuernannte Militärbefehlshaber Carl-Heinrich von Stülpnagel den schon zitierten „Führerbefehl“, wonach künftig für jedes Attentat 500 Kommunisten und Juden deportiert werden sollten, allen nachgeordneten Dienststellen im besetzten Gebiet bekannt. Stülpnagel wies die Chefs der Militärverwaltungsbezirke, die Feld- und Kreiskommandanten und den Kommandanten von Groß-Paris an, die französischen Internierungslager überprüfen zu lassen und dafür zu sorgen, „daß in das Lager Compiègne eine ausreichende Anzahl von Personen überstellt wird“.248 Im Anschluß daran formulierte die Gruppe Polizei der Militärverwaltung nochmals eigene „Grundsätze für die Auswahl von Personen, die zur Deportierung geeignet sind und sich zur Zeit in französischen oder deutschen Haftlagern befinden“.249 Die Auswahl sollte durch die Feldkommandanturen im Einvernehmen mit den Außenstellen der Sipo-SD erfolgen. Tatsächlich wurden dann bis zum nächsten Transport bereits internierte Juden aus anderen Lagern (Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Drancy) nach Compiègne verlegt,250 von wo am 5. Juni 1942 ein weiterer Deportationszug mit 1.000 Männern nach Auschwitz abfuhr.
Am 23. März, vier Tage vor dem ersten Transporttermin, richtete Zeitschel von der Pariser Botschaft eine Anfrage an einen Beamten der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts, den Legationsrat Strack. Der Botschaft war Görings Erlaß vom 31. Juli 1941 zur Kenntnis gebracht worden, mit dem Heydrich den schriftlichen Auftrag zur Vorbereitung einer „Gesamtlösung der Judenfrage“ in Europa erhalten hatte, und überdies wußte man in Paris, daß im Anschluß an diesen Erlaß in Berlin eine „Staatssekretärsbesprechung“ – also die Wannsee-Konferenz – stattgefunden hatte. Zeitschel bat seinen Gewährsmann in Berlin, ihm eine Abschrift des Konferenzprotokolls zuzusenden, da der Inhalt der Besprechung, so schrieb er, „für meine Aufgabe, Behandlung der Judenfrage, von grundlegender Bedeutung“ sei.251 Hatte Zeitschel, wie üblich, die Information von Dannecker erhalten oder über die Kanäle der Deutschen Botschaft selbst? Was war ihm, ohne daß er das Wannsee-Protokoll kannte (es ist nicht dokumentiert, ob er es tatsächlich zugeschickt bekam), über den Zweck der Konferenz mitgeteilt worden?
Bei der Botschaft wie bei der Militärverwaltung gingen in diesem Zeitraum zahlreiche Anträge auf Freilassung von Juden ein, die interniert waren. Dannecker und Lischka verfaßten eine grundsätzliche Stellungnahme dazu, in der sie darauf hinwiesen, „daß aus allgemeinen Gründen der Judenbehandlung die Freilassung bereits in einem Lager befindlicher Juden aufgrund irgendwelcher Verdienste kaum vertretbar“ sei.252 In einer Entgegnung betonte Schleier, die Botschaft vertrete ihrerseits „den selbstverständlichen Standpunkt, daß das Judenproblem auch in Frankreich einer totalen Lösung“ bedürfe, wobei er allerdings einzelne Ausnahmen (im Fall eines Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs) für zulässig hielt: Bei der kleinen Zahl der bisher verhafteten Juden, schrieb der Generalkonsul, gäbe es „unter der großen Zahl frei herumlaufender Juden genügend Existenzen, für die die Verhaftung und Deportierung wesentlich zweckmäßiger wäre“.253 In einem anderen Fall korrespondierte die Militärverwaltung mit der Sipo-SD wegen eines Mannes, der – obwohl mit einer Nichtjüdin verheiratet – am 27. März „in das Lager Auschwitz überführt“ worden war, was den ausgegebenen Richtlinien nicht entsprach. Auf dem von Nährich unterzeichneten Schreiben findet sich eine handschriftliche Verfügung Danneckers, die wörtlich lautet: „Prüfung des Falles erscheint unangebracht, da eine Rückführung aus dem KZ nicht in Frage kommen kann.“254
Mitte Mai erging eine vom Militärbefehlshaber an seine nachgeordneten Dienststellen übermittelte Anweisung des OKH, „in allen Bekanntmachungen, die den Zwangsabschub von Landeseinwohnern betreffen“ (gemeint waren die öffentlichen Bekanntmachungen nach Attentaten der französischen Widerstandsbewegung), „die Worte ‘nach dem Osten’ nicht zu gebrauchen, um eine Diffamierung der besetzten Ostgebiete zu vermeiden“. Das gleiche gelte für den – seit der zaristischen Zeit mit dem Abschub nach Sibirien verbundenen – Ausdruck „Deportation“. Die zur Sprachregelung – übrigens der ersten für die „Endlösung“ in Frankreich
diktierte Wendung für Bekanntmachungen und den gesamten Schriftverkehr lautete: „Verschickung zur Zwangsarbeit“.255 Warum durften die „Ostgebiete“ nicht genannt werden, worin bestand die Diffamierung? Welche Wirkung versprach man sich von der Verwendung der geläufigen Formel „Zwangsarbeit“? Sollten die Deportationen in der französischen Öffentlichkeit weiterhin als eine Repressionsmaßnahme der Militärs gelten, wie sie in Kriegszeiten nicht unüblich war? Oder wurde angenommen, daß sich die Massaker an den Juden in Osteuropa herumsprechen könnten, weshalb man ganz auf geographische Angaben verzichtete?
Die Vorbereitungen für den Transport Nr. 2 von Compiègne nach Auschwitz begannen Anfang Mai, zu eben dem Zeitpunkt, als sich Heydrich zu einem Besuch in Paris aufhielt,256 um den Höheren SS- und Polizeiführer Oberg in sein Amt einzuführen. Nach Entscheidung Himmlers richtete der Amtschef IV des Reichssicherheitshauptamts, Müller, am 6. Mai ein Fernschreiben an Knochen, aus dem unter anderem hervorging, daß jetzt auch „arbeitsunfähige Häftlinge“ in die Deportation einbezogen werden sollten257 – eine Weisung, die das RSHA zunächst aussetzte258 und erst später bestätigte. Dannecker nahm Verbindung mit der Wehrmachtverkehrsdirektion Paris wegen der Bereitstellung eines Transportzugs auf,259 und in diesem Zusammenhang fand am 13. Mai eine Unterredung zwischen dem Leiter des Judenreferats und Generalleutnant Kohl von der Eisenbahntransportabteilung West statt, dem zu diesem Zeitpunkt die Wehrmachtverkehrsdirektion unterstand. Im Verlauf der Unterredung sagte Kohl nicht nur „das nötige rollende Material“ für den Abtransport von „10.000 oder 20.000 Juden aus Frankreich nach dem Osten“ zu, sondern er vertraute seinem Gesprächspartner auch an, daß er – so hielt Dannecker für seine Vorgesetzten Knochen und Lischka fest – „ein kompromißloser Judengegner ist und eine[r] Endlösung der Judenfrage mit dem Ziel restloser Vernichtung des Gegners 100%ig zustimmt“.260
In dem Zeitraum, in dem die ersten sechs Transporte aus Frankreich unter dem Vorwand von „Sühnemaßnahmen“ zusammengestellt wurden, also zwischen März und Juni/Juli 1942, gab es bei den deutschen Stellen in Paris, die mit der bürokratischen Organisation dieser Transporte befaßt waren, sicherlich kein klares Wissen um die Vorgänge in Auschwitz, das erst im Sommer 1942 zu einem Massenvernichtungslager wurde, sieht man einmal davon ab, daß Dannecker frühzeitig von Eichmann über die Beschlüsse der Wannsee-Konferenz informiert worden sein dürfte. So läßt sich schwerlich beweisen, daß die Richtlinien, in der Mehrzahl „arbeitsfähige Juden“ zu deportieren, von Anfang an auf einer Täuschungsabsicht beruhten,261 die allen deutschen Beteiligten klar gewesen wäre. Man wird wohl auch davon ausgehen müssen, daß eine „Endlösung“ im Sinne der systematischen Vernichtung der Juden die Vorstellungskraft selbst der erklärten Antisemiten unter den Beamten und Offizieren der Militärverwaltung überstieg. Aber alle hier herangezogenen Dokumente enthielten Informationen, die auch ohne Kenntnis der Existenz von Gaskammern und Krematorien in Auschwitz in der Summe zumindest den Schluß ermöglichten, daß der „Arbeitseinsatz“ in Lagern des Ostens, als Zweck der Deportationen von der Militärverwaltung angekündigt, unter Bedingungen stattfinden mußte, bei denen die Mehrzahl der Menschen zu Tode kommen würde. Es gibt jedenfalls – aus historischer Perspektive – keinen Grund, diese frühen Transporte oder auch nur den vom 27. März 1942 unabhängig von der schrittweisen Realisierung des Genozids zu sehen.262
Die Entscheidung zur Deportation von Juden aus Frankreich, so läßt sich zusammenfassend sagen, hing von mehreren Faktoren ab:263 Ein Ausgangspunkt war zweifellos, daß die Militärverwaltung mit der Internierung von über 8.700 Juden im Laufe des Jahres 1941 Fakten geschaffen hatte, die zu dem Argument der „überfüllten Lager“ führen sollten. Im Spätherbst 1941 kam die durch Geiselerschießungen ausgelöste Krise der Besatzungsherrschaft hinzu, die die Militärverwaltung nötigte, andere Formen von Repressalien nach Attentaten gegen die Besatzungsmacht in Betracht zu ziehen; daher im Dezember der Vorschlag und die Anordnung von Stülpnagels zur Deportation von Kommunisten und Juden – eine Praxis, welche die Billigung Hitlers und Keitels fand und schließlich durch einen „Führerbefehl“ vom April 1942 festgeschrieben wurde. Parallel dazu verlief ein Entscheidungsprozeß auf höchster Ebene, der vermutlich schon durch Himmlers Zusage von Mitte September 1941 eingeleitet worden war, die im besetzten Frankreich internierten Juden baldmöglichst zu deportieren. Diese Zusage wurde in bezug auf die vom Militärbefehlshaber angeordnete Deportation von 1.000 Juden Ende Januar 1942 von Himmler, Ende Februar von Eichmann konkretisiert. Als Anfang März 1942 im Reichssicherheitshauptamt die Modalitäten für den ersten Transport nach Auschwitz festgelegt wurden, sicherte Heydrich darüber hinaus die Deportation weiterer 5.000 Juden zu, offenbar auf Vorschlag des Pariser Judenreferats, das auf eine Räumung der nordfranzösischen Internierungslager und erneute Judenrazzien drängte. Der Transport vom 27. März kam also infolge der im Dezember 1941 verhängten Repressalien zustande, dagegen verschleierte die fortgesetzte Androhung von Deportationen als „Sühnemaßnahme“ durch die Militärs im Frühjahr 1942 nur mehr, daß die nächsten fünf Transporte, die faktisch keinerlei Zusammenhang mit Attentaten gegen die Wehrmacht hatten, in Wirklichkeit den Übergang vom „Arbeitseinsatz“ unter mörderischen Bedingungen zur Massenvernichtung bildeten. Dies wird deutlich, wenn man sich das zeitliche Ineinandergreifen der Transporte vor Augen führt: Dannecker zählte die Transporte Nr. 3, 4 und 5 von Ende Juni bereits zu den geplanten weiteren Massendeportationen.264 Der Transport Nr. 6 verließ das Lager Pithiviers am 17. Juli 1942 noch unter dem Vorwand von Vergeltungsmaßnahmen,265 während gleichzeitig in Paris im Verlauf der rafle du Vélodrome d’Hiver fast 13.000 ausländische und staatenlose Juden verhaftet wurden. Mit dem siebten Transport vom 19. Juli, bei dessen Ankunft in Auschwitz erstmals ein Teil der Deportierten sofort getötet wurde, begann die Realisierung des Programms der „Endlösung“ für Westeuropa, das am 11. Juni 1942 im Reichssicherheitshauptamt vereinbart worden war. Die ersten Transporte aus den Niederlanden und aus Belgien fuhren am 15. Juli bzw. am 4. August 1942 nach Auschwitz.
Daß die Deportationen aus Frankreich vier Monate früher einsetzten, lag vor allem in der Verantwortung der deutschen Militärverwaltung. Von ihr ging die erste Anordnung aus, Juden „nach dem Osten“ zu verbringen, alle Voraussetzungen dazu – administrative Maßnahmen gegen Juden, Razzien, Einrichtung von Lagern – wurden geschaffen, noch ehe der SS- und Polizeiapparat in Frankreich die Exekutive übernahm. Die gesamte organisatorische und technische Routine, mit der die späteren Massendeportationen durchgeführt wurden, beruhte auf den Erfahrungen, die mit den vom Militärbefehlshaber eingeleiteten Transporten gesammelt worden waren. Und auch wenn die Machtverhältnisse in Frankreich mit der Einsetzung eines Höheren SS- und Polizei im Frühsommer 1942 grundlegend geändert wurden, so bleibt es doch bemerkenswert, daß die Militärs in Paris zu keinem Zeitpunkt – und sei es aus pragmatisch-politischen Gründen – gegen die weitere Deportation von Juden Stellung bezogen.266