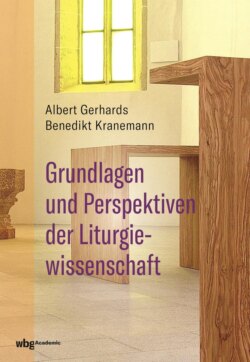Читать книгу Grundlagen und Perspektiven der Liturgiewissenschaft - Albert Gerhards - Страница 10
1.3 Die rituelle Dimension der Liturgie
ОглавлениеWenig beachtet blieb – vor allem in der deutschsprachigen Diskussion der letzten Jahrzehnte – ein Aspekt, der in den Beschreibungen des Phänomens Liturgie schon anklingt: Liturgie ist Ritual (Mitchell/137; Post/141 u. 142). Für die Liturgiewissenschaft, gleichgültig, ob sie sich für Theologie, Geschichte oder Fragen der Pastoral interessiert, ist die Beachtung der Ritualität gottesdienstlicher Feiern unverzichtbar, soll nicht eine wesentliche Dimension dieser Feiern ausgeblendet werden (Odenthal/138; Ritual Studies/233; Meßner/136). Zugleich stoßen Rituale in der Gesellschaft auf ein neues Interesse, das auch liturgiewissenschaftlich zu reflektieren ist.
Der Begriff »Ritual« wird heute so inflationär verwendet, dass einige Aspekte festgehalten werden müssen: Innerhalb der Liturgiewissenschaft bedeutet »Ritual« ein strukturiertes, in der Regel wiederholbares und stilisiertes Handeln, das von einer Gruppe sanktioniert ist. Rituale sind von einer Gemeinschaft verantwortetes Handeln in zentralen Lebenssituationen, insbesondere an Lebensübergängen (Übergangsrituale), in Krisen (Krisenrituale) und an kalendarisch fixierten Punkten (kalendarische Rituale). Im Einzelnen ermöglichen sie dem Individuum und der Gruppe den Vollzug eines Lebensübergangs, die Bewältigung einer Krise, die Fundierung und Erneuerung kollektiver Identität. Rituale verleihen darüber hinaus Erfahrungen symbolischen Ausdruck, die anders nicht adäquat artikuliert werden können; mehr noch: »Rituale sind … der Handlungsmodus der Symbole« (Luckmann/133: 177). Sie sind ein primäres Medium religiöser Äußerung. In ihnen liegt, und das ist mit Blick auf die Wahrnehmung von Liturgie entscheidend, ein besonderer Akzent auf der nichtsprachlichen Handlungsdimension und damit auf Sinnlichkeit und Leiblichkeit. Ohne die Bedeutung verbaler Elemente in Ritualen mindern zu wollen, kommt es in ihnen doch wesentlich auf das expressive Handlungsgeschehen an. In der Taufe sind entscheidende Riten das Übergießen mit Wasser oder das Untertauchen ins Wasser, die Salbung mit Chrisam, das Anlegen des Taufkleides und die Übergabe der Taufkerze. Der Übergang in den neuen Status des Christseins wird zwar in den Texten ausgesagt, sinnlich wahrgenommen aber in der Taufhandlung. In der Begräbnisliturgie findet man beeindruckende biblische Texte und Gebete, doch der Abschied vom Toten und die Hoffnung für ihn wird emotional dicht in Handlungen ausgedrückt: dem Einsenken des Sarges in das Grab, dem Besprengen des Sarges mit Weihwasser (Aspersion) oder seiner Inzens mit Weihrauch, dem Hinabwerfen von Erde auf den Sarg und dem Kreuzzeichen über dem Grab. Die Sprache trägt vor allem dazu bei, dass das Ritual eine Deutung im Sinne der Glaubensgemeinschaft erhält. Das Übergießen mit Taufwasser ist also weder primär ein Reinigungs- noch ein Erfrischungsritus, sondern ein Geschehen im Rahmen christlich gedeuteter Heilsgeschichte, wie Taufwasserweihe und Taufformel aussagen. Die Beerdigung eines Toten ist nicht nur Begraben und Verabschieden, sondern Ausdruck von Glaubenshoffnung auf Auferstehung, was durch die Begleittexte identifizierbar wird. Bei Ritualen, wie sie in der Liturgie begegnen, handelt es sich folglich um komplexe Vollzüge mit sehr differenzierten Binnenstrukturen und Bedeutungen.
Zu dieser Komplexität tragen verschiedene Charakteristika religiöser Rituale bei (Lang/128). In aller Regel sind sie als Handeln einer Gruppe angelegt und besitzen daher kollektiven Charakter. Sie sind stark durch Tradition und Vorschrift bestimmt. Die Traditionsbindung garantiert die Verbindung der Rituale mit der zentralen Überlieferung der jeweiligen religiösen Gruppe. Die katholische Theologie betrachtet heute als Mittelpunkt aller Liturgie das Pascha-Mysterium Jesu Christi; alle liturgischen Feiern sind mit Leiden, Tod, Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi verbunden, das heißt in umfassenderem Sinn verbunden mit der Heilsgeschichte von der Schöpfung bis hin zur Vollendung, von der Altes und Neues Testament sprechen. In diesen Ritualen geht es also um symbolisches Handeln, das nicht allein funktional beschrieben werden kann, sondern einen »Mehrwert« enthält und an einer anderen Wirklichkeit partizipiert. Inhalt und Form dieser Feiern regelt die Kirche über ein weiteres oder engeres Netz von Vorschriften. Die liturgischen Rituale sind formalisiert; so kehren beispielsweise bestimmte Handlungs- und Sprachmuster immer wieder, Rollen wie Handlungsabläufe sind festgelegt. Dies ermöglicht die Wiederholbarkeit der Rituale – ein ganz wesentlicher Zug gerade der Liturgie, der aber Varianz und Gestaltung nicht ausschließt.
Einige Grundbegriffe der Ritualforschung, die insbesondere für das Verständnis von Liturgie wichtig sind, sollen kurz erläutert werden (weiterführend: Ritual- und Ritualdynamik/145):
Performanz/Performance: Die Begriffe »Performanz« und »performativ« werden heute, etwa in den Kulturwissenschaften, in vielfältiger Weise verwendet (Performanz/587). Sie sind für die Liturgiewissenschaft von elementarer Bedeutung, weil sie Grundvollzüge auch des Gottesdienstes erfassen. Zunächst wird mit Performanz eine selbstwirksame Sprachhandlung bezeichnet. Indem sie ausgeführt wird, bewirkt sie etwas und setzt eine neue Wirklichkeit. Um Performativität zu verstehen, ist genau zu erfragen, welche Sprechakte hier von Bedeutung sind und wie sie mit nichtsprachlichen Handlungen und materiellen Medien zusammenwirken. Der Taufritus beispielsweise gliedert mit Wort und Handlung in Christus und die Gemeinschaft der Christgläubigen ein. Das Taufwort, das Übergießen mit Wasser oder das Untertauchen im Wasser und das Medium Wasser sind also in ihrem Zusammenspiel zu reflektieren.
Der Begriff bezeichnet aber auch die dramatische Performance (Tambiah/148: 226), also das gesamte Handlungsgeschehen, wie es gerade für die Taufe skizziert worden ist. Die Teilnehmer an einem Ritual verwenden für Dramatisierung und Darstellung ganz unterschiedliche Medien; zugleich verbindet sich für die Mitwirkenden mit solcher Art von Performanz intensive Erfahrung. Eine solche Performance ist auf die jeweilige Situation bezogen, lebt aus der Handlung und ist in der Art und Weise, wie sie im Detail begangen wird, einmalig. Es geht um darstellendes Handeln im Hier und Jetzt.
In einer solchen Performance spielen unter anderem Assoziation, Emotion und Intuition eine große Rolle. Rituale besitzen damit Qualitäten, die anderen Äußerungen von Religion nicht ohne weiteres zukommen. Sie bleiben mehrdeutig und entziehen sich im Letzten völliger Festlegung und Deutung. Ihr Überschuss an Zeichen macht sie für Assoziationen und Konnotationen offen, die eine Dynamik dieser Rituale und deren immer neue Rezeption ermöglichen.
Rahmung (Frames/Framing): Rituale sind Ereignisse, die unter anderem menschliche Wahrnehmung verändern. Rahmen oder Rahmung von Ritualen ermöglichen eine Metakommunikation, innerhalb derer Handlungen und Botschaften verstanden und Erfahrungen eingeordnet werden können (Bell/103: 72–76). Frames strukturieren durch Regeln und Konventionen, deuten und fordern zur Akzeptanz auf, lassen für das Ritual zugleich auch Verstehens- oder Interpretationsspielräume. Es werden Akzente gesetzt und bestimmte Aspekte des Rituals hervorgehoben. Rituelle Handlungen erhalten so gemeinschaftlich zugeschriebene Bedeutungen. Solche rituellen Erfahrungen können bis zu einem gewissen Grad miteinander geteilt werden. Zudem wird das Ritual durch Frames von seiner Umgebung abgesetzt und als solches markiert. Es erhält Identität. Mit Blick auf die Liturgie kann man an den liturgischen Raum oder den Zeitansatz (Christmette, Osternacht) als Rahmung, aber ebenso an Formeln und Gesten zu Eröffnung und Schluss einer Liturgie, die dieser eine bestimmte inhaltliche Richtung geben, denken.
Verkörperung: Rituale haben – das wird schon von ihrem performativen Charakter her deutlich – elementar mit dem menschlichen Körper zu tun. Die Akteure des Rituals handeln mit dem Körper (Subjekt) und am Körper (Objekt). Es geht also wiederum nicht allein um sprachliche Kommunikation. Vielmehr wird das, was im Ritual geschieht, körperlich-leiblich vollzogen (Salbung in der Krankensalbung; Handauflegung zum Segen; Aschenkreuz am Aschermittwoch). Entsprechend wird es emotional erlebt. Der Mensch ist mit allen Sinnen am Ritual als leiblicher Ausdruckshandlung beteiligt. Die ganze Person mit allen Sinnen und den unterschiedlichen Möglichkeiten ästhetischer Wahrnehmung ist einbezogen. Zudem vollzieht nicht nur das Individuum, sondern vollziehen möglicherweise alle am Ritual Beteiligten bestimmte Körperhaltungen wie -handlungen gemeinsam (Stehen, Schreiten, Knien, Handreichung als Friedensgruß, Kreuzzeichen).
Dynamik: Rituale sind wiedererkennbar und in ihren Grundmustern wiederholbar. Sie folgen gewissen Regeln, wie schon bei Frames/Framing deutlich wurde. Dennoch entspricht der eine Ablauf eines konkreten Rituals nie exakt der Durchführung eines anderen Rituals, auch wenn es sich in beiden Fällen um denselben Ritualtyp handelt. Die rituelle Performance ist jeweils einzigartig. Die Rituale sind also nicht unveränderlich, sondern unterliegen mit Akteuren, Mentalitäten, kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten usw. Veränderungen. Neben tradierten Ritualen entwickeln sich aufgrund veränderter Anforderungen neue, sodass das ganze Feld »Ritual« in Bewegung bleibt. Schließlich trägt auch die kritische Auseinandersetzung innerhalb einer Ritualgemeinschaft, die dann beispielsweise zu planvollen Veränderungen und neuer Gestaltgebung wie in einer Liturgiereform oder zu spontanen Normabweichungen führen kann, zur Dynamik von Ritualen bei.
Tradition: Es widerspricht nicht der Dynamik, wenn man zugleich das Ritual als Traditionsgeschehen beschreibt. Rituale oder einzelne Riten werden weitergegeben. Das geschieht durch Praxis, kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Gerade für Glaubensgemeinschaften, deren kulturelles Gedächtnis (vgl. unten 165f.) eng mit Ritualen verbunden ist, spielen Tradition und Tradierung eine große Rolle. Dabei können sich im Laufe der Tradition Rituale beispielsweise hinsichtlich ihrer Bedeutung verändern. Aus einer aus praktischen Gründen notwendigen Händewaschung in der Eucharistie wird so im Laufe der Liturgiegeschichte ein Ritus, der die innere Reinigung von Schuld ausdrücken soll.
Handlungskompetenz (Agency): Insbesondere für religiöse Rituale ist entscheidend, aber immer wieder auch umstritten, wer die Handlungskompetenz besitzt. Das gilt für die Durchführung des jeweiligen Rituals und ebenso für die Modellierung von Prozessen der Dynamik und Tradition. Spezialisten und anderen Akteuren (in der katholischen Kirche: Bischöfe, Priester und andere Gläubige), Glaubensgemeinschaft und Individuum, letztlich in der Perspektive der Gläubigen auch Gott kommt innerhalb des Rituals eigene Handlungsmacht zu. Wenn man nach der Agency im Kontext eines Rituals fragt, geht es u.a. darum, wer mit welcher Intention oder Legitimation handelt. Davon kann dann beispielsweise die Wirkung eines Rituals oder die berechtigte Veränderung und individuelle Gestaltung abhängen.
An einer Reihe unterschiedlicher Funktionen solcher Rituale hat auch die Liturgie Anteil, wobei von Liturgie zu Liturgie differenziert werden muss. Zu nennen ist die Bewältigung von Lebensübergängen durch die Rites de passage mit ihrer Dreigliederung von Trennung, Umwandlung und Angliederung (van Gennep/151). Einer der Lebensübergänge ist die Eingliederung in die Kirche und in das Christusgeschehen, die in der Taufe vollzogen wird; ganz andere Lebensübergänge sind die Hochzeit, die in der Trauung gefeiert wird, oder Sterben und Tod, für deren Bewältigung Sterbegebete, Viatikum und Begräbnis Hilfen bieten; sie erfüllen eine entlastende Funktion. Rituale können komplexe Wirklichkeiten verdichten, wie dies in der Liturgie etwa bei der Eucharistie oder beim Osterfest im Hinblick auf das Christusereignis zu beobachten ist. Zugleich werden in ihnen Überzeugungen inszeniert, beispielsweise in Prozessionen, in denen eine Glaubensüberzeugung für die kirchliche Gemeinschaft in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Diese rituelle Darstellung von Überzeugungen kann zugleich auf menschliches Handeln zurückwirken und dadurch Verhalten beeinflussen, sodass man Ritualen eine ethische Dimension zusprechen kann.
Die durchgeformte Handlung unterstützt die Entfaltung dieser Funktionen und damit die Wirkung von Ritualen. Sie ermöglicht, dass man sich auf ein Ritual einlassen, sich darauf verlassen kann. Denn das Ritual wird nicht jedes Mal neu kreiert, sondern erscheint als tradiert und unveränderbar; inwieweit dies für das einzelne Ritual wirklich zutrifft, ist jeweils zu prüfen. Generell haben Rituale die Tendenz, sich selbst als unveränderlich zu präsentieren. Der Blick auf Veränderungen und Umbrüche, die in der Liturgiegeschichte stattgefunden haben, und auf »erfundene«, also neue Rituale der Gegenwart mahnt hier allerdings zur Vorsicht.
Insgesamt kann man Rituale als symbolhafte Handlungen mit eigener Rationalität bezeichnen, die nach eigener Grammatik funktionieren und als komplexe Vorgänge einer kritischen wissenschaftlich-theologischen Reflexion sowie pastoraler Sorgfalt bedürfen. Es gibt unterschiedliche Rituale, die mannigfaltigen Situationen und Bedürfnissen im Leben von Gruppen und Gemeinschaften oder des Einzelnen entsprechen. Diese Vielfalt der Rituale korrespondiert der Vielfalt unterschiedlicher liturgischer Feiern.
Zugleich entspricht das wachsende Interesse am Rituellen in der Liturgie der Wiederentdeckung der Rituale in der Gesellschaft. Rituale spielen in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, aber auch im Leben des Einzelnen offensichtlich eine neue Rolle. Verhaltensunsicherheit, Empfindung von Leere, fehlende Ordnung von Lebensabläufen führen zur Neubelebung tradierter Rituale (zum Teil in neuen Kontexten und verändert in Inhalt und Form), bedingen aber auch die Schaffung ganz neuer Rituale. Deren besondere Kennzeichen sind Individualität und Kreativität – das Individuum schafft sich seine eigenen Rituale – und die Unabhängigkeit von Institutionen. Schon bei der Kennzeichnung solcher Rituale sind deutliche Unterschiede zum »traditionellen« Ritual zu erkennen, ebenso in den Funktionen, zu denen neben dem spirituellen Wachstum das Ordnen von Leben und Lebensräumen sowie Krisenbewältigung und Selbsterkenntnis zu rechnen sind (Lüddeckens/134). Solche Rituale sind flexibel gestaltbar und können sich mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen verbinden.
Für die Liturgiewissenschaft sind solche Phänomene aus zweierlei Gründen interessant: Zum einen dokumentieren sie ein verstärktes Interesse an symbolischem Handeln, das lange Zeit durch Liturgie in ihrer ganzen Vielfalt befriedigt wurde. Insbesondere Andachten, Segnungen, Prozessionen und Wallfahrten waren wesentliche Ausdrucksformen katholischen Glaubens. Der Verlust von Formenvielfalt ist problematisch, dies umso mehr, wenn in neuen Ritualen heute etwas gesucht wird, das ursprünglich durch kirchliche Rituale abgedeckt wurde.
Zum anderen beeinflussen sich Phänomene von Ritualität wechselseitig. Das, was in den neuen Ritualen gesucht wird, wird zugleich als Anfrage an die tradierte Liturgie herangetragen und beeinflusst diese in Gestalt und Deutung. Umso notwendiger sind für die Beschäftigung mit der Liturgie die Analyse der wiedererstarkten Rituale und eine differenzierte Wahrnehmung. In der Praxis wird man seitens der Kirche von neuen, frei gestalteten Ritualen, ihrer Lebensnähe und Ästhetik sowie der damit verbundenen Begleitung von Menschen auch lernen können. Zur wissenschaftlichen Reflexion gehört zugleich die kritische Sicht auf Rituale jeglicher Provenienz. So darf die suggestive und manipulative Kraft von Ritualen im Dienste von Ideologien aller Art nicht übersehen werden. Auch religiöse und kirchliche Rituale können entsprechend wirken. Nach dem Menschenbild von Ritualen ist zu fragen. Im gesellschaftlichen Umfeld ist an das Proprium christlicher Rituale zu erinnern: Das christliche Ritual vergegenwärtigt, dass Menschen in die Heilsgeschichte Gottes eingebunden und zur Freiheit berufen sind, in dieser Geschichte mitzuleben. In den Feierformen wird dem Menschen diese von Gott geschenkte Freiheit verkündigt; er wird ermutigt, diese Freiheit anzunehmen und zum Grund der eigenen Existenz zu machen. Das christliche Ritual kommt ohne diesen Bezug auf Heilsgeschichte nicht aus, will es nicht seine Mitte verlieren (Bieritz/104). Zum Pluralismus leistet die Theologie auch einen Beitrag, indem sie auf das Proprium christlicher Liturgie verweist und dieses zur Anfrage an rituelle Formen und Inhalte macht, die christlichen Überzeugungen und den Gedanken einer im Christlichen wurzelnden Aufklärung widersprechen (Kranemann/127).
Zugleich führen die neuen Rituale zur Ausdifferenzierung auch der kirchlichen Feierkultur und zur Erweiterung des Feierrepertoires. Diese neuen kirchlichen Feierformen versuchen auf Veränderungen in der Gesellschaft, gewandelte Glaubensvorstellungen, Wertsysteme oder Lebensformen zu reagieren. Man trifft auf Segnungsfeiern für Säuglinge, Segnungen von Kindern konfessionsloser Eltern, Lebenswendefeiern als Alternative zur Jugendweihe (Hauke/116; Handke/115), auf unterschiedliche Rituale der Trauer und des Totengedenkens (Handbuch Bestattung/143), auf Formen des Wortgottesdienstes oder auch christlicher Feste, die auf Großstadt oder säkulares Milieu hin adaptiert oder neu geschaffen wurden, und dergleichen mehr (Gott feiern/114). Segnungsfeiern für wiederverheiratete Geschiedene oder für gleichgeschlechtliche Paare belegen, wie in der liturgischen Praxis auf Veränderungen menschlicher Lebensformen und »Zeichen der Zeit« reagiert wird, und zwar vorgängig zu Veränderungen in der kirchlichen Lehre oder in liturgischen Ordnungen. Der religiöse Pluralismus wird von kirchlichen Feierformen her als Möglichkeit authentischer Gläubigkeit und als Kontext der Glaubensartikulation wahrgenommen (Christliche Rituale/107).