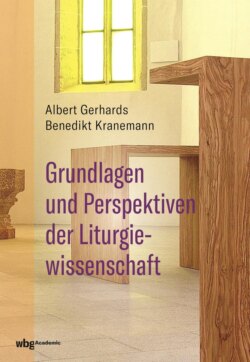Читать книгу Grundlagen und Perspektiven der Liturgiewissenschaft - Albert Gerhards - Страница 12
2 Geschichte, Profil und Methoden des Faches Liturgiewissenschaft 2.1 Das Selbstverständnis der Liturgiewissenschaft
ОглавлениеDie Liturgiewissenschaft ist jene Disziplin innerhalb der Theologie, die sich mit dem Ausdruck des christlichen Glaubens in den unterschiedlichen Traditionen und Formen des Gottesdienstes beschäftigt. Es handelt sich um ein Fach mit eigenem Forschungsprofil und entsprechenden Lehraufgaben innerhalb der katholischen Theologie. In der evangelischen Theologie wird die liturgiewissenschaftliche Ausbildung von den Lehrstühlen für Praktische Theologie vertreten. Die orthodoxe Theologie kennt ebenfalls eine Liturgik, begreift aber liturgische Erfahrung viel stärker, als dies in der westlichen Theologie der Fall ist, als Norm und Quelle der Theologie (zur katholischen und evangelischen Theologie vgl. Liturgiewissenschaft/219; Liturgiewissenschaft im 21. Jahrhundert/220; Liturgie lernen/217; Meyer-Blanck/39; zur Orthodoxie vgl. Felmy/173). In diesen unterschiedlichen wissenschaftlichen Kulturen äußern sich bereits Traditionen und Ausprägungen der verschiedenen christlichen Kirchen.
Die Liturgiewissenschaft erhält ihr Profil durch die Auseinandersetzung mit dem Gottesdienst als einem Handlungsgeschehen. Sie beschäftigt sich also nicht allein mit Sprachgeschehen, sondern ebenso mit Zeichen und Zeichenhandlungen bis hin zu Raum, Gewändern, Klang, Farbe usw. Sie untersucht ein komplexes Ritual, in dem Christen ihren Glauben in expressiver Weise ausüben. Dass von diesem Ritual her nach dem christlichen Glauben gefragt und dabei die sinnenhafte Dimension christlichen Glaubens einbezogen wird, unterscheidet den methodischen Zugang der Liturgiewissenschaft markant von dem anderer theologischer Disziplinen. Am Beispiel des zentralen Gebets der Eucharistiefeier, des eucharistischen Hochgebets (vgl. Anhang 2.3), wird dies deutlich. Will man ein solches Gebet und seine liturgietheologisch begründete Grundstruktur sachgerecht interpretieren, so ist nach seiner Genese, seiner heutigen Funktion im Zusammenhang der Eucharistiefeier und der Messfeier insgesamt, nach den begleitenden Zeichenhandlungen und der Pragmatik des Gebetstextes zu fragen. Die Frageperspektiven lassen sich bündeln: Wie ist der Text entstanden (Liturgiegeschichte)? Welche theologischen Aussagen lassen sich ihm entnehmen (Liturgietheologie)? Welche Kriteriologie ist bei der Gestaltgebung und der gefeierten Liturgie heute anzulegen (Praktische Liturgiewissenschaft)? Spricht er heute noch? Wie wird er verstanden?
Von grundlegender Bedeutung ist der Blick auf die Liturgien anderer christlicher Konfessionen und damit der ökumenische Aspekt der Liturgiewissenschaft. Eine »ökumenische Liturgiewissenschaft« arbeitet vergleichend, ist an Unterschieden wie Gemeinsamkeiten, Parallelentwicklungen wie Abhängigkeiten zwischen den Liturgien der verschiedenen Kirchen und ihren Theologien interessiert. Sie ermöglicht einen kritischen Blick auf die einzelne Liturgie durch Vergleich mit den Nachbarliturgien. Zudem liefert sie wichtige Erkenntnisse für die Ökumene insgesamt (Lurz/225; Kranemann/124).
Nicht nur die Liturgie der katholischen Kirche, sondern auch der Gottesdienst anderer Kirchen und Religionen ist heute im Blick des Faches. Aufgrund der Geschichte des Christentums und seines Gottesdienstes fragt die Liturgiewissenschaft nach dem Verhältnis der christlichen zur jüdischen Liturgie. Dabei sind die Gestalt, aber vor allem auch die Theologie der verschiedenen Feiern im Blick (Dialog/295; Rouwhorst/248). In einer religiös pluralen Gesellschaft, in der multi- oder interreligiöse Feiern immer häufiger begangen werden, sind auch Liturgien, Gebete und Riten anderer Religionen Forschungsgegenstand (Leben und Feiern/363).
In einer Standortbestimmung haben 1991 die deutschsprachigen Liturgiewissenschaftler ihr wissenschaftliches Selbstverständnis formuliert. Liturgiewissenschaft versteht sich demnach als eine Disziplin, die Anthropologie und Theologie des Gottesdienstes reflektiert. Wesentliche Aspekte sind dabei Tradition, Ökumene und Inkulturation. Neben den tradierten historischen, systematisch-theologischen und praktisch-theologischen Methoden werden auch Zugangsweisen der Humanwissenschaften genannt, die sich mit dem Menschen und seinen Ausdrucksformen beschäftigen (Gerhards – Osterholt-Kootz/182). Sie müssen heute um kulturanthropologische Fragestellungen erweitert werden