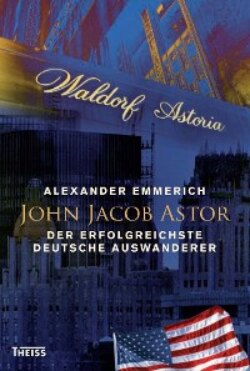Читать книгу John Jacob Astor - Alexander Emmerich - Страница 14
Ankunft in New York
ОглавлениеJohn Jacob Astor war nicht, wie die meisten deutschen Immigranten seiner Zeit, weiter nach Pennsylvania gezogen, wo er sich in einer deutschen Gemeinde hätte niederlassen können, ohne sich mit der amerikanischen Gesellschaft seiner neuen Heimat auseinandersetzen zu müssen. Astors Ziel war New York und nicht ein mögliches „New Walldorf“. Er wollte in das pulsierende Leben dieser amerikanischen Stadt eintauchen, die er aus Heinrichs Briefen kannte. Unter der zahlungskräftigen Oberschicht vermutete er genügend Kundschaft und Kaufkraft für seine Instrumente, denn diese Schicht hatte das Geld und die Zeit, sich mit Musik zu beschäftigen. Darüber hinaus erhoffte er sich von seinem Bruder eine ähnliche Unterstützung, wie er sie von George in London erfahren hatte.
Im Frühling des Jahres 1784 erreichte Astor New York und freute sich, nach neun Jahren endlich den Bruder wieder zu sehen. Henry, wie sich Astors Bruder Heinrich in der neuen Welt nannte, hatte seit seinem Aufbruch aus Walldorf ein aufregendes Leben geführt. Er hatte sich freiwillig als Söldner gemeldet und war für die Briten in den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gezogen. Aufgrund ihrer Herkunft wurden diese Soldaten Hessians, hessische Soldaten, genannt, auch wenn sie nicht alle aus Hessen stammten. In Nordamerika angekommen, folgte Henry zunächst seinem Auftrag und kämpfte für die englische Krone. Nach kurzer Zeit als Soldat verließ er die Truppen jedoch und ließ sich in New York als Metzger nieder. Nach dem Frieden von Paris im Jahr 1783 wurde er, wie alle Bewohner der ehemaligen Kolonien, amerikanischer Staatsbürger. Bereits einige Wochen zuvor, am 14. März 1784, hatte Henry mit der Deutsch-Amerikanerin Dorothy Pessenger den Bund fürs Leben geschlossen. Dorothy war die Stieftochter des deutschstämmigen Metzgers John Pessenger.
Den Gewohnheiten dieser Zeit entsprechend, verkaufte Henry seine Ware täglich an einem Marktstand am Bull’s Head. Jeden Morgen baute er seinen kleinen Stand auf und verkaufte das frisch geschlachtete Fleisch. Mit der Hilfe seiner Gattin schaffte er es schließlich, einen Stand am größeren Fly Market am East River in Lower Manhattan zu ergattern, wo er mehr Profit erwirtschaften konnte. Im Laufe der Zeit hatte Henry Astor mit seiner Arbeit Erfolg. Die bescheidene Schubkarre, mit der er in der Anfangszeit das Fleisch zu seinem Stand brachte, ersetzte er durch ein Pferd und einen Wagen und konnte somit einen größeren Stand unterhalten. Er und seine Frau ergänzten sich in Fleiß und Sparsamkeit. Doch finanziell ging es Henry in der Zeit, als John Jacob in New York ankam, bei weitem nicht so gut wie George in London. Er lebte zusammen mit seiner Frau in einem kleinen Haus an der Ecke First/Fischer Street an der Lower East Side zur Miete. Erst später erarbeiteten sich Henry und Dorothy das Geld für ein eigenes Haus an der Bowery Lane im späteren Little Germany und heutigen China Town.
Wegen des Platzmangels brachte Henry seinen jüngeren Bruder bei einem Freund, dem deutschstämmigen Bäcker George Dieterich, unter. John Jacob konnte nicht nur bei Dieterich wohnen, er half ihm auch als Laufbursche für die Bäckerei. Durch diese Tätigkeit lernte John Jacob in kurzer Zeit die neue Stadt kennen. Täglich lief er durch ihre Straßen und lieferte Brot und Kuchen aus. Mit der Hilfe Henrys und Dieterichs wurde John Jacob schnell in den Kreis der Deutsch-Amerikaner in New York eingeführt. Die Fremde schien ihm nicht allzu fremd, da sich neben seinem Bruder und dessen Frau auch Dieterich darum bemühte, ihm einen guten Start in New York zu ermöglichen. Außerdem brachte Astor einen großen Vorteil mit, der ihn von den meisten anderen deutschen Einwanderern unterschied: Er sprach bereits Englisch und konnte sich so mit fast jedem – nicht nur mit den Deutsch-Amerikanern – verständigen.
Henry führte seinen Bruder auch in die Kirchengemeinde der German Reformed Church of New York ein, in der sich John Jacob in den nächsten Jahren stark engagierte. Er war nicht nur ein regelmäßiger Besucher der Kirche, von 1791 bis 1797 übernahm er auch das Amt des Schatzmeisters und verwaltete die Finanzen der Gemeinde, in deren Dienst er seine kaufmännischen Talente ehrenamtlich stellte.
Mit der Gründung der German Society of the City of New York im Jahr 1784 entstand ein weiterer Bezugspunkt für die Deutschen in New York. Die nach dem Vorbild der German Society of Philadelphia gegründete Gesellschaft machte es sich zum Ziel, deutschen Einwanderern eine Starthilfe in New York zu geben und durch eigene Schriften bereits in der deutschen Heimat über das Wesen und die Gefahren der Auswanderung aufzuklären. Henry Astor trat dieser Gesellschaft 1785 bei. Dem Beispiel des älteren Bruders folgend, wurde auch John Jacob zwei Jahre später ein Mitglied der German Society. Allerdings blieb John Jacob den meisten Jahrestreffen bis in die 1830er Jahre hinein fern. Das deutsch-amerikanische Leben interessierte ihn bei weitem nicht so sehr wie das der etablierten amerikanischen Oberschicht.
Astor bemühte sich, in New York geschäftlich Fuß zu fassen. Hier gab es jede Menge Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten für ihn. Anders als in der alten Heimat spielten in New York weder seine Religionszugehörigkeit noch sein sozialer Status eine Rolle. Auch Astors deutsche Wurzeln waren in dieser Zeit kein gesellschaftliches Hindernis. Die Botschaft der Unabhängigkeitserklärung und die darin proklamierten unveräußerlichen Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück beherrschten die Vorstellung einer funktionierenden Gesellschaft. Es lag nun in seinen eigenen Händen, den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen.
Astor spürte, dass er in dieser Stadt eine Chance hatte. So verließ er die Dienste von George Dieterich nach wenigen Monaten. Sein Ehrgeiz ließ ihm keine Ruhe. Oft dachte er dabei an seinen alten Lehrer Jeune zurück, der stolz auf ihn gewesen wäre. Der Verdienst als Bäckerjunge hatte ihm einen guten Start ermöglicht, doch nun wollte er den Instrumentenhandel mit George ausbauen und sich zudem mit dem Markt für Pelze beschäftigen, von dem Emerick ihm auf dem Schiff erzählt hatte. Vorsichtig beobachtete er die wenigen, kleinen Pelzhändler in New York. Wer waren die Kunden? Woher kamen die Pelze und wie groß war das Angebot? Wie konnte man am besten Gewinn erzielen? Um all das zu erfahren, begab er sich in die Dienste des erfolgreichen Pelzhändlers Robert Bowne. Der Kaufmann nahm Astor gerne an, er schätzte den Ehrgeiz und Fleiß des jungen Deutschen. Bereitwillig gab er ihm seine Erfahrungen aus dem Pelzgeschäft weiter. John Jacob machte in Bownes Laden die Pelze verkaufsfertig und übernahm zugleich einige kaufmännische Aufgaben. Zudem lernte er von ihm, wie Pelze zu verarbeiten waren, wo sie günstig zu erwerben waren und wer in New York an ihnen interessiert war.
In der Zwischenzeit hatte George die erste Lieferung Instrumente aus London geschickt, die Astor nun in seinem neuen kleinen Zimmer, das er von der reichen Witwe Sarah Todd gemietet hatte, aufbewahrte. Um seine Käufer zu erreichen, inserierte er ab dem 20. September 1784 regelmäßig in der wichtigen New Yorker Zeitung New York Packet folgende Zeilen: „Deutsche Flöten von allerbester Qualität – zu Erwerben im Verlagshaus.“ Diese Werbung wiederholte er in unregelmäßigen Abständen bis zum 10. März 1785. Da er nur ein kleines Zimmer und noch keine eigenen Geschäftsräume besaß, verkaufte er seine Produkte gegen eine kleine Provision im Verlagsgebäude der Zeitung. Die Flöten verkauften sich so gut, dass George und John Jacob es riskierten, weitere und größere Instrumente von London nach New York zu verschiffen. Kurz nach Neujahr kam die nächste Lieferung. Astor hatte nun etwas mehr Geld zur Verfügung und konnte sich ab dem 27. Januar ein längeres Inserat leisten. Zudem wurden die Instrumente, die er importierte, immer größer. Er hatte eine Orgel von London über den Atlantik gebracht: „Gerade importiert und zum Verkauf bereit: Eine Zimmerorgel mit Orgelregister, deutsche Flöten mit Silber verziert.“ Der Import von Instrumenten aus Europa war von Beginn an sehr lukrativ, und Astor konnte die Geschäfte neben der Anstellung bei Bowne abwickeln. Nur wenige Monate nach seiner Ankunft hatte es der ehrgeizige junge Mann geschafft, sich – noch in bescheidenem Maße – im Transatlantikhandel zu etablieren.
Auch in seinem Privatleben sollte sich bald etwas bewegen: Seit kurzer Zeit war John Jacob die Tochter seiner Vermieterin aufgefallen, die wie ihre Mutter Sarah hieß. Ihr Vater Adam Todd war bereits 15 Jahre zuvor gestorben, und ihre Mutter freute sich über das Interesse des geschäftstüchtigen jungen Deutschen an ihrer Tochter. Sarahs Familie war schottischer Abstammung und lebte schon lange in Nordamerika. Sie war fest in New York verankert und unterhielt vorzügliche Kontakte zu Kaufleuten und Reedern. Der umtriebige junge Deutsche gefiel Sarah, auch wenn er keinesfalls ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprach. Dennoch verliebten die beiden sich ineinander und beschlossen nach einigen Monaten zu heiraten. Auf die Frage einer Enkelin, warum John Jacob Sarah geheiratet habe, soll der alternde Astor mit einem Seufzer der Erinnerung an seine verstorbene Frau geantwortet haben: „Weil Sie so schön war, meine liebe Enkelin.“
Nachdem Astor um die Hand Sarahs angehalten hatte, fand die feierliche Hochzeitszeremonie am 19. September 1785 in der deutsch-reformierten Kirche New Yorks statt. Mit dieser Ehe zeigte sich einmal mehr Astors Ausnahmerolle als Einwanderer. Üblicherweise heiratete die erste Generation der Einwanderer innerhalb ihrer Gruppe, wie beispielsweise sein Bruder Henry. John Jacob demonstrierte mit der Wahl seiner Gattin sein hohes Bestreben, ein Teil der Neuen Welt zu werden. Fortan wurde in seinem Haus englisch gesprochen. Bereits in der Chronik der Gemeinde Walldorf von 1888 erkannte Pfarrer Ludwig Stocker dieses ungewöhnliche Verhalten. Für den Walldorfer Chronisten war Astor von diesem Zeitpunkt an kein deutscher Einwanderer mehr, sondern ein wirklicher Amerikaner: „Mit einer Amerikanerin verheirathet und selbst so Amerikaner geworden.“
Die Ehe mit Sarah hatte für John Jacob noch weitere, rein materielle Vorteile. Sarah brachte neben einer Mitgift vor allem ein eigenes Haus in der Queen Street 81 mit Geschäftsräumen im Erdgeschoss mit in die Ehe und bescherte so ihrem ehrgeizigen Mann wirtschaftliche Unabhängigkeit. Bald nach der Hochzeit verließ Astor daher die Dienste Bownes und richtete zusammen mit seiner Frau einen gemeinsamen Laden ein. Die fromme und geschäftstüchtige Sarah war für John Jacob nicht nur eine liebevolle Ehefrau, sondern zudem eine wichtige Geschäftspartnerin, die sich während der Abwesenheit ihres Gatten in den kommenden Jahren selbstständig um den gemeinsamen Laden und die Kundschaft kümmerte.
Doch als viel wichtiger als das kleine Vermögen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit erwies sich Sarahs soziales Netzwerk. Ihre gesellschaftlichen Beziehungen zu den hohen Kreisen New Yorks waren für Astors Karriere von entscheidender Bedeutung. Gerade die Verbindungen über Sarahs Bruder Adam, der als Kapitän enge Geschäftsbeziehungen zu diversen anderen Kapitänen und Reedern hatte, waren für John Jacobs Importgeschäfte von großem Wert. Darüber hinaus ergaben sich für Astor über Sarahs Halbgeschwister aus der ersten Ehe ihres Vaters weitere nutzbare, geschäftliche Verbindungen zu wichtigen New Yorker Kaufleuten. Sarahs Neffe, John Whetten, war Schiffsoffizier und besaß ebenfalls gute Kontakte zum Reedereigeschäft. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Astor häufig mit ihm zusammen und beauftragte ihn wiederholt mit dem Kommando über eines seiner Schiffe. Dieses gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Netzwerk war der Grundstock für Astors späteres Handelsimperium.
Von nun an handelte der frischgebackene Ehemann ausschließlich als selbstständiger Kaufmann. Wenn gerade keine Instrumentenlieferung aus London kam, verkaufte er Spielsachen und andere kleinere Waren deutscher Herkunft. Wie er es vorausgesehen hatte, war die New Yorker Oberschicht nach dem langen Unabhängigkeitskrieg stark an hochwertigen Luxusgütern aus Europa interessiert. Astor spürte das und weitete den Import von Instrumenten aus, wie seine Inserate im New York Packet ab dem 22. Mai 1786 zeigen: „Gerade aus London eingetroffen: Ein elegantes Sortiment an Musikinstrumenten. Pianofortes, Spinette, die besten Violinen, deutsche Flöten, Klarinetten… und weitere Saiteninstrumente, Musikbücher und Notenblätter.“ Diese Anzeige wiederholte er mit Unterbrechungen in den nächsten zwei Monaten. Auch im nächsten Jahr erschienen Anzeigen gleicher Art im New York Packet. Dem jungen Deutschen war es mit seinem Sortiment gelungen, eine zahlungskräftige Bevölkerungsschicht anzusprechen, deren Bedürfnisse zu wecken und diese zu bedienen. Immerhin besaßen die US-Präsidenten Thomas Jefferson, James Monroe und James K. Polk alle ein Astor-Klavier. Zudem eröffnete er sich auf diese Weise weiteren Zugang zu den Kreisen der höheren New Yorker Gesellschaft, der er selbst gerne angehören wollte.
Doch Astor gab sich mit dem gut laufenden Instrumentenhandel nicht zufrieden. Er ahnte, dass unter seiner Kundschaft auch eine Nachfrage nach Pelzen bestand. Dieses Luxusgut war überaus begehrt, und die New Yorker zahlten immense Summen dafür. Nun wollte Astor seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Bowne nutzen und Pelze in die Vereinigten Staaten importieren. Zu jener Zeit war dieser Markt allerdings noch fest in den Händen der britischen Handelsgesellschaften in Kanada. Sie beherrschten den gesamten nordamerikanischen Markt. Aufgrund dieser starken Konkurrenz aus dem Norden sowie ihrer effektiven Organisation hatten bislang nur wenige amerikanische Händler versucht, im großen Stil im Pelzgeschäft Fuß zu fassen. Kaum ein amerikanischer Kaufmann begab sich ins kanadische Montreal, wo sich der größte Umschlagplatz für Pelze in der damaligen Zeit befand. Die dort gekauften Waren mussten von den amerikanischen Händlern aufgrund des britischen Zollgesetzes zunächst nach London verschifft werden, um dort verzollt zu werden. Dann durften sie wieder in die USA eingeführt werden. Doch Astor hatte mittlerweile genügend Erfahrung im Import von Gütern aus London gesammelt, um sich auf dieses lukrative wie riskante Geschäft einzulassen. Zudem konnte er auf die Unterstützung seines Bruders George in London zählen, der die Verzollung der Pelze überwachen und sie weiter nach New York verschicken sollte.
Am 29. April 1788 erschien erstmals eine Werbeanzeige im New York Packet, in der Astor nicht nur seine aus London importierten Instrumente anbot, sondern für den An- und Verkauf von Pelzen warb. Dem üblichen Text seiner Anzeige fügte Astor folgende Zeile hinzu: „Ich kaufe und verkaufe gegen Bargeld jede Art von Pelz.“
Das Importgeschäft der Instrumente bildete für Astor das Grundkapital und zudem die finanzielle Freiheit, sich intensiver mit dem amerikanischen Pelzhandel zu befassen. Astor witterte seine Chance, da andere Kaufleute zunächst vor dem Pelzhandel zurückschreckten. Sukzessive besetzte er die Nische. John Jacob Astors Urenkel, der Viscount William Waldorf Astor, formulierte die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immens gewachsene Bedeutung des Pelzhandels rückblickend folgendermaßen: „Die lukrativen Gewinne des Pelzhandels sind mit dem späteren Goldrausch in Kalifornien vergleichbar. Beide waren das ‚El Dorado‘ ihrer Zeit. Beide gaben Tausenden direkt oder indirekt Arbeit. Und in beiden Feldern herrschte ein intensiver Wettbewerb.“