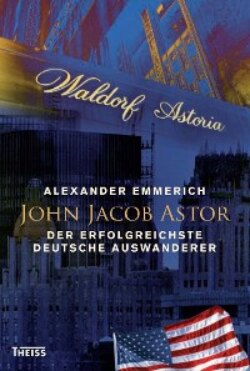Читать книгу John Jacob Astor - Alexander Emmerich - Страница 6
ОглавлениеEINLEITUNG
Auf die Frage, was zu dem Namen „Astor“ einfällt, erhält man vielfältige Antworten. Häufig werden Verbindungen zur Populärkultur hergestellt: Hieß das Kino in der ARD-Serie Lindenstraße nicht so, und eines der Traumschiffe des ZDF? Wer sich näher mit der Kinowelt auskennt, nennt vielleicht die bis 1956 existierende amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Astor Pictures oder die Schauspielerin Lucile Langhanke, deren Karriere erst begann, als sie sich 1921 den Künstlernamen Mary Astor gab. Auch Margret kommt in den Sinn, Kosmetik aus dem Hause Astor. Oder die Zigarettenmarke Astor mit der eleganten roten Packung. War da nicht ein John Jacob Astor IV., der im Jahr 1912 beim Untergang der Titanic starb?
Was aber den meisten nach kurzem Nachdenken einfällt, ist das Waldorf-Astoria, das berühmte Hotel – und man taucht in Gedanken ein in den Glamour und die Eleganz der New Yorker Schönen und Reichen. In allen bedeutenden Städten der Welt trifft man heute auf Nachahmer, die sich im Glanz dieses Namens sonnen. Leuchtende Augen bekommen auch diejenigen, die schon in New York waren: Astor Place, Astor Boulevard, der Stadtteil Astoria, die ehemalige Astor-Library – der Name weckt Erinnerungen. Auch heißen viele Städte in den USA Astoria. Aber manche kennen auch das süddeutsche Städtchen Walldorf bei Heidelberg. Hier ist der Name allgegenwärtig: das Astorhaus, die Johann-Jakob-Astor-Straße, der örtliche Fussballverein FC-Astoria Walldorf.
Und damit sind wir schon mitten in der Geschichte, haben quasi die geographischen Eckpunkte gesetzt. Die Astors waren eine New Yorker Familie, die zusammen mit den Rockefellers, Vanderbilts, Morgans und Carnegies im Gilded Age, dem von Mark Twain so betitelten vergoldeten Zeitalter, am Ende des 19. Jahrhunderts den Geldadel der Metropole ausmachten. Sie lebten dort wie diesseits des Atlantiks die europäischen Fürsten, genossen ihren Reichtum, förderten Kunst und Kultur und kümmerten sich ebenso um soziale Belange. Aber die Astors waren mehr als das, sie waren die erste Familie, die diesen legendären Status der Superreichen erlangte. Doch woher kamen sie? Wo liegt der Ursprung dieser Dynastie? Und woher kam ihr immenser Reichtum?
Der Wohlstand der Astors geht auf den Stammvater der Familie zurück: Johann Jacob Astor (1763–1848). Er war nahezu mittellos aus Walldorf bei Heidelberg nach Amerika ausgewandert. Und als er starb, hinterließ er neben Aktien, zwei Hotels, einem Theater und unzähligen bebauten und unbebauten Grundstücken auf Manhattan die für die damalige Zeit unvorstellbare Summe von 20 Millionen Dollar. Das Forbes Magazine berechnete für das Vermögen und den Besitz zum Zeitpunkt seines Todes den heutigen Gegenwert von 110 Milliarden Dollar. Somit kann Astor als der viertreichste Amerikaner aller Zeiten gelten, doppelt so reich wie Microsoft-Gründer Bill Gates.
Nie zuvor hatte ein amerikanischer Einwanderer einen vergleichbar steilen Aufstieg erlebt, niemand hatte vor ihm annähernd so viel Geld – und niemand konnte sich ein derartiges Vermögen vorstellen. Johann Jacob Astor ist dabei keinem Vorbild gefolgt, weil es schlicht und einfach vor ihm keine vergleichbare Karriere gegeben hatte. Weder die Idee noch der Begriff des American Dream existierten, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten war noch nicht als solches benannt, die Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär beschrieb Horatio Alger erst in den 1860 er Jahren – zwei Jahrzehnte nach Astors Tod. Selbst der Gebrauch des ursprünglich französischen Wortes millionaire ist für die Vereinigten Staaten erst für die 1840 er Jahre belegbar, als Astor bereits ‚Multimillionär‘ war. Er hatte seinen amerikanischen Traum von Aufstieg und wirtschaftlicher Freiheit verwirklicht, bevor andere, Amerikaner wie Europäer, davon zu träumen begannen.
John Jacob Astor stand als erfolgreichster Geschäftsmann seiner Zeit natürlich im Licht der Öffentlichkeit. Obwohl ihm sein gutes Ansehen immer sehr wichtig war, wurde ihm nicht nur Bewunderung zuteil, der unglaubliche Reichtum forderte ebenso Kritik heraus. Nach seinem Tod gewannen Neid und Missgunst bis hin zur Diffamierung die Oberhand. Zu seinen Lebzeiten schilderten Autoren seine Karriere vom armen Einwanderer zu einer der führenden Persönlichkeiten der amerikanischen Wirtschaft noch weitgehend unkritisch und durchweg positiv. So zum Beispiel die Kurzbiographie von David Jacques aus dem Jahr 1844 im Hunt’s Merchant Magazine, einem der meistgelesenen Magazine dieser Zeit, oder die Darstellung seines Lebens von Moses Yale Beach in Wealth and Biography of the Wealthy Citizens of the City of New York von 1845. Danach entstand in der öffentlichen Wahrnehmung ein anderes Bild: Das Image des geizigen, alten Millionärs, wie er uns in der Figur des Ebeneezer Scrooge in der Erzählung A Christmas Carol von Charles Dickens begegnet. Als der berühmte englische Schriftsteller zum ersten Mal die USA bereiste, kam er auch nach New York, wo die High Society ihm einen rauschenden Empfang bereitete. Zu seinen Ehren wurde ein großer Ballabend sowie in den Wochen danach mehrere Dinner organisiert. Bei einem festlichen Abendessen am 19. Februar 1842 im City Hotel, dem ersten Hotel John Jacob Astors, lernte er den schon hochbetagten Mann persönlich kennen. Dickens zeigte sich während seines Aufenthaltes äußerst höflich und von der amerikanischen Lebensweise beeindruckt. Als er aber wieder nach England zurückgekehrt war, begann er, sich öffentlich in negativer Weise über New York City, die New Yorker Gesellschaft und die USA im Allgemeinen zu äußern. Neben mehreren antiamerikanischen Zeitungsartikeln veröffentlichte Charles Dickens nur wenige Monate nach seiner Rückkehr seine berühmt gewordene Weihnachtsgeschichte. Die Begegnung mit John Jacob Astor soll ihn zu der Geschichte des reichen, aber geizigen alten Mannes inspiriert haben, der durch den Geist der Weihnacht wieder zu Mitgefühl und Hilfsbereitschaft gebracht wird. Seither wurde dieses Image häufig in oberflächlichen Dokumentationen zu Astor, in Sammelbiographien von Millionären oder in populären Darstellungen bemüht. Warum geriet das zunächst positive Bild Astors in seinem Alter ins Wanken? Weshalb kehrte es sich nach seinem Tod Ende März des Jahres 1848 in sein Gegenteil? Welches Bild konnte sich in der Öffentlichkeit bis heute behaupten? Was trug die historische Forschung zur Wahrheit über John Jacob Astor bei?
Die New Yorker Tageszeitungen berichteten damals wochenlang über das Leben John Jacob Astors auf ihren Titelseiten. Mit der Veröffentlichung des Testaments in der New York True Sun am 30. März 1848 wurde die Höhe des Nachlasses bekannt, an der sich die Gemüter der New Yorker Öffentlichkeit erhitzten. Da nie zuvor eine solch unvorstellbare Summe vererbt wurde, mussten die ethischen Grundsätze und auch gesetzliche Reglementierungen erst ausdiskutiert werden. In einer Reihe von Artikeln wurden die Ideale des Republikanismus zum ersten Mal mit den Auswirkungen des Wirtschaftsliberalismus konfrontiert. Astor kam dabei schlecht weg, er wurde als geldgieriger Kapitalist und unrepublikanischer Geizhals dargestellt: „Er war tüchtig im Geldscheffeln, aber er war geizig und knauserig. Was er kriegen konnte, behielt er, und verschloss es bis zum Tag seines Todes.“ In einem Leitartikel vom 5. April gipfelten die Angriffe in der Forderung: Da der Verstorbene sein Vermögen mit Grundstücksspekulationen, also auf Kosten der New Yorker Bürger gemacht habe, müsse ein Großteil des Vermögens an die New Yorker Gesellschaft zurückfließen.
Nach einigen Wochen verebbte die Berichterstattung der New Yorker Zeitungen schließlich, die öffentliche Diskussion aber hielt an. Ein Jahr später diente Astor dem Father of American Education und Mitglied des Parlaments von Massachusetts, Horace Mann, in einem berühmt gewordenen Vortrag zum 29. Jahrestag der Boston Mercantile Library Association als Negativbeispiel, um eindringlich vor den Gefahren eines Millionenvermögens zu warnen: „Astor war der Bekannteste, der Vermögendste, und – berücksichtigt man seine unermesslichen Geldmittel – der Geizigste seiner Klasse in diesem Land. Nichts außer Unzurechnungsfähigkeit kann dies entschuldigen.“
Im Gegensatz dazu propagierten auf der anderen Seite des Atlantiks deutsche Auswandererzeitschriften das gesamte 19. Jahrhundert hindurch Astor stets als Paradebeispiel einer geglückten Auswanderung und erklärten seinen Erfolg durch seine ‚deutschen Tugenden‘. Dagegen stellte die Propaganda des Dritten Reichs Astor als ‚undeutsch‘ dar. Emil Bode charakterisierte die Familie in einer nationalsozialistischen Schrift gar als „Deutsche, die ihr Deutschtum aufgegeben haben“. Im Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums wird Astor vorgeworfen, er habe die Entfaltungsmöglichkeiten in den USA nur für seinen eigenen Machtgewinn und Wohlstand genutzt. Der „deutsche Betrachter [schaut] mit Schrecken und Trauer auf das Leben dieses Mannes“, bei dem der Autor „keine Verbindung zwischen dem Geist des deutschen Volkes und diesem Manne“ sah. Für so jemanden sei in der ‚Volksgemeinschaft‘ kein Platz. Seine Karriere diente der NS-Propaganda als Stereotyp für die Dekadenz der amerikanischen Plutokratie, um zu zeigen, dass die USA moralisch und ideologisch marode und geschwächt seien.
Von Historikern wurde Astor trotz seiner Berühmtheit kaum beachtet. Eine Ausnahme bilden die 1920/30 er Jahre, die Zeit der Großen Depression und der Weltwirtschaftskrise in Amerika. In jener Zeit erschien die zweibändige Lebensdarstellung Astors von Kenneth Wiggins Porter, einem Professor an der Harvard University. Allerdings stand in Porters Studie nicht die Person Astors, sondern vielmehr die Geschäftspolitik seiner Unternehmungen im Mittelpunkt. Diese wirtschaftsgeschichtlich ausgerichtete Biographie beruhte erstmalig nicht nur auf Anekdoten und Gerüchten, die in der Öffentlichkeit kursierten. Porter verwendete für seine Studie Geschäftspapiere sowie private und geschäftliche Briefwechsel. Die zweite wissenschaftliche Studie wurde im Jahr 1991 von John D. Haeger verfasst. Haeger konzentrierte sich mit seiner wirtschaftshistorischen Studie auf den Aufbau des Pelzhandels und die Immobiliengeschäfte Astors. Er führte somit die von Porter begonnene Arbeit fort und modernisierte die Darstellung von Astors unternehmerischen Aktivitäten. Auch in seiner Studie fehlen jedoch alle Aspekte, die über den reinen Gelderwerb Astors hinausgehen und seinen Weg als Einwanderer oder seinen gesellschaftlichen Aufstieg beschreiben.
In jüngster Zeit erschien in den USA noch das populärwissenschaftliche Buch des Bestsellerautors Axel Madsen. Diese Biographie aus dem Jahr 2001 beschäftigt sich zwar mit der Person Astors, bleibt dem historischen Astor aber so fern wie die meisten Veröffentlichungen. Madsen fügt den kolportierten Anekdoten einige historische Ereignisse hinzu, die jedoch für eine Lebensdarstellung Astors nicht relevant sind.
Im deutschsprachigen Raum ist Astor bislang meist übersehen worden. Es existiert lediglich eine Festschrift der Stadt Walldorf, die Herbert C. Ebeling im Jahr 1998 zum 150. Todestag Astors verfasste. Und 2007 erschien eine Gesamtdarstellung der Familie Astor, die aber zum großen Teil fiktional ist, deren Dialoge frei erfunden sind und die ihren Fokus auf die Frauen der Familie richtet.
Die folgende Biographie stützt sich nun erstmals auf eine Auswertung aller zugänglichen Archivmaterialien auf beiden Seiten des Atlantiks, die es ermöglichten, John Jacob Astor von seinen Wurzeln in Walldorf über alle Stationen seines erfolgreichen Lebens zu begleiten. Neben Hunderten von Briefen wurden Kirchenbücher, Tageszeitungen, Tagebücher, Memoiren, Schiffsbücher, Passagierlisten, Testamente, zeitgenössische Publikationen und Werbeanzeigen eingesehen und ausgewertet. Aus diesen primären Quellen kristallisierte sich nach und nach die historische Person John Jacob Astor heraus, die sich von den kolportierten Legenden doch deutlich abhob. Die ursprüngliche Studie wurde 2005 als Dissertation an der Universität Heidelberg eingereicht. Für das vorliegende Buch wurde die Geschichte John Jacob Astors nach den wissenschaftlichen Ergebnissen noch einmal neu erzählt.