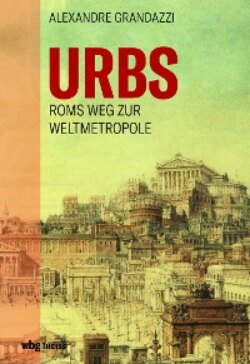Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 10
1 Der Saturnische Berg
ОглавлениеVon der Vor- zur Frühgeschichte
Was geschah vor vier bis fünf Jahrtausenden im Bereich der Hügel am Fluss?1 Menschen frequentierten diesen Ort schon geraume Zeit, zweifellos jedoch ohne sich länger dort aufzuhalten. Überreste von ihren mehr oder weniger provisorischen Lagerplätzen und von der Herstellung einfacher Werkzeuge sind insbesondere im Tal des Anio zu finden, der ein Stück oberhalb Roms in den Tiber mündet. Weiter südlich, in Ceprano, im Tal des Sacco, der später von sehr großer Bedeutung für die Anfänge der römischen Eroberungen sein sollte, wurde 1994 der älteste europäische Schädel eines Homo erectus gefunden, des gemeinsamen Vorfahren von Homo sapiens und Neandertaler, dessen Spuren wiederum an anderen Orten der Region vorkommen. Zu seiner Zeit waren, wie wir gesehen haben, die natürlichen Verwerfungen auf dem römischen Terrain noch nicht abgeschlossen, was auch noch nicht der Fall war, als vor ungefähr 40.000 Jahren erstmals der Homo sapiens sapiens, mit anderen Worten der heutige Mensch, auf der Bildfläche erschien und erst kürzlich entdeckte Zeugnisse einer Besiedelung und der Bearbeitung von Feuerstein auf der Flussseite des Palatins hinterließ. Wiederum sehr viel später, als sich in Westeuropa Viehzucht und Ackerbau ausbreiteten, diese beiden großen, aus dem Orient stammenden Neuerungen, hatte auch das römische Gelände sein heutiges Gesicht erlangt, und das Klima in der Region hatte sich bei lediglich etwas kühleren Temperaturen als heute stabilisiert. Auf dem südöstlich des Hügelareals gelegenen, durch die Lahare des Albaner Sees fruchtbar gemachten Plateau entstanden zahlreiche kleine Siedlungen. Rings um die wenigen Hütten dieser Gemeinschaften machten Menschen Felder urbar, die sie bestellten, bis der Boden ausgelaugt war, und legten Weiden an, auf denen Schafe grasten, deren Wolle die Frauen des Dorfes sammelten und webten. Nach einigen Jahren zogen sie weiter an einen anderen Ort, wo es neue Böden und Weiden zu bewirtschaften gab. Oft zwangen auch erneute Schlammströme sie dazu, sich anderswo niederzulassen.
Waren diese ersten Hirten und Bauern die direkten Vorfahren der künftigen Römer? Dazu müsste man wissen, wann in der Region erstmals Latein gesprochen wurde – oder zumindest jene Sprache, aus der das uns bekannte Latein unmittelbar hervorgegangen ist. Man kann nur mit Gewissheit sagen, dass das Lateinische als Teil der indoeuropäischen Sprachfamilie seinen Ursprung nicht im Zentrum des mediterranen Beckens hat, sondern weit entfernt, wo Asien und der indische Subkontinent zusammentreffen, genau wie Griechisch, Hethitisch, Vedisch, Armenisch und viele weitere Sprachen, von denen die meisten inzwischen ausgestorben sind. Die Latiner – jene also, die sich in einer Sprache ausdrückten, die eines Tages auch in Rom gesprochen werden sollte – stammten folglich nicht aus Latium, sondern waren erst nachträglich in diese Region eingewandert, der sie möglicherweise ihren Namen verdankten. Wann kamen sie und wie zahlreich? Wo lagen ihre Wurzeln? Und ergoss sich eine einzige große Invasion wie eine verheerende Flutwelle aus dem Orient gen Westen? Gegenwärtig geben weder Archäologie noch Linguistik klare Antworten auf diese Fragen.
Tatsächlich muss sich der Marsch der indoeuropäischen Völker westwärts über mehrere Jahrtausende hingezogen haben.2 Zwischenetappen, in denen sich einzelne Stämme endgültig an einem bestimmten Ort niederließen, von wo aus irgendwann wieder neue Gruppen aufbrachen, um in andere Richtungen auszuschwärmen, dauerten manchmal mehrere Jahrhunderte. So wurden zunächst die anatolischen Hochebenen und der Balkan, später dann die Ebenen am Unterlauf der Donau zu Sammel- und schließlich zu erneuten Ausgangspunkten für indoeuropäische Gemeinschaften, deren Sprache sich im Laufe der Zeit immer stärker differenzierte. Möglicherweise von den Donauebenen stammend, ließen die Vorfahren der künftigen Latiner einen Teil der Ihren im aktuellen Venetien zurück, wo bis ins dritte, vierte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine mit dem Latein sehr eng verwandte Sprache, das Venetische, gesprochen wurde, bevor sie das Tibertal hinabzogen und schließlich die Küstenebenen erreichten. Zweifelsohne siedelten sie sich dort in einem Gebiet an, das deutlich größer war als das antike Latium, denn es gibt Beweise dafür, dass auch jenseits des Flusses, in Orten wie Caere und vor allem Falerii, etwa fünfzig Kilometer nördlich von Rom, in den guten alten Zeiten etruskischer Herrschaft über das rechte Tiberufer dem Lateinischen sehr ähnliche Dialekte gesprochen wurden. Dies waren wahrscheinlich Relikte einer voretruskischen Epoche, in der zu beiden Seiten des Tibertals lateinische Sprachen verbreitet waren: eine Situation, die zwangsläufig vor die Existenz der mächtigen etruskischen Städte Caere und Veji zurückreichen muss, deren Ursprünge im elften Jahrhundert vor Christus liegen. In Anbetracht der ausgeprägten Besonderheiten der in Falerii gesprochenen Sprachvariante ist davon auszugehen, dass sie recht lange isoliert existierte und sich eigenständig entwickeln konnte, was darauf schließen lässt, dass die Ankunft der Latiner in der Tiberebene wahrscheinlich etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung erfolgte. Und in diese Zeit datieren somit auch die Anfänge einer im eigentlichen Sinne römischen Geschichte auf den Hügeln am Fluss.
Blicken wir nun in das 15. Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung: Die hohen Tuffsteinwände leuchteten rot im Sonnenlicht, auf den waldreichen Hügelkuppen wehte der Wind durch das Laub, weiter unten eilten Bäche und Flüsse dem großen Strom entgegen, dessen über die Ufer getretenes Wasser sich in stillen Tümpeln am Fuß der Anhöhen gesammelt hatte. Hoch oben am Himmel zogen Raubvögel ruhig ihre Kreise, während aus den Tälern das Zwitschern zahlloser Vögel drang. Von einer der Kuppen des steilsten Hügels stieg Rauch auf: Schon seit der Bronzezeit kamen die Menschen während der warmen Jahreszeit her, um hier einige Zeit zu verbringen. Inzwischen waren auch die Schlammströme des Albaner Sees so gut wie versiegt, und dieser Ort, der noch nicht Rom war, begann sein Potenzial voll zu entfalten. Vom südlichen Gipfel der Anhöhe blickte man weit in die Ferne und war vor bösen Überraschungen sicher. Die fetten Weiden der Umgebung waren leicht zu überwachen, und, was das Wichtigste war, man befand sich genau oberhalb jener Furt, an der die Menschen den Fluss passieren und ihre Herden sicher ans andere Ufer bringen konnten. Denn im Winter war es hoch oben in den Bergen des Nordens und Ostens zu kalt, nur in den küstennahen Ebenen konnte das Vieh überleben, bis der Frost vorüber war. Im Sommer hingegen wurde die Hitze auf den von der unerbittlichen Sonne versengten Feldern schnell unerträglich, und es war besser, in das höher gelegene Hinterland zurückzukehren, wo es kühler und die Lebensgrundlage gesichert war. Diese Wanderungen des Viehs und seiner Hirten, die sogenannte Transhumanz, verliehen dem Ort während einiger Jahrhunderte einen Rhythmus. Generation auf Generation überquerten die Herden den Fluss an der Furt, wo die Insel die Strömung bremste: stets ein heikler Moment, da Tiere ertrinken konnten, just bevor sie mit ihren Hirten den Schutz oder auch die Bedrohung erreichten, die von den verschanzten Behausungen auf den umliegenden Hügeln ausging. Etwa 14 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung wurden die Höhen des Kapitols erstmals von Menschenhand verändert:3 Der südliche Hang wurde steiler gestaltet, und das dabei zuhauf anfallende Erdreich an der Kuppe aufgeschüttet, was zu einer Vergrößerung der bewohnbaren Fläche führte. Bessere Verteidigungsmöglichkeiten und etwas mehr Platz zum Leben, das waren also die Ziele dieser ersten menschlichen Eingriffe auf dem Hügelareal: der erste Schritt einer überwältigenden Metamorphose, die gerade erst begann. Wozu diese Schutzmaßnahmen? Um sich besser gegen drohende Angriffe von außen zu wappnen? Vielleicht. Um über einen Rückzugsort zu verfügen und die Vorbeiziehenden unten im Tal angreifen zu können? Ganz sicher, und am entsprechenden Vorsatz besteht hier nicht der geringste Zweifel! Denn der auf diese Weise geschaffene Schlupfwinkel lag unmittelbar über der Furt, die Menschen und ihren Herden das Überwinden jenes Hindernisses ermöglichte, das der mächtige Strom auf seinem Weg zum Meer überall sonst darstellte. Und im Schutz der befestigten Siedlung entstanden am Fuß des Hügels, nicht weit vom Ufer entfernt, einige weitere Behausungen.
Das Plateau des Palatins muss zumindest auf der Flussseite in ähnlicher Weise besiedelt gewesen sein. Wahrscheinlich handelte es sich auch dort lediglich um eine vorübergehende Niederlassung, da die aus ihren Bergen herabgekommenen Hirtengruppen einen sicheren Ort brauchten, wenn sie ihre Herden in der näheren Umgebung weiden ließen. Der Fluss und die stehenden Gewässer am Fuß der Hügel sowie die wildreichen Wälder lieferten ihnen Nahrung im Überfluss. Jahr für Jahr, und das über mehrere Jahrhunderte hinweg, kamen sie so mit ihren Tieren zu den Hügeln und zogen weiter in die Küstenebenen. Denn dort unten, im Mündungsbereich des großen Flusses, holten sie eine Substanz, ohne die weder sie noch ihre Herden überleben konnten: Salz. Das Meerwasser sammelte sich in den Mulden hinter den Sandbänken und hinterließ, nachdem es im glühenden Sonnenschein der heißen Tage verdunstet war, einen Rückstand, den man nur noch einzusammeln und zu filtern brauchte, um dieses unverzichtbare und unersetzliche Würzmittel zu gewinnen.4 Während ein Mensch mindestens zwei bis drei Kilo der kostbaren Substanz pro Jahr benötigt – ein Mindestmaß, das man in der Antike, nebenbei bemerkt, verdoppeln zu müssen glaubte –, liegt der Bedarf von Zuchtvieh wie Büffeln, die in Latium seit der frühesten Vorgeschichte präsent waren, bei über dreißig Kilo pro Jahr. Nimmt man also die Rinder, aber auch Schafe und Schweine, die in jeder Familie gehalten wurden, hinzu, lag der absolute Mindestbedarf in jenen fernen Zeiten bei etwa zwanzig Kilogramm pro Jahr und Person. Doch Salz war nicht nur selbst ein unentbehrliches Lebensmittel, sondern diente darüber hinaus zur Konservierung von Fleisch, Fisch, Gemüse, Butter und Käse … Kurzum, „eine Bevölkerung, deren Ernährung auf Viehzucht oder Fischfang beruhte, war ohne Salz zu Hunger verdammt.“5 Und seine Seltenheit machte es nur umso kostbarer: Die sich über mehrere hundert Hektar erstreckenden Salzgärten an der Tibermündung waren die größten auf der gesamten Halbinsel, abgesehen von einer Saline einige hundert Kilometer weiter südlich an der Adriaküste. Folglich waren die Bewohner der Region für ihre Versorgung ausnahmslos und noch für lange Zeit auf jene Lagunen angewiesen, in denen sich rund zwanzig Kilometer flussabwärts der Hügel das Meerwasser sammelte. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Kontrolle über Produktion und Vergabe dieses weißen Goldes Wohlstand und Macht verlieh. Hirten tauschten Tiere gegen das begehrte Salz ein, Fischer einen Teil ihres Fangs, und jene Punkte, an denen diese Tauschgeschäfte stattfanden, waren dazu prädestiniert, Menschen und Waren anzuziehen.
Wo könnte ein solcher Ort liegen? Direkt an der Küste? Nein, denn wegen der Sümpfe könnten Herden dort nicht länger verweilen, und Hirten würden vom Fieber dahingerafft. Für diejenigen, die es zu den Salinen am linken Flussufer zog, muss daher eine gut zehn Kilometer von der Küste entfernte Siedlung auf einer leicht zu verteidigenden Anhöhe schon recht früh zu einem Halt und Handelsplatz geworden sein: Hoch über dem Tibertal gelegen, könnte der kleine Flecken Ficana als ernsthafte Rivalin der künftigen römischen Siedlung erscheinen. Aber die bedeutendsten Salinen befanden sich auf der gegenüberliegenden Flussseite, am rechten Ufer. Wer also aus den weiter im Osten und Nordosten des Flusstales gelegenen Regionen dorthin wollte, musste zwangsläufig den Fluss überqueren. Und weil das Gebiet der künftigen Urbs noch nahe bei der Küste und ihren Salzgärten lag, gleichzeitig aber auch nicht weit von den Albaner Bergen, dem damals florierenden Zentrum der Region, weil ein solches Relief aus Hügeln und Tälern nirgendwo sonst entlang des Flusses zu finden war und weil es an der Kreuzung wichtiger Verbindungswege lag, entwickelte sich das Areal an der Insel mit der Furt nach und nach zum wichtigsten Ort einer Begegnung zwischen Bewohnern der Ebene und Bewohnern des Gebirges, zwischen denjenigen, welche die Produktion des Salzes kontrollierten, und den anderen, die unablässig Nachschub brauchten.
Einige Namen, die über diesen sehr langen Zeitraum hinweg im kollektiven Gedächtnis bewahrt blieben, liefern uns Hinweise auf die zunehmende Konzentration von Menschen, Handel und Reichtümern: Die Bezeichnung ‚Salzstraße‘ (Via Salaria) für die Verbindungsachse in die Berge im nordöstlichen Hinterland des Flusses ist ein gleichsam konserviertes Relikt jener Zeiten, in denen Rom zwar noch nicht existierte, aber auf ihrem zukünftigen Terrain bereits ein Entwicklungsprozess eingesetzt hatte, der mehrere Jahrhunderte später zu ihrem Eintritt in die Geschichte führen sollte. Diese Salzstraße trug weder den Namen eines Beamten, der sie erbauen ließ, wie es ab dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung üblich wurde, noch den Namen ihres Zielorts – in diesem Fall Rieti im Sabinerland. Stattdessen war sie als Einzige ihrer Art nach dem wichtigsten Handelsgut benannt, zu dem sie Zugang bot und das über sie ins Landesinnere transportiert werden konnte. Und weil sie weder nach einem Beamten noch nach einem Zielort benannt wurde, wird sie bereits zu einer Zeit existiert haben, in der es weder das eine noch das andere gab, mithin vor der Republik (die in Rom Ende des sechsten Jahrhunderts v. Chr. begann) und auch noch vor den ersten Städten, die im Zentrum der Halbinsel im neunten und achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden. Auf Höhe der Furt allerdings, wo die antike Straße auf das rechte Flussufer wechselte, änderte sich plötzlich ihr Name: Jenseits der Insel hieß sie nicht mehr Salaria, sondern Campana, was sich leicht erklären lässt, wenn man bedenkt, dass sie zu Salzgärten führte, die im Lateinischen Campus Salinarum (Ebene der Salinen) genannt wurden.
Auf römischem Boden selbst liefern zwei Ortsnamen, die dank der künftigen Geschichte der Stadt im Gedächtnis der Menschen verankert blieben, die endgültige Bestätigung für das, was die Analyse der Örtlichkeiten bereits vermuten ließ. Die Ebene zwischen Kapitol und Palatin, die unmittelbar an der durch den Flussbogen und die Insel begünstigten Furt lag, hieß ‚Viehmarkt‘ (Forum Boarium). Und nicht weit von dort entfernt, am Fuß des Aventins, findet sich eine Ortsbezeichnung, die oft für Verwunderung bei Kommentatoren gesorgt hat: salinae, ein Wort, das hier, fern vom Meer, natürlich nicht auf Salzgärten verweisen konnte, wohl aber auf eine Stelle, an der Salz gelagert wurde. So veranschaulichen diese beiden Namen nicht nur die enge Verbindung zwischen Salzhandel und Viehzucht, sondern illustrieren darüber hinaus noch einen weiteren wesentlichen Punkt: Dass der Austausch des Würzmittels gegen Tiere weder dort erfolgte, wo das eine gewonnen, noch dort, wo die anderen gezüchtet wurden. Weder an der Küste noch in den Bergen, sondern dazwischen, an dem Ort, wo die aus dem gebirgigen Hinterland herabführenden Wege zusammenliefen und der Übergang über den Fluss am bequemsten war. Und so endeten auch exakt an der als Viehmarkt bezeichneten Stelle jene Wege, die sich zu den wichtigsten Verkehrsachsen der gesamten Region entwickeln sollten: Von den Höhen des Quirinals herab kam zum einen die Salzstraße, während sich im Tal, das Palatin und Aventin voneinander trennte, zwei Wege vereinten, die aus den Albaner Bergen herführten und die eines Tages zur Via Appia beziehungsweise Via Latina werden sollten. Und schließlich mündete auf diese zentrale Fläche auch die Route, über die all jene die Furt überquerten, die von den Hochebenen Etruriens auf der gegenüberliegenden Flussseite herabkamen. Das in den Küstenlagunen gewonnene Salz wurde somit zur ersten Stelle gebracht, wo eine Überquerung des Flusses möglich war, dort gelagert und gegen Vieh getauscht, und zwar durch kleine Gruppen unterschiedlicher Herkunft, die zumindest zeitweise auf den beiden Hügeln in unmittelbarer Nähe des Flusses siedelten. Der Ort, der eines Tages zu Rom werden sollte, diente also zunächst als Verkehrs- und Handelsknotenpunkt.
Eine Legende bewahrt die Erinnerung an jene fernen Zeiten, in denen sich das Leben um die Furt konzentrierte: die Geschichte vom wilden Cacus.6 Sie erzählt von einem räuberischen Hirten auf den Hügeln, der einige Tiere aus einer Herde zu stehlen versucht, die Hercules gerade über den Fluss gebracht hat, indem er sie rückwärts in eine Höhle führt, um sie dort zu verstecken. Schließlich wird er von dem griechischen Helden entdeckt und getötet. Seltsamerweise blieb der Name des Cacus, einer zu Diebstahl und List greifenden Figur, in mehreren Ortsbezeichnungen erhalten, insbesondere auf dem Palatin, wo der Aufstieg zur Hügelkuppe von der Flussseite her bis in die Kaiserzeit den Namen ‚Cacus-Treppe‘ tragen sollte. Was bedeutet, dass Cacus, dessen Mythos Züge indoeuropäischen Ursprungs aufweist, zunächst eine positive, göttliche Gestalt, im vorliegenden Fall Faunus, gewesen sein muss und erst später, als man seine Geschichte mit der des guten, tapferen Hercules verknüpfte, zu einem bösen Dieb wurde.
Noch siedelten nur wenige Hirten, deren mythischer Archetypus Cacus bleiben sollte, auf den Hügeln und an der Furt, und sobald es wieder wärmer wurde, kehrten sie mit ihren Herden zurück zu den höher gelegenen Weiden des Hinterlands, wo sie geboren waren und wo sie sterben würden. Die kleinen befestigten Weiler auf der Kuppe und am Fuß des Kapitolshügels sowie auf der Flussseite des Palatins dienten noch einige Jahrhunderte lediglich als vorübergehender Aufenthaltsort und Wachtposten für kleine, äußerst mobile Gemeinschaften. Allmählich jedoch stieg, dank der Ressourcen, die das regelmäßige Durchziehen der Herden denjenigen bescherte, welche die Furt kontrollierten, die Zahl der dauerhaften Bewohner ein wenig an, und die Frequentierung des Ortes nahm zu, wie eine kürzlich auf dem Caesarforum identifizierte, von Karrenrädern in den Boden gegrabene Furche beweist. Im fernen Orient war unterdessen die prunkvolle mykenische Palastkultur untergegangen, was zur Emigration Tausender Menschen in Richtung Westen geführt hatte, darunter zahlreiche geschickte Metallwerker und Töpfer. Den Tonwaren nach zu urteilen, die an der Küste Latiums gefertigt wurden, könnte es durchaus sein, dass sich einige dieser Migranten (oder durch sie beeinflusste Handwerker) dort niedergelassen haben, genauer gesagt an der Mündung eines kleinen Flusses namens Astura, einige Tagesmärsche von der Furt bei den Hügeln entfernt. Auf dem Palatin soll ein aus dem zwölften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammendes Tongefäß, in welches der Töpfer sein Zeichen eingeritzt hat, ein Zeugnis ihrer Durchreise sein, die mythisch in der angeblichen Begegnung des Arkadiers Euandros mit dem Trojaner Aeneas auf eben diesem Hügel verherrlicht wurde.7
Die Zeit der Dörfer
Damit endet die Prähistorie auf römischem Boden, und es beginnt die sogenannte Frühgeschichte: Eine Zeit, die noch vollständig in mythischen Nebel gehüllt ist, in der jedoch hin und wieder der Name eines Ortes oder eines Gottes und die Erinnerung an einen über Generationen hinweg unverändert bewahrten Brauch eine Verbindung herzustellen erlaubt zu dem, was Römer späterer Epochen über die fernste Vergangenheit ihrer Stadt berichten werden. Auf deren Gebiet war der Mensch lange nur vorübergehender Gast geblieben. Hatte er sich dort niedergelassen, so vorerst nur für eine Jahreszeit, bevor er den Fluss wieder überquert hatte oder in die Berge des Landesinneren zurückgekehrt war. Doch nun, im zwölften oder elften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, gesellten sich weitere Siedlungen zum befestigten Weiler auf dem Kapitol, zum Stützpunkt im südwestlichen Bereich des Palatins und zum Handelsplatz auf dem Forum Boarium. Ab jetzt ließen sich kleine Gemeinschaften von Männern und Frauen dauerhaft auf den Hügeln am Fluss nieder: Sie beschlossen, dort zu leben und – eine neue Entwicklung, deren erste Zeugnisse wir der Archäologie verdanken – auch dort zu sterben und begraben zu werden.8 Hier und da tauchen, wenn auch noch wenig zahlreich, aber bereits zu kleinen Nekropolen zusammengefasst, die allerersten römischen Gräber auf und künden von der Anwesenheit nahegelegener, inzwischen verschwundener Siedlungen. Natürlich waren diese Toten wohl kaum die ersten Verstorbenen an dieser Stelle, aber sie waren die Ersten, für die Bestattungsriten vollzogen wurden, die greifbare Spuren im Boden des Hügelareals hinterlassen haben, die Ersten, deren Andenken an Ort und Stelle durch Nachkommen in Ehren gehalten wurde, die ihrerseits wiederum mit vergleichbaren Riten geehrt werden wollten, die Ersten also in einer langen Reihe von Generationen, deren jeweiligen Beitrag zum Totenkult die Archäologie trotz der Kriege und diversen Umwälzungen der römischen Geschichte nach und nach in ihrer ganzen Vielfalt rekonstruiert. Indem diese Männer und Frauen die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen in die Erde der Hügel betteten, demonstrierten sie, wie gering ihre Zahl auch sein mochte, mehr als ein Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung ihre Sesshaftwerdung an einem Ort, der für sie mehr und mehr zum ‚Vaterland‘ werden sollte, zum ‚Land ihrer Väter‘ (patres). Sie beendeten die stete Wanderschaft früherer Generationen und ließen sich in diesem Gebiet nieder, mit dem sie selbst und ihre Nachkommen künftig durch das heilige Band jener Rituale verbunden waren, die sie den Toten schuldeten. Doch wo genau hatten die Toten dieser ersten römischen Gräber gelebt (vgl. Karte 2)?9
Der Kapitolshügel blieb zunächst das wichtigste Zentrum der Besiedelung, was ein großes Wort ist angesichts der Tatsache, dass diese Dörfer in der ausgehenden Bronzezeit kaum mehr als ein paar Dutzend Bewohner gezählt haben dürften. Die Hütten standen auf beiden Kuppen, aber auch an den Hängen, wo diese gestuft zur Ebene hin abfielen. Auch an der Nordwestflanke des Palatins, wo eine reich fließende Quelle entsprang, lag ein Weiler, während auf der entgegengesetzten Hügelseite, hoch über dem Fluss und dem Sumpf, die alte Siedlung weiterbestand und sich ausdehnte. Wir haben es also mit kleinen Gruppen zu tun, die auf den beiden wichtigsten Anhöhen oder an deren Hängen das Quellwasser verwendeten und die ihre Toten in der Nähe bestatteten, am Rand und entlang der Pfade der morastigen Senke, welche die Hügel voneinander trennte. In dieser Anfangsphase sind es noch nur wenige Gräber: etwa zehn auf dem Kapitol, vier weitere auf einer kleinen, zuvor besiedelten Geländeerhebung in der Mitte des künftigen Forums, wo Augustus mehr als tausend Jahre danach einen Bogen errichten sollte, und schließlich, aus einer etwas späteren Zeit stammend, zehn weitere, die kürzlich bei Ausgrabungen auf dem Caesarforum entdeckt wurden. Bei den meisten davon handelt es sich um sorgfältig angelegte kleine Gruben, in die vor nunmehr drei Jahrtausenden ein grob gefertigtes Tongefäß hinabgelassen wurde mit einer Urne darin.10 Diese bestand ebenfalls aus gebranntem Ton, und besaß einen Deckel, der dem Dach der Hütte nachgebildet war, in welcher der Verstorbene gelebt hatte. Diese allerersten römischen Gräber existieren nur in sehr begrenzter Zahl, da der Bestattungsritus, von dem sie heute noch Zeugnis ablegen, zu jener Zeit allein einer Elite vorbehalten war und vom Rest der Bevölkerung keinerlei Spuren erhalten sind. Dieses Ritual weist frappierende Besonderheiten auf, die im Verlauf des elften Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zum ersten Mal auftauchten: Jeder Urne wurden Gefäße, Schmuck und Waffen beigelegt, die eigens in Miniaturformat gefertigt worden waren. In einigen Fällen gab es auch eine kleine Tonstatuette, ein Abbild des Verstorbenen, dessen Einäscherung mit dieser Darstellung gewissermaßen symbolisch kompensiert wurde. Wie selten diese ersten Gräber auch sein mögen, zeugen sie doch von einem in ganz Latium einheitlichen Bestattungsritus und zwar in einem solchen Maße, dass die Archäologie nunmehr von einer ‚latialen Kultur‘ spricht, deren erste Stufe hier erreicht ist.
Dass die Hügel an der Furt in dieser Phase noch längst nicht das Zentrum der Region bildeten, ergibt sich allein aus der Verteilung der Grabstätten, da die dazugehörigen Siedlungen bis auf Ausnahmen noch nicht lokalisiert werden konnten. Denn nicht nur an der Küste ist die Zahl der seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckten Gräber sehr viel höher, sondern vor allem im gesamten Bereich der Albaner Berge sowie auf dem großen, einst durch Schlammströme fruchtbar gemachten Plateau: Gerade in diesem Gebiet zwischen Bergen und Fluss wurden im Zuge städtischer Bauarbeiten in jüngerer Zeit zahlreiche kleine Gräbergruppen entdeckt. Und diese Gräber ähneln sich alle: Mochten die wenigen kleinen Gemeinschaften noch so weit verstreut leben, verfügten sie also offensichtlich über eine gemeinsame Religion, durch die sie ihrer Verbundenheit mit der Heimat und den Ahnen Ausdruck verleihen wollten. Um Anführer geschart, die als Einzige in einem Grab beigesetzt wurden und auch für die religiösen Riten zuständig gewesen zu sein scheinen, widersetzten sie sich entschlossen dem enormen Druck der Villanovakultur auf der anderen Seite des großen Stromes, aus der schon bald die Etrusker hervorgehen sollten. Die Treue zu ihren Toten, ihrem Boden und ihren spezifischen Riten, die sich in der Grabkultur manifestiert, war für sie ein Mittel, eine gemeinsame Identität zu artikulieren, die sich nicht auf einen einzigen Ort beschränkte, sondern sich über das gesamte Gebiet erstreckte, in dem Latein gesprochen wurde. Im Kontakt mit den Vertretern der Villanovakultur, für die Latium lediglich ein Durchzugsraum zwischen Territorien im Norden und im Süden – dem künftigen Etrurien und Kampanien – darstellte, zogen sich diese Bevölkerungen zwischen Fluss, Meer und Berge zurück, wurden endgültig in Siedlungen sesshaft, die häufig Keimzellen von Städten der historischen Zeit bildeten, und machten von da an mittels gemeinsamer Riten ihre Zugehörigkeit zu ein und derselben religiösen, kulturellen und ethnischen Gemeinschaft geltend:11 dem Latinerbund, in dem alle Stämme vereint waren, die den lateinischen Namen (nomen Latinum) teilten. Ihre beiden wichtigsten Versammlungsstätten waren das etwa zwanzig Kilometer südöstlich in den Albaner Bergen gelegene Diana-Heiligtum, mit dem heiligen Baum am Ufer des Nemisees, und jener Berg, der heute als Monte Cavo bekannt ist, benannt nach dem antiken Ort Cabum, über den der Zugang zum Gipfel erfolgte. Mit seinen 950 Metern Höhe bietet der Monte Cavo einen weiten, eindrucksvollen Ausblick über die gesamte Ebene Latiums. Auf dem Gipfel dieses von ihnen Alba genannten Berges – eine Bezeichnung, deren Wurzel man auch im Namen unserer heutigen Alpen wiederfindet –, versammelten sich regelmäßig die dreißig Volksstämme, die aus diesem Grund Albenses genannt wurden, um dort im Rahmen eines gemeinsamen Rituals, das ihren Bund und ihre kollektive Identität symbolisierte, das Fleisch eines weißen Stieres zu teilen, den sie einem später als Iuppiter Latiaris bekannten Gott geopfert hatten. Die römische Überlieferung bewahrte die Erinnerung an diese Kultstätte und jene Zeiten, in denen das Massiv der Albaner Berge mit seinen zahlreichen, über die ansteigenden Ufer seiner Seen verstreuten Siedlungen das wahre Zentrum Latiums bildete, indem sie eine veritable Stadt namens Alba Longa ersann, welche die gesamte Region unterworfen habe. Der Realität entspricht jedoch eher ein Bündnis, das jeder der kleinen Gemeinschaften, aus denen es sich zusammensetzte, große Freiheit ließ. Einige dieser Stämme hatten begonnen, sich entlang des großen Flusses anzusiedeln, der damals noch nicht Tiber hieß, sondern Albula, was gleichermaßen die Albaner Berge anklingen ließ wie seine geografische Bedeutung für den Albaner Bund. So finden wir an seinem Ufer die Fidenates, denen die künftige Stadt Fidenae ihren Namen verdankt, und auch die Tutienses und die Latinienses sind nicht fern – Letztere haben sich im Bereich des heutigen Parioli-Viertels niedergelassen. Zweifellos aus dem Sabinerland näherten sich die Sacrani und die Vimitellari den Anhöhen von Quirinal und Viminal, während die Querquetulani einen Hügel besiedelten, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht Caelius hieß. Die Velia hingegen trug auch damals schon ihren heutigen Namen, wie die Erwähnung eines Volksstamms von Velienses in einer Liste zeigt, die uns durch den Enzyklopädisten Plinius den Älteren bekannt ist.12 Warum aber fehlen Kapitol und Palatin in dieser Aufzählung, obwohl die beiden Hügel doch, wie wir gesehen haben, als Erste des gesamten römischen Areals besiedelt wurden? Der Grund dafür ist, dass von den Albaner Bergen kommend der Zugang zum Palatin zunächst über die mit ihm verbundene Velia führte. Und die beiden Kuppen des Kapitols boten womöglich zu wenig Siedlungsfläche, als dass sich ein ganzer Stamm dort hätte niederlassen können. Oder lag es daran, dass die Menschen, die dort in jener Zeit lebten, nicht derselben ethnischen Gruppe angehörten wie diejenigen, die sich in regelmäßigen Abständen am Nemisee und in den Albaner Bergen zusammenfanden? Nennt sie nicht auch die mythologische und religiöse Überlieferung Roms Sabiner?
Die über die gesamte Fläche der künftigen Stadt Rom und deren Grenzen hinaus verstreuten Albaner-Gemeinschaften waren also durch ihre Religion und den Kult miteinander verbunden. Auch wenn die Schrift zu jenem Zeitpunkt noch mindestens drei Jahrhunderte in der Zukunft lag, bilden die archäologischen Spuren, die diese ersten sesshaften Bewohner im römischen Untergrund hinterlassen haben, die Zeichen einer stummen, aber entschlüsselbaren Sprache. Ihre Graburnen gestalteten sie inzwischen als getreue Abbilder der Hütten, die sie bewohnten. So ist die Hüttenurne in eben dem Maße realistisch, wie sie symbolisch ist, symbolisch in eben dem Maße, wie sie realistisch ist: Im Tod imitiert sie das Leben und scheint denjenigen oder diejenige, deren Asche sie enthält, in Ewigkeit fortbestehen zu lassen. Objekt und Zeichen zugleich, zeugt sie vom Glauben an eine Art Leben nach dem Tod, da dem Verstorbenen Miniaturnachbildungen all dessen mitgegeben wurden, was ein Mensch zum Leben und zu seiner Verteidigung braucht. Zugleich scheint der Kremationsritus, bei dem der Rauch des Scheiterhaufens zum Himmel aufsteigt, zum Wohnsitz der Götter, eine Form von Heroisierung zu implizieren: Bildeten die Männer, aber auch Frauen, denen dieser Ritus vorbehalten war, nicht die Elite ihrer Gemeinschaften, die mehrere Tage arbeiten mussten, um die miniaturisierten Gegenstände herzustellen, die in all diesen Gräbern vorhanden waren? Zwar lässt sich die Verwendung von Hüttenurnen auch für das zeitgenössische Etrurien nachweisen, Miniaturwaffen wurden jedoch nur in den Männergräbern Latiums gefunden: Nachbildungen von Lanzen, Schwertern, eigentümlichen Doppelschilden und Opfermessern veranschaulichen in jedem Grab die sowohl politischen wie religiösen Funktionen dieser Anführer, die oft kaum älter als zwanzig Jahre waren und bei der Identitätsbildung eine hervorgehobene Rolle gespielt haben müssen. Die religiöse Überlieferung Roms sollte sich ihrer unter dem Namen patres patrati erinnern. In jenen fernen Zeiten, in denen, einem Bund gemäß, der so lange Bestand haben sollte wie Rom selbst, alles unter dem Blick der Götter geschah, war die Religion Ausdruck der eminent ‚politischen‘ Entscheidungen, die diese kleinen Gemeinschaften am Ende der Bronzezeit trafen: sesshaft zu werden und an einem festen Ort Wurzeln zu schlagen, die engen Grenzen von Familie und Sippenverband zu überwinden und sich als Mitglieder ein und derselben Gemeinschaft zu betrachten, die in ganz Latium dieselbe Sprache sprach und denselben Kult praktizierte.
In jenen Zeiten trugen die Orte noch die Namen von Göttern: Man sprach noch nicht vom Kapitol, sondern bezeichnete die zum Fluss hin gelegene Anhöhe als den ‚Saturnischen Berg‘. Die zweite, auf der anderen Seite gegen den Quirinal über der sumpfigen Niederung aufragende Hügelkuppe war die ‚Burg des Janus‘,13 der Gott des Übergangs wachte am Saum der noch fremden Territorien, von denen jederzeit Gefahr drohen konnte. Weiter südlich erhielt das weitläufige Plateau des Palatins, dessen fruchtbare Weiden ausreichend Platz für das Vieh boten, seinen Namen von den Pales, den Schutzgottheiten der Herden. Die wachsende Bedeutung dieser beiden Hügel an der Furt lockte nun immer mehr Zuwanderer an: Ganze Familien, oft aus dem Süden der Halbinsel stammend, ließen sich in dem Gebiet nieder und brachten ihre handwerklichen Fähigkeiten mit. Da der Kapitolshügel dem Fluss am nächsten lag, war er als Erster besiedelt worden, doch seine begrenzte Oberfläche verhinderte eine weitere Ausdehnung, weshalb sich der Palatin mit seinen 22 Hektar zusammenhängender Fläche ab dem Ende des zehnten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, einer Phase, die Fachleute als ‚Latial IIA‘ bezeichnen, zum wahren Herzen des Areals entwickelte. Das Kapitol wurde nicht aufgegeben, verlor jedoch allmählich seine ursprünglich zentrale Stellung und rückte ein wenig an die Peripherie: Dort fanden sich Gräber sowie einige Öfen zur Metallverarbeitung, deren Rauch in dieser Höhe weniger störend war, während gegenüber auf dem Palatin auf dem gesamten Hügel neue Hütten entstanden. Zwar hat die Geschichte die Wohnstätten der Lebenden dahingerafft, die der Toten jedoch finden die Archäologen gelegentlich wieder, und sei es auch nur zum Teil. So wurde im Bereich der ‚Cacus-Treppe‘, wo der Boden so löchrig ist wie ein Schweizer Käse, eine Nekropole entdeckt,14 die bis zum ‚Grab beim Haus der Livia‘ gereicht haben muss, unter die Ruinen des Hauses also, das eines Tages die Gemahlin des Augustus bewohnen sollte. Welch wundersame Ironie der Geschichte und welch spektakulärer Ausdruck jener Kontinuität, die eines der Hauptmerkmale Roms sein würde: Die Herrscher des Kaiserreichs sollten also eines Tages an exakt der Stelle leben, wo tausend Jahre zuvor ein Fürst der beginnenden Eisenzeit begraben worden war!15 Andere Nekropolen am Rand des Palatins zeugen von seiner weiteren Entwicklung. So wurden etwa zwanzig Gräber beim Tempel des Antoninus Pius und der Faustina entdeckt, die zu einem Gräberfeld gehören, das sich damals über die gesamte Länge dieser Seite des künftigen Forums erstreckt haben muss.16 Jenseits der zentralen Niederung lockten die Kuppen des Quirinals die ersten kleinen Gruppen an, die aus dem gebirgigen Hinterland über die Via Salaria herabkamen.17 Durch die Ansiedlung auf jenen Hügeln, den letzten Ausläufern des großen südlichen Plateaus, profitierten die Zuwanderer zum einen vom Warenaustausch im unterhalb ihrer Dörfer gelegenen Flusstal und konnten gleichzeitig weiterhin die reichen Jagd- und Fischgründe der Umgebung nutzen. In dieser ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung (Latial IIA und B), erhielten die einzelnen Hügel jene Namen, die sie auch künftig tragen sollten: Latialis (am Standort der Villa Aldobrandini), Sanqualis und Salutaris (beide nach Göttern benannt), während das schmale Tal, das Quirinal und Viminal voneinander trennte und zur weitläufigen zentralen Senke hin abfiel, zu einem immer stärker frequentierten Weg wurde: Heute die Via Nazionale, hieß er vielleicht auch damals schon Vicus Longus.
Die Lebenden siedelten auf den Schutz bietenden Kuppen, die Toten ruhten unten im Tal, entlang der Wege ins Umland. Deshalb sind die wenigen in jüngerer Zeit unter dem Pflaster des Caesarforums entdeckten Gräber ebenso wie diejenigen, die bereits früher auf dem tausend Jahre jüngeren Augustusforum identifiziert worden sind, mit den unteren Hängen des Kapitols oder dem Collis Latialis in Verbindung zu bringen. Auf Letzterem entstand ein Dorf, das von den übrigen Kuppen des Quirinals leicht zugänglich war und knapp 300 Einwohner zählte, die den Vorzug einer nahe gelegenen Wasserstelle genossen, der Aquae Fontinales. Etwa einen Kilometer weiter im Hügelinneren entwickelte sich eine andere Quelle ab jener Zeit zu einem Rast- und Opferplatz für die Reisenden auf der Höhenstraße, der Via Salaria, die sich wie ein Rückgrat den Hügel entlangzog. Sehr viel später sollte eine andere Religion an ebendiesem Ort eine kleine Kirche namens Santa Maria della Vittoria errichten. Aber neun Jahrhunderte v. Chr. lag hier lediglich ein ‚Grenzheiligtum‘ – so der heute gebräuchliche Begriff –, das die nördliche Grenze des kleinen, zu diesem Dorf gehörigen Territoriums markierte. Bis ins zweite Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ließen die Vorbeiziehenden häufig bescheidene Gegenstände als Opfergabe zurück, die bei archäologischen Ausgrabungen wiedergefunden wurden. Zudem hat man 500 Meter nordwestlich davon ein weiteres vergleichbares Heiligtum identifiziert, was bedeutet, dass – ganz zu schweigen von der christlichen Metamorphose der ersten beiden Stätten – Kultorte, die schon vor der Existenz Roms entstanden waren, auch zu Zeiten der Stadt noch mehr als ein halbes Jahrtausend genutzt werden sollten: Diese äußerst lange Zeitspanne, die an dieser Stelle die Frühgeschichte mit einer noch in ferner Zukunft liegenden Geschichte verknüpft, ist das Zeichen dafür, dass die Entwicklung der Urbs tatsächlich begonnen hatte.