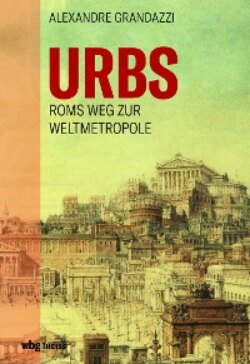Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 14
5 Die neue Stadt
ОглавлениеEine verwandelte Landschaft
So war die ursprüngliche Landschaft im Zuge einer ebenso symbolischen wie physischen Verwandlung verschwunden. Anstelle des natürlichen Geländes mit zahlreichen bewaldeten, durch tiefe, feuchte Täler getrennten Hügeln präsentierte sich nun ein einheitlicher zentraler Schauplatz: auf der einen Seite ein weitläufiges, erhöhtes Plateau, der Palatin, eingefasst und geschützt von jenem magischen Pomerium, das ihm einen privilegierten Status verlieh, auf der anderen eine mächtige Burg und zu Füßen der beiden Anhöhen eine Heilige Straße, die an einem nunmehr öffentlichen Raum entlangführte, während der Rest des Tales zunehmend besiedelt wurde. Zweifellos hatte jedes dieser Elemente für sich genommen auch schon in jener Zeit existiert, als ethnisch bestimmte Bünde noch die höchste Form des kollektiven Daseins waren. Auf dem Gipfel des albanischen Bundesbergs waren Jupiter und Mars seit Langem die großen Götter der Latiner, genau wie Vesta, deren ewiges Feuer dort immer noch von Priesterinnen gehütet wurde, den sogenannten ‚albanischen Vestalinnen‘, während ‚albanische Salier‘ auch weiterhin den Marskult pflegten.1 In Rom aber waren die Gottheiten nun an mehreren Stellen präsent: Das Heiligtum des Jupiter als Iuppiter Feretrius (Träger der Spolia Opima, der Feldherrenbeute) lag auf der Zitadelle des Tarpeius Mons, wovon möglicherweise ein 1926 entdecktes Votivdepot zeugt.2 Unter dem Namen Iuppiter Stator (der die Flucht Hemmende) wachte der Gott an einer nicht näher bekannten Stelle am Rand des Palatins, jenes Hügels, auf dem auch Mars eine heilige Stätte in salischer Obhut besaß. Alles ging weiter wie zuvor, und doch war alles anders: Mittlerweile gab es nicht mehr nur einen, sondern zwei heilige Berge, und in der Ebene, die sie voneinander trennte, brannte das Feuer der Gemeinschaft: zwar im Schatten des Palatins, aber nicht auf dem Hügel selbst, und gleichzeitig nicht weit vom Tarpejischen Berg entfernt. Dieses Feuer gehörte weder zur einen noch zur anderen Anhöhe – und somit auch nicht ausschließlich zum jeweiligen dort siedelnden Bevölkerungsteil. Stattdessen brannte es auf dem Forum, jenem Ort, an dem alle zusammenkamen und gemeinsam über ihr Schicksal entschieden. Die ewige Flamme, das antike Symbol ethnischer Identität, war zum Sinnbild einer Gesellschaft geworden, in der die Zugehörigkeit zur neuen Gemeinschaft die alten Denkweisen von Klan, Volk und persönlichem Status abgelöst hatte.
Durch die Verbindung von Latinern und Sabinern war das früheste Rom eine ‚Zwillingsstadt‘ (urbs geminata), deren Anziehungskraft und Stärke auf eben diesem Pluralismus beruhten. Dennoch waren die beiden Bevölkerungsteile in diesem Bündnis nicht gleichberechtigt. Stammte nicht ein Großteil der identitätsstiftenden Elemente der jungen Stadt von latinisch-albanischer Seite? Und wiesen nicht auch die Fassaden der Gebäude im Königsviertel zum Hang des Palatins, selbst wenn das Viertel hinunter in die Ebene verlegt worden war? Der Tarpeius Mons hingegen galt als sabinischer Pol im neuen Stadtgefüge, aber wenn die Überlieferung an diesem Punkt auch nur ein Körnchen Wahrheit enthält, zielte dessen Umwandlung in einen Zufluchtsort für alle, die in der Stadt leben wollten, auch für Fremde, Sklaven oder Heimatlose, gerade darauf ab, die sabinische Herrschaft über diesen Hügel zu schwächen! Doch die dreifache Aufteilung der römischen Bevölkerung verhinderte eine direkte Konfrontation, die sich zu einem Bürgerkrieg hätte entwickeln können: Die dritte Tribus nahm alle Zuwanderer von jenseits des Tibers auf und mit ihnen auch jeden, der weder Latiner noch Sabiner war.
Der Flusshafen
Mochten die dreißig Kurien auch nach dem Vorbild der dreißig latinischen Volksstämme des alten Albaner Bundes geformt sein, so folgten sie doch einer neuen Dynamik. Die Stadt imitierte zwar den Bund, aber nur, um dessen Kraft besser auf sich übertragen und anschließend seine Grenzen überwinden zu können. Denn anders als früher vermutet, war die neue Stadt nicht auf sich selbst beschränkt oder nur dem Land zugewandt. Keine 500 Meter von ihrem neuen öffentlichen Zentrum entfernt lag der ‚Viehmarkt‘, das Forum Boarium, wo schon seit über einem halben Jahrtausend Hirten aus den Bergen ihre Tiere gegen das lebenswichtige Salz tauschten.3 Doch nun gesellten sich zu den Hirten von einst neue Besucher, die mit ihren Schiffen über das Meer und den Fluss heraufkamen. In einem Mittelmeerraum, dessen Gewässer von immer zahlreicheren Flotten aus immer ferneren Ländern befahren wurden,4 sollte sich der Tiber als erheblicher Vorteil für die junge Stadt erweisen. Denn er war für die damaligen großen Boote mit wenig Tiefgang – eine Mischung aus Ruderboot, Segelschiff und Frachtkahn –, die vom Ufer aus gegen den Strom getreidelt wurden, das ganze Jahr über schiffbar. Auf Höhe des Viehmarkts und der Tiberinsel konnten diese Schiffe bequem am römischen Ufer anlegen. Da Archäologen ihre Waren ägyptischen Stils massenweise in Gräbern der gesamten Region gefunden haben und mittlerweile auch die Gefäße identifizieren können, in denen sie ihre Erzeugnisse transportierten, wissen wir, woher jene ersten Seefahrer stammten, welche die Hügel Roms vom Fluss aus entdeckten. Es waren Phönizier, und ihre Ankunft an den Küsten Mittelitaliens lässt sich in die letzten Jahrzehnte des achten, erste Erkundungsfahrten bereits an das Ende des neunten Jahrhunderts datieren.5 Geflohen vor den Wirren im assyrischen Reich, siedelten sich Kaufleute und Handwerker im gesamten westlichen Mittelmeerraum an, wo ihre technischen Fertigkeiten und ihr Geschick gefragt waren, vor allem auf der Insel Ischia, in der von den Griechen kurz zuvor gegründeten Kolonie Pitthekoussai. So waren die Einflüsse gleichermaßen intensiv wie wechselseitig, da auch die Griechen vieles von den Phöniziern übernommen hatten, mit denen sie in Kleinasien enge Kontakte pflegten. Die Phönizier brachten nun jene Stoffe, Parfüms, Elfenbeinschnitzereien und das Silbergeschirr nach Rom, die bei den einheimischen Eliten immer begehrter wurden. Doch noch war Rom für die Phönizier nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel, dem weiter flussaufwärts gelegenen mächtigen Veji. Hin und wieder floh eine Katze von ihren Schiffen, und so wurde in Fidenae, einer kleinen Siedlung am Flussufer, in den Überresten einer gegen Ende des neunten Jahrhunderts v. Chr. durch einen Brand zerstörten Hütte das Skelett des ältesten jemals in Europa identifizierten Exemplars dieser Spezies gefunden.6 Aber der Viehmarkt lag auf der Route der Kaufleute und bot ihnen einen bequemen und zunehmend lukrativen Halt. Wie überall entlang der Küsten, die sie besuchten, stellten sie den Ort, und damit ihre Geschäfte, unter den Schutz ihres großen Gottes Melkart. Bald kamen weitere Seefahrer, Griechen diesmal, und auch sie waren auf dem Weg nach Veji, um dort ihre bemalten Vasen zu verkaufen, auf die der etruskische Adel ganz versessen war. Aber einige veräußerten sie zuvor schon in Rom, wo die Archäologen des 20. Jahrhunderts in der Umgebung des Forums Boarium Scherben davon finden sollten.7 Bereits an anderen Orten, etwa auf Zypern, hatten die Griechen damit begonnen, Melkart mit ihrem Gott Herakles gleichzusetzen, und so geschah es nun auch in Rom, wo dieser den Namen seines Vorgängers mit der Zeit vollständig auslöschte. Den Namen, aber nicht die Riten: Im strikten Ausschluss von Frauen, im Einziehen eines Zehnts aller Geschäfte und in der besonderen Rolle der Priester seines Kultes im Heiligtum erkennt die moderne Forschung den großen orientalischen Gott wieder. Dessen Priester weihten sich, anders als es römischen Gebräuchen entsprach, ganz und gar seinem Dienst und waren somit tatsächlich „Besessene“ im Sinne des lateinischen Wortes potitii, eine Bezeichnung, die das kollektive Gedächtnis Roms später in den Eigennamen einer vermeintlich bedeutenden Familie umwandeln sollte … Dass die Römer den Namen Melkart mit der Zeit völlig auslöschten, verwundert nicht: Als sie ihre Geschichte niederzuschreiben begannen, waren sie in einen erbitterten Krieg gegen Karthago, die Erbin der Phönizier, verstrickt!8 Vorläufig jedoch waren diese, ebenso wie die Griechen und Etrusker, noch gern gesehen auf dem antiken Viehmarkt, wo der uralte Tauschhandel unter dem Schutz des Herakles nun um alle möglichen anderen Geschäfte ergänzt wurde. Fremde Handwerker, griechische Töpfer vor allem, ließen sich vor Ort nieder und beeinflussten die lokale Produktion, und über den Fluss strömten mit den Schiffen unablässig Menschen, Güter, aber auch neue Ideen in die Stadt. Anders, als es die römischen Stadthistoriker selbst Jahrhunderte später darstellen sollten, war Rom in ihren Anfängen mitnichten eine rein zum Land hin orientierte Bauernsiedlung, sondern dank des Flusses von Beginn an offen für die fernen Gestade jenseits des Meeres. Phönizier, Griechen und Etrusker, sie alle trugen ihren Teil zur Erfindung der Stadt bei, die am Ufer des Tibers allmählich Gestalt annahm. Aus ihrer, häufig gleichzeitigen, Anwesenheit und ihren Aktivitäten, die bald von Rivalität, bald von Kooperation geprägt waren, entstand ein lebendiges Viertel, ein wahrer Schmelztiegel und Ausgangspunkt jener Innovationen, die den städtischen Raum von Grund auf verwandeln sollten.
Eine Stadt wächst
Zunächst wuchs sie in ihrer zentralen Senke. In den Jahrzehnten nach ihrer Erbauung wurde die königliche Residenz beim Heiligtum der Vesta zwei Mal umgestaltet, bis sie schließlich zu einem Gebäude herangewachsen war, dessen Flügel einen kleinen Hof einfassten. Doch schon nach einem halben Jahrhundert riss man dieses Bauwerk, von einem komplexen Ritual begleitet, wieder ab: Sorgsam wurden die Trümmer in zuvor im Innenbereich ausgehobenen Gruben beigesetzt, während man dort gleichzeitig eine Grabstätte anlegte. In denselben Jahren wurde auch die Mauer um den Palatin niedergerissen, und die verbliebenen Trümmer wurden ebenfalls mit einer Sorgfalt begraben, die von religiösen Motiven zeugt. Wie sind in diesem Zusammenhang die rund fünf Grabstätten zu interpretieren, die kürzlich von Archäologen über den Resten jener ersten Mauer entdeckt wurden?9 Als Zeichen, dass das Tabu des Pomerium, welches eine Beisetzung von Toten innerhalb der Urbs verbot, zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder nicht mehr existierte? Gar dass die gesamte Vorstellung von einer geschlossenen Siedlung zu verwerfen sei und man sich hier entweder vor den Zeiten der Stadt oder außerhalb ihres Gebiets befand?10 Oder vielmehr doch als einen Beweis für den sakralen Charakter, der mit der alten Begrenzung selbst nach ihrem Abriss verbunden blieb? Bewahrte die Legende des Remus in diesem Fall womöglich die Erinnerung an Hinrichtungen, mit denen das Sakrileg der Zerstörung jener ersten Palatinmauer gesühnt werden sollte? Beide zum selben Zeitpunkt abgetragen, wurden die königliche Residenz und die Palatinmauer unmittelbar darauf auch gleichzeitig wieder neu errichtet, und zwar genau zu der Zeit, in der die erste Pflasterung des Forums erfolgte.11 Der öffentliche Charakter dieser Orte und Baumaßnahmen, die aufwendigen, zum Zeitpunkt der Arbeiten durchgeführten Rituale, die räumliche Verteilung der unterschiedlichen Operationen und ihre Gleichzeitigkeit – all das vermittelt uns nicht nur einen Eindruck vom Ausmaß des kollektiven Einsatzes, zu dem die römische Herrschaft mittlerweile fähig war, sondern auch von der Bedeutung, die sie der Schaffung einer neuen Form von städtischem Raum beimaß, der allgemein zugänglich und doch hierarchisch gegliedert war.
Überall entstanden weitere Behausungen, denn immer mehr Menschen zog es in die junge Stadt. Auf dem Palatin standen nun neue Hütten anstelle der alten: Jeder Familienklan verfügte über seine eigenen, von den anderen getrennt durch ein Stück Land, auf dem das Vieh stand.12 Unten im Tal folgten die Lebenden auf die Toten. Muss man in dieser Verdrängung ein weiteres Zeichen, einen weiteren Beweis für die Geburt Roms sehen? Tatsächlich war die zentrale Niederung schon seit fast einem Jahrhundert verlassen, nachdem sich die Nekropole in die vom Gelände vorgegebene Richtung weiterentwickelt hatte: Die jüngeren Gräber lagen nun weiter nordöstlich am Fuß des Cispius.13 Zumindest jedoch war der Bau von Wohnstätten auf dem Gebiet der ehemaligen Nekropole Ausdruck des Wachstums von jener Stadt mit den drei Tribus und den dreißig Kurien. Zwischen der Velia und dem Bach, an dem die Via Sacra verlief, aber auch auf der anderen Seite, gegenüber dem Heiligtum der Vesta,14 standen inzwischen Hütten, in denen Familien lebten. Die wenigen verbliebenen Gräber waren die von Kindern, die gleich neben der Hütte beigesetzt wurden, in der sie gewohnt hatten:15 Als seien diese jungen, zu früh beendeten Leben auf paradoxe Weise Garanten des Fortbestands künftiger Generationen auf römischem Boden. Erwachsene wurden anderswo begraben, auf jener Anhöhe, deren Name, Esquiliae, bereits verrät, dass sie ein Ort außerhalb (ex) war, an dem man nicht lebte (colere), außerhalb des Stadtgebiets also. Zwar hatte es am Fuß des Esquilins auch zuvor schon mehrere Gräberfelder gegeben, doch die neue Nekropole, die sich auf dem Hügel entwickelte, als nach und nach die ersten Generationen des geeinten Roms starben, sollte zur größten der gesamten Stadt werden. Sie wurde über Jahrhunderte hinweg bis zum Ende der Republik genutzt und somit zum Kern einer gewaltigen Totenstadt, die ebenso groß werden sollte wie die der Lebenden. Die in den Gräbern aus dem ersten Jahrhundert nach der Stadtgründung enthaltenen Objekte – Archäologen sprechen von Artefakten – sind hervorragende Indikatoren für die materiellen, sozialen und zweifellos auch spirituellen und religiösen Entwicklungen in diesem urbanen Schmelztiegel. Tatsächlich zeichnen sich einige Gräber durch einen zumindest relativen Reichtum aus, der von der Existenz einer selbstbewussten, dominanten Elite in der jungen römischen Gesellschaft zeugt. Waffen aus Bronze, aber auch zunehmend aus Eisen, verziertes aus Griechenland importiertes oder nach griechischem Vorbild gefertigtes Geschirr sowie schwere Gerätschaften und Schmuck aus Metall sind die Attribute jener Aristokratie, die in ihren Kurien eine führende Rolle einnahm und bald schon die traditionellen Hütten aufgab und in Residenzen zog, die wie jene des Königs an der Via Sacra mit Portiken und Bankettsälen ausgestattet waren.16
Auch auf dem Quirinal entstanden zahlreiche neue Gräber. Aber dort handelte es sich nicht um die bloße Erweiterung einer zuvor bereits bestehenden Nekropole. Maßstab und Welt hatten sich gewandelt. Die verstreuten, isolierten Gräberfelder des neunten Jahrhunderts waren mehr als zwei Kilometer von Palatin und Velia entfernt gewesen: Wie hätten sie zur selben Gemeinschaft gehören können wie diese Siedlungen, von denen sie durch tiefe, feuchte Taleinschnitte getrennt waren? Als nun jedoch die Täler erschlossen wurden und sich dort ein immer dichteres Netz aus Hütten ausbreitete, begannen deren Bewohner, ihre Toten entlang der Wege zu bestatten, die aus der zentralen Siedlung herausführten, und zwar auf den weiten Hochebenen von Esquilin und Quirinal. Rom wuchs also, kontrollierte inzwischen ein Gebiet, das auf gut hundert Quadratkilometer geschätzt wird,17 und hatte auch bereits den Tiber überquert: Durch die sieben Landbezirke (septem pagi) am gegenüberliegenden Ufer verfügte sie über einen wirkungsvollen Stützpunkt, um sich den Expansionsgelüsten der Etrusker – aus Veji, aber auch aus Caere – in Richtung der Salzgärten an der Küste zu widersetzen. Überall auf dem Land wurden die kleinen Weiler befestigt und zwischen ihnen neue Verbindungsstraßen angelegt, auf denen die römischen Adligen, gefolgt von ihren Getreuen, stolz im Wagen paradierten. Die Entwicklung der Gesellschaft und die urbane Gestaltung gingen also – damals wie heute – Hand in Hand.
Tanzende Priester
Zu Füßen von Palatin und Kapitol belebte sich die zentrale Bühne zusehends. Jedes Jahr, wenn mit dem Beginn des Frühlings erneut die Zeit der Feldzüge einsetzte, zogen auf der Via Sacra und dem Comitium jene Priester des Mars und des Quirinus vorbei, die Salier genannt wurden (vom lateinischen Verb salire, ‚springen‘, ‚hüpfen‘), also anders ausgedrückt: Tänzer. Noch 700 Jahre später sollte der Grieche Dionysios von Halikarnassos diese jungen Krieger mit bronzenem Wehrgehänge und spitzen Filzmützen singen und tanzen sehen: „Sie führen nämlich zur Flöte rhythmische Bewegungen in Waffen bald gleichzeitig, bald abwechselnd aus und singen zu den Tänzen bestimmte traditionelle Hymnen.“18 Rhythmisch mit Lanzen auf eigentümliche achtförmige Schilde einschlagend – eine Form, die mit dem Beginn des siebten Jahrhunderts v. Chr. außer Verwendung geriet –, spielten die beiden Salier-Gruppen die Schlacht auf dem Forum nach, die durch ihren Jahr für Jahr wiederholten rituellen Tanz zu einem der Gründungsmythen der Stadt wurde. Daher gehörten auch junge Mädchen der Bruderschaft an. Man fühlt sich an das erinnert, was Claude Lévi-Strauss eines Tages in Mittelamazonien in einem Dorf der Bororo-Indianer sah: „Es gab zwei Arten von Tänzen. Zuerst traten die Tänzer allein auf und verteilten sich auf zwei Quadrillen, die sich an beiden Enden des Platzes gegenüberstanden und mit dem Schrei ‚ho! ho!‘ aufeinander zurannten, wobei sie sich rasend schnell um sich selbst drehten, bis sie ihre Ausgangspositionen vertauscht hatten. Später schoben sich die Frauen zwischen die männlichen Tänzer, und es begann ein nicht enden wollender Rundtanz – ein Knäuel, das bald vorrückte, bald auf der Stelle trat, angeführt von nackten Vortänzern, die rückwärts gingen und ihre Rasseln schwenkten, während andere Männer auf dem Boden kauerten und sangen.“19 Wenn im Herbst der Monat Oktober die kriegerische Jahreszeit beschloss, zogen die Salier erneut durch die Stadt, diesmal zum Aventin, um dort die vom Blut der Feinde befleckten Waffen rituell zu reinigen.
Kriegsführung
In einem solchen Maße war der Krieg also für die Römer ein großes gemeinschaftliches Abenteuer, Quell der Begeisterung, aber auch einer Angst, die durch die Rituale, mit denen man ihn umgab, gebannt wurde! Denn durch ihre Kriegszüge errang die römische Gemeinschaft zunehmend die Herrschaft über benachbarte Völkerschaften und Städte. In einer Welt, die für ihren Lebensunterhalt immer noch den uralten Zwängen des Ackerbodens unterlag, bedeuteten Feldzüge für jeden Einzelnen in Rom die Aussicht auf plötzliche Festmähler und einen zumindest vorübergehenden und immer verlockenderen Überfluss. War eines der umliegenden Dörfer wie das geheimnisvolle Caenina erobert worden, geschah es nicht selten, dass die überlebenden Einwohner auf die Hügel am Tiber umgesiedelt wurden. So sollen die Albaner, also die Bewohner der im Massiv des Monte Cavo verstreuten Siedlungen, nachdrücklich aufgefordert worden sein, sich auf dem Eichenberg niederzulassen, der damals noch nicht Caelius hieß. Und einige Jahrzehnte später war der Aventin auf diese Weise zur neuen Heimat für die ehemaligen Bewohner der kleinen Städte Politorium, Tellenae und Ficana geworden, alle an jener Straße zur Küste hin gelegen, die Rom unter ihre Kontrolle zu bringen gedachte. Durch diese Deportationen, von denen stets Latiner betroffen waren, also leicht in das Gemeinwesen einzugliedernde Verwandte, wappnete sich Rom gegen das Risiko einer plötzlich erhöhten Sterblichkeit, die durch eine Epidemie jederzeit drohen konnte. Vor allem aber stärkte die Urbs auf diese Weise ihre demografische Überlegenheit gegenüber den benachbarten Städten, die sich auf ihr natürliches Wachstum beschränkten, was einen entscheidenden Vorteil in der Stunde des Kampfes bedeutete. Es handelte sich zugegebenermaßen um eine etwas plumpe Methode, und die Stadt sollte im weiteren Verlauf der Geschichte feiner ausgeklügelte Lösungen ersinnen, um die Zahl ihrer Bürger zu erhöhen, ohne sie gleich alle auf ihrem Grund und Boden ansiedeln zu müssen. In diesem Stadium ihrer Entwicklung jedoch erwies sich ein solches Vorgehen als äußerst wirkungsvoll und darf aus heutiger Sicht nicht als unwahrscheinlich abgetan werden. Denn wann immer es Archäologen gelingt, diese eroberten und auf römisches Gebiet verbrachten Gemeinschaften zu identifizieren, zeigt sich, dass es sich dabei um nicht mehr als große Dörfer handelte, die höchstens ein paar Dutzend Haushalte umfassten.20 Und genau wie die schon seit Generationen in Rom lebenden Einwohner wurden die Neuankömmlinge in die Kurien eingegliedert, die von nun an ihr ziviles, militärisches und religiöses Leben bestimmten. Die Lanze der latinischen Krieger und die Spindel ihrer Ehefrauen wurden so mit der Zeit zur Lanze der Quiriten und zur Spindel römischer Matronen.
Das Leben in den Kurien
Im römischen Siedlungsgebiet verfügte jede Kurie über ihren eigenen Versammlungsort, in jener Zeit noch nicht viel mehr als eine große Hütte. In regelmäßigen Abständen kamen die Mittglieder der Kurie dort zusammen, um unter dem Vorsitz ihres Oberhaupts (Curio) und ihres Priesters (Flamen) gemeinsam zu essen. Diese Mahlzeiten, die zunächst den Göttern und erst danach den Menschen gereicht wurden, waren Rituale, welche die Verbundenheit der Tafelnden stärkten: Gemeinsam zu essen, zu trinken und zu singen – auch das bedeutete, einer Kurie anzugehören und Römer zu sein. Wenn die jungen Männer eines Bezirks das waffenfähige Alter erreichten, erhielten sie das Recht, an diesen Banketten teilzunehmen, was ihren Eintritt in die Gemeinschaft der Quiriten symbolisierte. Es wurde also oft und nahezu überall auf dem Palatin, dem Kapitol und dem Forum gemeinsam geschlemmt, und diese Sitte, die damals noch eine unmittelbar politische Funktion hatte, sollte durch Gebräuche und Religion noch lange bewahrt bleiben. Das belegen erneut die Worte des Dionysios von Halikarnassos, dem als Fremdem auffiel, was einem Römer kaum von Belang erschienen wäre: „Ich habe jedenfalls in heiligen Gebäuden Mähler für die Götter gesehen“, schrieb er über die Kurien, „die auf uralten hölzernen Tischen auf geflochtenen Matten und in kleinen Keramikschüsseln angerichtet waren: grobes Gerstenbrot und Opferkuchen und Spelt, auch die Ersten bestimmter Früchte und andere derartige schlichte, wohlfeile und von jeglicher Geschmacklosigkeit weit entfernte Dinge.“21 Zum Zeitpunkt, als der griechische Rhetor sie beobachtete, teilten nur noch Götter und Priester ein karges Mahl, denn schon lange blieben die Bürger jenen Zusammenkünften fern, die mit der Entwicklung ihrer Stadt nicht Schritt gehalten hatten. Doch mehr als ein halbes Jahrtausend zuvor herrschte in den Versammlungsräumen noch ein reges Kommen und Gehen von Römern, die in ihrer Eigenschaft als Quiriten nicht nur Soldaten, sondern auch Bauern waren. So sah man sie beispielsweise jedes Frühjahr am 15. April vor allen Kurien und auf dem Kapitol eine trächtige Kuh opfern:22 Das ‚Opfer der trächtigen Kühe‘ (Fordicidia) wurde der Erde (Tellus) dargebracht und sollte durch eine Art magische Analogie deren Fruchtbarkeit und somit künftige reiche Ernten sichern. Denn hing von diesen nicht die demografische Vitalität der Quiriten ab?
Vom Ofen- zum Narrenfest
Dasselbe Anliegen erklärt, warum ein weiteres, ebenfalls mit der Frage des Lebensunterhalts verbundenes Fest unter dem Patronat des Gottes Quirinus noch lange Bestand haben sollte: die Fornacalia. Jede Kurie musste an wechselnden Terminen in den zu ihrem Bezirk gehörenden Öfen, denen das Fest seinen Namen verdankte, Getreidekörner rösten.23 Zu diesem wichtigen Vorgang, der die Haltbarkeit des Getreides verlängerte und seine Bekömmlichkeit erhöhte, brachte jeder Bauer seine Ernte. Und so war dies gleichzeitig eine Gelegenheit, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, wie viele Männer die Kurie eigentlich umfasste. Nun fanden aber am 17. Februar ebenfalls die Quirinalia statt, auch das ‚Fest der Narren‘ (Stultorum Feriae) genannt. Und mit diesen Narren war niemand anders gemeint als diejenigen, die aus Dummheit oder Nachlässigkeit den durch ihre Kurie für die Fornacalia bestimmten Tag hatten verstreichen lassen. Modernen Historikern erscheint das Versäumnis dieser vermeintlichen Narren, die ihren Pflichten als Quiriten nicht nachgekommen waren, umso entschuldbarer, als sie höchstwahrscheinlich gar keiner der dreißig Kurien der Stadt angehörten. Dieses merkwürdige Fest wird allgemein als Zeichen des Niedergangs einer Kurienordnung gewertet, die ab einem gewissen Moment nicht mehr richtig funktionierte und in der es immer mehr Abgehängte und Marginalisierte gab. In Wahrheit jedoch war das in den ältesten Feiertagskalender der Stadt einbezogene ‚Narrenfest‘ vielmehr Ausdruck der Dynamik eines Systems, das auf diese Weise ermöglichte, sämtliche Neuankömmlinge, die noch keiner bestimmten Kurie angehörten, als Quiriten aufzunehmen. Man sollte sich hüten, die Organisation der frühen römischen Stadt nach dem Maßstab dessen zu bewerten, was sie viel später einmal werden würde: eine bizarre Ansammlung überkommener Bräuche und unverständlicher Zeremonien. In der archaischen Epoche waren die Kurien durch und durch funktional, es handelte sich um ein lebendiges, offenes System, das dazu bestimmt war, das Wachstum Roms zu befördern. Aus diesem Grund errichtete die Stadt auch ein neues Gebäude, die sogenannten ‚neuen Kurien‘ (Curiae Novae), vermutlich auf dem Caelius, gegenüber der östlichen Spitze des Palatins, wo bereits ein älteres Gebäude, die ‚alten Kurien‘ (Curiae Veteres), stand. Zweifellos waren es Überreste dieses ersten Baus, die vor etwa zwanzig Jahren beim Konstantinsbogen gefunden wurden.24 Der Neubau am Ende des siebten Jahrhunderts v. Chr. hingegen markierte nicht den Beginn der urbanen Ära – das war der Bau der Palatinmauer –, sondern vielmehr den Eintritt in die finale Phase eines Prozesses, der seit nunmehr über einem Jahrhundert im Gang war.
Ein gemeinsamer Versammlungsort
Wann immer es die Umstände erforderten, traten alle Kurien in einer großen Versammlung zusammen, was jedoch nur auf Einberufung des Königs geschah. Für diese großen Momente des Gemeinschaftslebens hatte man den Boden des zentralen Tales angehoben und schon sehr früh am Kapitolshang mit dem Anlegen eines speziellen Versammlungsplatzes (Comitium) begonnen. Wenn das römische Volk dort zusammenkam, wurde ein Wachkommando auf dem Tarpejischen Berg postiert, welches das Gebiet jenseits des Flusses für den Fall im Auge behielt, dass der Feind einen Angriff wagen sollte. Vom Comitium aus sahen die Quiriten dann dort oben die ‚rote Kriegsfahne‘ wehen,25 Zeichen einer Wacht, die es ihnen erlaubte, sich ohne Furcht zu versammeln. Um das Jahr 650 vor unserer Zeitrechnung wurde dieser Platz vergrößert und sein Boden befestigt,26 und die römische Überlieferung schreibt diese Veränderungen ebenso König Tullus Hostilius zu wie den Bau einer Kurie, die seinen Namen trug (Curia Hostilia) und von der moderne Archäologen möglicherweise Überreste in Gestalt einiger Dachziegel gefunden haben.27 Denn der Senat, ein Ältestenrat, wie sein Name verrät (senatus, abgeleitet von senes, ‚Greise‘), der dem König zur Seite stand, benötigte für seine Beratungen nun ein Gebäude. Vor dessen Türen mussten die Quiriten in Anwesenheit des Königs die Entscheidungen gutheißen, die ihnen vorgelegt wurden, was sie taten, indem sie mit ihren Lanzen auf ihre Schilde schlugen: Dieser ‚zustimmende Lärm‘ – der Begriff ist offenbar abgeleitet von fragor (Getöse)28 – war das Suffragium, die erste Form der Beteiligung römischer Bürger an den ‚politischen‘ Entscheidungen, die ihre kollektive Zukunft betrafen. Ihre Zustimmung war vor allem unerlässlich, wenn nach dem Tod des Königs dessen Nachfolger gewählt werden musste. Dann trat ein Senator, zu diesem Anlass Interrex (Zwischenkönig) genannt, auf den Abhang über dem Comitium und rief der versammelten Menge den Namen desjenigen zu, auf den sich der Senat geeinigt hatte. Das Volk der Quiriten brauchte den vorgeschlagenen Kandidaten jetzt nur noch zu akzeptieren. Reine Formsache? Ja und nein, denn obwohl die Quiriten in den vorausgegangenen Auswahlprozess nicht einbezogen waren, konnte dem neuen König ohne ihre einstimmige und öffentlich auf dem Comitium und dem Forum erteilte Zustimmung nicht die oberste Gewalt übertragen werden. Ebenso zwingend erforderlich war ihre Anwesenheit an der Seite des Senats, wenn der König sie am ersten Tag eines jeden Monats und dann ein paar Tage später erneut auf dem Tarpeius Mons, dem Hügel des Gottes Jupiter, zusammenrief (im Lateinischen calare, weshalb der erste Tag des Monats als ‚Kalenden‘ bezeichnet wurde), um allen die Daten der bevorstehenden religiösen Zeremonien zu verkünden. Diese in der Curia Calabra auf dem Kapitol abgehaltenen Comitia Calata waren insofern notwendig, als es noch keinen schriftlichen Kalender gab, den die Römer hätten zurate ziehen können. Es herrschte eine mündliche Kommunikation, und damit diese Folgen zeitigen konnte, hatte sie notwendigerweise öffentlich zu erfolgen.
Das war auch der Grund für die Existenz einer weiteren seltsamen Zeremonie, die am 24. Tag der Monate März und Mai abgehalten wurde und an die man sich in der klassischen Epoche nur noch in Form einer rituellen, mit der Zeit unverständlich gewordenen Formel erinnerte: „Sobald der König die Versammlung einberufen hat, ist menschliches Handeln erlaubt“ (quando rex comitiauit, fas). Was könnte damit gemeint sein?29 Bevor die Quiriten in den Krieg zogen, wurden sie von ihrem König auf dem zentralen Platz der Stadt zusammengerufen, und jeder verkündete öffentlich seinen letzten Willen, falls ihm ein Unheil zustoßen sollte. Die Gemeinschaft fungierte somit gleichermaßen als Zeuge und Garant für die auf diese Weise vor allen eingegangenen Verpflichtungen. Comitiauit: Dasselbe lateinische Wort bezeichnete das Einberufen der Versammlung und den Ort, an dem sie abgehalten wurde, das Comitium. Nichts verdeutlicht besser den charakteristischen und unauflöslichen Zusammenhang zwischen Orten und öffentlichen Funktionen in der jungen Stadt. Die römische Gemeinschaft hatte auf diese Weise einen neuen Raum geschaffen, der nicht nur Schauplatz, sondern geradezu Voraussetzung ihrer Existenz als organisiertes Gemeinwesen war – ein neues Verhältnis zum Raum also, das unweigerlich auch ein neues Verhältnis zur Zeit mit sich brachte in diesem System, das alle räumlichen und zeitlichen Bezugspunkte religiösen Regeln unterstellte. Aus diesem Grund sollte die römische Religion, die mit der Stadt zusammen geboren worden war und sich mit ihr gemeinsam entwickelte, bis ans Ende ihrer Geschichte so viele Erinnerungen an jene archaischen Zeiten bewahren, als deren Museum und Denkmal sie in den Augen des modernen Betrachters erscheint. So übertrug etwa die republikanische Führung später einem ‚Opferkönig‘ genannten Priester den Vollzug der zuvor vom König durchgeführten Rituale, weil sie diese als zu wichtig erachteten, um sie einfach aufzugeben. Doch zunächst zeigte sich der König – als Verkörperung dieser organischen Verbindung von Zeit und Raum in der neuen urbanen Einheit – im Jahresverlauf an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen der Stadt, um dort jene Rituale zu vollziehen, die es der Gemeinschaft ermöglichten, sich im Einklang mit den Göttern zu fühlen.
Königliche Rituale
Ende Februar beispielsweise brachte er auf dem Comitium ein Opfer dar, nur um gleich darauf ausschließlich von den Saliern begleitet im Laufschritt vom Forum zu fliehen. Wozu diese ‚Königsflucht‘ (regifugium), die ihn nicht davon abhielt, einige Tage später zurückzukehren und die Zeremonien zum Märzanfang zu leiten, die den wahren, sowohl agrarischen als auch kriegerischen Neuanfang des Jahres markierten? Das wussten die Römer selbst nicht mehr, als sie begannen, ihre Vergangenheit niederzuschreiben. Nicht ohne Schwierigkeiten hat die moderne Forschung dieses vorübergehende Verschwinden des Königs mit der Notwendigkeit in Verbindung gebracht, dem Kalender einige Tage hinzuzufügen, mit der sich die Priester jenes archaischen Roms regelmäßig konfrontiert sahen, wollten sie ihre auf den Mondphasen beruhende Zeitrechnung mit dem Sonnenjahr in Übereinstimmung bringen.30 Diese Anpassung erfolgte in der Zeit nach der Wintersonnenwende und vor jenem Neubeginn, den der Frühling mit sich brachte. Da der normale Jahresablauf durch den Einschub einiger zusätzlicher Tage angehalten werden musste, öffnete der König diese ‚Auszeit‘ im wahrsten Sinne des Wortes, indem er vom Forum weglief und aus dem Blick der Quiriten verschwand.31
Andere Rituale hingegen erforderten sein wiederholtes Erscheinen im öffentlichen Raum: Im Rahmen von Agonia (Opferhandlungen) genannten religiösen Festen, die an unterschiedlichen Tagen auf dem Forum, im königlichen Palast, auf dem Kapitol und auf dem Quirinal abgehalten wurden, opferte der König einen Widder. In dieser vier Mal im Jahr stattfindenden Zeremonie erkennt man unweigerlich die Opferung des Sündenbocks,32 durch welche die römische Bürgerschaft sich in ihrem Zentrum und an strategischen Punkten ihrer äußeren Grenzen schützte und stärkte. Verkörperte der König durch seine Flucht beim Regifugium die Zeit im Raum, ließ er mit den Agonia den Raum im Zeitenlauf leben. Und in all diesen Fällen handelte es sich um einen Raum und eine Zeit, die tief verankert waren in der urbanen Realität Roms.
Das Einholen der Auspizien
Der Bürgschaft, die der König auf diese Weise für das öffentliche Leben der römischen Gemeinschaft leistete, lag die allgemeine Überzeugung zugrunde, dass er dank seines heiligen Amtes als Einziger in der Lage sei, der Stadt auch weiterhin den Schutz Jupiters, ihres höchsten Gottes, zu sichern. Deswegen ging jedem öffentlichen Akt, den der König zu vollziehen hatte, eine Vogelschau voraus. Vögel galten als Übermittler göttlichen Willens, weshalb von ihrer Beobachtung darauf zu schließen war, ob Jupiter einem Vorhaben wohlgesinnt war oder nicht. Indem der König die ‚Auspizien einholte‘, wie die Römer dies nannten, erneuerte er jedes Mal wieder den Segen, den Jupiter Romulus im Zuge der Stadtgründungsrituale erteilt haben sollte – eine mystische Erneuerung, die für Rom unerlässlich war und zu welcher der König, als Träger der Auspicia Maxima, der Stadt als Einziger verhelfen konnte. Was jedoch nicht bedeutet, wie man lange geglaubt hat, dass das gesamte Comitium und das Forum ‚inaugurierte‘ Bereiche waren,33 also durch die Auguren – auf die Einholung der Auspizien spezialisierte Priester – vorab von bösen Mächten befreite und sakral begrenzte Flächen: Nur das Podium, auf dem der König stand, verfügte über diese Eigenschaft, und das genügt als Erklärung dafür, dass das Comitium fast exakt nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet war. Die eigentliche Plattform zur Beobachtung des Vogelflugs befand sich hoch über dem Forum auf der Burg (Arx), der nördlichsten und höchsten Erhebung des Tarpejischen Berges:34 An dieser ‚inaugurierten‘ Stelle wurde dem König am ersten Tag seiner Herrschaft sein sakrales Amt übertragen, und von dort aus holte er die Auspizien ein, bevor er zu einem Feldzug aufbrach. Dort oben überblickten die Auguren, nach Süden gewandt, einen weiten Horizont: Zu ihrer Linken lag der Esquilin, zu ihren Füßen das Comitium und direkt vor ihnen der Palatin, Keimzelle der ersten urbs. Die Ritualhütte, von der aus sie den Himmel beobachteten, stand auf einer freien Fläche, abgesehen von ein paar Bäumen zur Orientierung, und in späteren Zeiten glaubte man, der Gründer Roms selbst habe in ihr gelebt …
Obwohl die Ansichten zum genauen Verlauf der Via Sacra auch nach 200 Jahren intensiver wissenschaftlicher Forschung noch immer auseinandergehen,35 scheint diese im Bereich des Forums in weiten Teilen der Sichtachse desjenigen entsprochen zu haben, der wie der König und die Priester hoch oben auf dem Tarpeius Mons stand. Und in der unmittelbaren Verlängerung des Forumtals erhob sich am Horizont der bläuliche Umriss des Albanus Mons, des Zentrums des archaischen Latinerbunds. Von der Stadt aus erreichte man den magischen Berg der alten Zeiten über die sogenannte Via Latina, die diesen Namen trug, weil sie eben zum großen latinischen Heiligtum führte. Und ihr Verlauf bildete in gerader Linie die exakte Verlängerung der Sichtachse vom Tarpejischen Berg über die zentrale Senke bis hin zu den Albaner Bergen.36 Mit anderen Worten, sämtliche öffentlichen Akte der römischen Bürgerschaft erfolgten mit Bezug und zweifellos auch in Konkurrenz zu jenem alten Bund, welcher der Stadt vorausgegangen war. So stand der städtische Raum der Urbs in symbolischem Verhältnis zu einem sakralen Zentrum, das zwar außerhalb ihres Gebiets lag, aber trotzdem den zugleich noch nahen wie bereits fernen latinischen Teil ihrer kollektiven Identität definierte.
Symbolische Doppelungen
Die urbane Gemeinschaft artikulierte sich in hohem Maße in symbolischen Stätten, die inzwischen beinahe ausnahmslos auf dem Forum oder in dessen unmittelbarer Umgebung angesiedelt waren. Es hat ganz den Anschein, als sei der Palatin, obgleich Inbegriff der sakral begründeten urbs, nun an den Rand der neuen Stadtentwicklung gerückt, zumindest, was das öffentliche Leben betraf. Auf die Ficus Ruminalis, den Feigenbaum in der Nähe des Lupercal, unter dem die Wölfin angeblich die Zwillinge gesäugt hatte, auf die Plattform, von der aus Romulus die Auspizien eingeholt haben sollte, und auf die erste Grube, in die jeder seiner Gefährten etwas Erde aus seinem Heimatdorf geworfen hatte, folgten auf dem Tarpeius Mons ein zweites ‚Haus des Romulus‘, die Fläche zur Vogelschau auf der Burg und später dann auf dem Comitium, in der Nähe des Heiligtums des Vulcanus, gleich drei heilige Bäume: eine Zypresse, ein Lotosbaum und ein – ebenfalls Ficus Ruminalis genannter – Feigenbaum, der kultische Baum, Garant des Überlebens der Stadt. In unmittelbarerer Nähe dazu kommunizierte die Gemeinschaft beim Mundus, jener unterirdischen Höhle, die genau in der Weltachse liegen sollte, drei Mal im Jahr mit ihren Toten.37 Diese Repliken waren keineswegs, wie allzu oft behauptet, inhaltsleere Fortführungen der Tradition, sondern in den Begriffen symbolischer Topografie ein Zeichen für die Verlagerung ihres Schwerpunkts durch eine neue, in dynamischem Wachstum begriffene Stadt.38
Neue Grenzen
In Anbetracht der ‚internationalen‘ Beziehungen, wie sie im noch archaischen Latium jener Zeit gepflegt wurden, ist es ausgeschlossen, dass dieses auf Kapitol, Forum, Palatin und Velia konzentrierte Rom keine klar umrissenen, mithilfe der Religion unter den Schutz der Götter gestellten Grenzen hatte. Das Pomerium genügte nicht mehr, da sich die Stadt mittlerweile weit über den magischen Bannkreis ausgedehnt hatte, der lediglich den Palatin umschloss. Wenn auch die spätere Entwicklung der Stadt die Erinnerung an jenes alte Rom des Forums nahezu ausgelöscht hat, ist diese an einigen wenigen Stellen doch noch aufzufinden. In dem kleinen, aber sehr alten Heiligtum des Janus in der Nähe der Curia, wo das Argiletum ins Forum mündet, kann man noch eines der Stadttore jener Zeit identifizieren, das sich zum sabinischen Quirinal hin öffnete:39 Als Durchgangsort stand es naturgemäß unter dem Schutz des Janus, in diesem Fall des ‚zweifachen‘ Janus (Ianus Geminus) oder auch des Ianus Quirinus, der die Gemeinschaft der Quiriten beschützte. Und zwischen Velia und Carinae bewahrte der sogenannte ‚Schwesterbalken‘ (Tigillum Sororium) noch bis in die Kaiserzeit hinein die Erinnerung an ein weiteres Stadttor, diesmal zum Territorium der Latiner hin gelegen. An dieser Stelle habe, wie es später hieß, der junge Krieger Horatius nach seiner Rückkehr aus dem Kampf, den er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern gegen die drei albanischen Curiatier geführt hatte, seine Schwester getötet, die mit einem der Besiegten verlobt und über die Nachricht von seinem Tod verzweifelt gewesen sei. Um sein Verbrechen zu sühnen, habe man ihn dazu verurteilt, unter einem Balken hindurchzugehen, einem Joch, das ihn von dem Makel des vergossenen Blutes reinigen würde. Eine erbauliche Geschichte, welche die moderne Wissenschaft heute entschlüsselt wie ein Bilderrätsel.40 In der Drillingsstruktur der beiden gegnerischen Gruppen erkennt sie eine Anspielung auf die drei Tribus der Stadt, in den – in einigen antiken Quellen vertauschten – Namen einen Verweis auf das System der Kurien sowie auf die Gens Horatia, das mächtige Geschlecht der Horatier, das die Ländereien im Südosten der Stadt in seinen Besitz gebracht hatte. Die Ortsbezeichnung selbst wird mit einem Verb in Verbindung gebracht, welches das erste Auftreten weiblicher Merkmale bei jungen Mädchen bezeichnet. Entweder weil diese ursprüngliche Bedeutung in Vergessenheit geriet oder aber aus Schamgefühl glaubten die Römer, es sei von einer ‚Schwester‘ die Rede, für die dann notgedrungen auch eine Rolle in der Geschichte gefunden werden musste. Aber worum handelte es sich dabei tatsächlich?
Das Vorhandensein zweier Altäre rechts und links des Balkens, der eine dem Ianus Curiatus geweiht, der andere der Iuno Sororia, verrät, dass der Balken in Wirklichkeit ein Tor war. Das kollektive Gedächtnis der Stadt hat die Erinnerung an die für eine archaische Gemeinschaft so wesentlichen Initiationsriten heranwachsender Jugendlicher in einen patriotischen Mythos verwandelt. Einer äußerst starken räumlich-biologischen Symbolik gehorchend, wurden die Rituale, die den Übergang eines Jahrgangs in das Erwachsenenalter begleiteten, also den Wechsel von einem Status in den folgenden, an Stadttoren als Inbegriff des Durchgangs begangen. Die Jungen huldigten dort Janus, dem Gott des Wandels, in diesem Fall Curiatus genannt, weil er ihrem Eintritt in die Kurien vorstand, und die Mädchen der Iuno Sororia, weil sie bald Mütter werden, Kinder stillen und so die Macht Roms vergrößern würden. Bezeichnenderweise fanden diese Rituale im Oktober statt, nach dem Ende der Feldzüge, wenn die in die Stadt zurückkehrenden Krieger sich von jener Raserei (furor) lösen mussten, die im Kampf ihre Stärke ausgemacht hatte. Tore wie dieser ‚Schwesterbalken‘ lassen somit vermuten, dass es eine befestigte Linie um das neue Stadtgebiet gegeben hat.41 Die mächtigen, von Gräben gesäumten künstlichen Aufschüttungen (aggeres), die Archäologen an mehreren Orten des archaischen Latiums identifiziert haben,42 vermitteln einen anschaulichen Eindruck vom ‚Erdwall der Carinae‘, dessen Spuren durch die städtische Expansion bis auf seinen Namen restlos getilgt wurden. Mit ihm versperrten die Römer den Zugang zu ihrer Stadt vom Esquilin aus. Andere Ortsbezeichnungen, die im kollektiven Gedächtnis der Stadt überdauert haben, etwa der sogenannte Murus Mustellinus und die Porta Saturnia oder Porta Pandana (das offene Tor), zeugen von Befestigungen am Fuß der Hänge der Velia und des Tarpejischen Berges. Dort befand sich auch ein weiteres Tor, die porta Stercoraria (Unratstor), welches die Vestalinnen nutzten, wenn sie nach der jährlichen Reinigung ihres Heiligtums zum Tiber gingen, um alles, was sie aufgesammelt hatten, in den Fluss zu werfen.
Das Bannen der Angst
Trotz ihrer Befestigungen war Rom nicht allein auf ihr Kerngebiet beschränkt. Zwar wurde die große Schwemmlandebene, die sich nordwestlich der Anhöhen von Tarpejischem Berg und Quirinal bis zu den Flusskehren erstreckte, noch nicht dauerhaft besiedelt, im Leben der Stadt aber war sie nunmehr präsent. Die riesige, öde Fläche wurde von einem träge dahinfließenden Fluss, der Amnis Petronia, durchzogen, deren Wasser in einer Senke inmitten des Geländes stand und den sogenannten ‚Ziegensumpf‘ (Palus Caprae) bildete. Und genau dort wurden zu Beginn des Monats Juli eine ganze Reihe seltsamer Rituale vollzogen:43 Zunächst strömten die Quiriten, einander beim Namen rufend, im Laufschritt aus ihrer Stadt an den Sumpf. Zwei Tage nach dieser ‚Flucht des Volkes‘ (poplifugia), die an die ‚Königsflucht‘ (regifugium) im Februar erinnert, wurde dann das Fest des Ziegenbocks (Nonae Caprotinae) gefeiert. Als Männer verkleidet, bildeten die Frauen der Stadt, unter ihnen auch Sklavinnen und Prostituierte, zwei Gruppen, die einander mit Steinen bewarfen, während sie den Schaulustigen ausgelassen Schmähungen zuriefen. Dann opferten sie unter einem heiligen Feigenbaum, von dem sie einen Zweig abrissen, einen Bock. Und schließlich ahmten sie unter reichlich Gelächter und Spötteleien die Gesten des Geschlechtsakts nach. Am darauf folgenden Tag verlieh ein Dankopfer dieser eigentümlichen rituellen Abfolge einen triumphalen Charakter. Weil die antiken Gelehrten diese Riten nicht mehr verstanden, erfanden sie einen kompletten Handlungsablauf, der sich aus einer Flucht der Römer vor ihren Feinden – von denen man nicht mehr wusste, ob es Etrusker oder Gallier gewesen waren –, weiblicher List und der Hingabe von Mägden an ihre Herrinnen zusammensetzte. Was die Stadt jedoch tatsächlich im Norden ihres Territoriums durch die Flucht ihrer Armee – denn das war die ursprüngliche Bedeutung des Wortes populus – inszenierte, war die kosmische Krise der Sommersonnenwende, ab der die Tage unweigerlich immer kürzer wurden. Dieses Schwinden des Lichts wurde als Bedrohung für das gemeinschaftliche Leben gefürchtet und führte zu einer Erschütterung der männlichen kriegerischen Tugenden, die üblicherweise einen reibungslosen Ablauf sicherten. Nur die fröhliche Entfesselung einer siegreichen, die Fortpflanzung sichernden weiblichen Fruchtbarkeit konnte diese Gefahr bannen und durch eine kontrollierte, am Rand des urbanen Raums zelebrierte Grenzüberschreitung die natürliche – männliche – Ordnung wiederherstellen. Feigenbaum, Bock und Ziege, Frauen: So zeugten die unterschiedlichen Domänen der Lebewesen – Pflanzen, Tiere und Menschen – im Ritual vereint, von der befruchtenden, erlösenden Allmacht der Sexualität. Wie schon bei den im Februar gefeierten Lupercalia vermochte nur sie der Stadt zum Sieg über die stets bedrohlichen dunklen Mächte und zum künftigen Wachstum der Bevölkerung zu verhelfen.