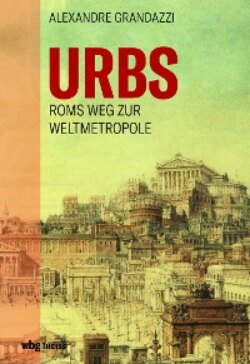Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 16
7 Das große Rom der Tarquinier
ОглавлениеIrrtümer und Vorurteile
Anderthalb Jahrhunderte nach dem Beginn der ersten öffentlichen Arbeiten in ihrem politischen Zentrum hatte die Stadt an der Brücke den Übergang zu einer entscheidenden Phase in ihrer Geschichte erreicht. Noch ein Jahrhundert, dann sollte sie eine der mächtigsten Städte, einer der mächtigsten Staaten im gesamten westlichen Mittelmeerraum sein, ebenjenes ‚große Rom der Tarquinier‘, als das ein hellsichtiger Experte sie in den 1930er-Jahren bezeichnete, der Italiener Giorgio Pasquali, dessen lange verkannten Analysen durch jüngste Forschungen und Entdeckungen schließlich doch noch bestätigt wurden.1 Muss man deswegen, wie es immer noch häufig geschieht, Rom in der zweiten Hälfte der Königszeit tatsächlich als eine etruskische Stadt betrachten, deren Entwicklung und Strahlkraft allein ihren neuen Herrschern, den tarquinischen Königen, und dem, was sie mitbrachten, zuzuschreiben sei? Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde gar die Ansicht vertreten, im achten und siebten Jahrhundert v. Chr. sei im Bereich der Hügel nichts Nennenswertes geschehen, ja Rom sei überhaupt erst ab dem späten siebten, vor allem aber im sechsten Jahrhundert dank der Maßnahmen seiner etruskischen Könige und deren kulturellen Hintergrund zur Stadt geworden. Trotz einiger widerstrebender Zugeständnisse an die neuen Erkenntnisse bezüglich der frühesten Epoche gilt heute noch weitgehend dieselbe Argumentation: Viel zu oft ist mit Blick auf das sechste Jahrhundert v. Chr. noch von den ‚Anfängen Roms‘ die Rede und spricht man den Etruskern die entscheidende Rolle bei der Artikulierung eines städtischen Gemeinwesens am Ufer des Tibers zu. Rom sei demnach gar keine römische Erfindung, wenn man so sagen darf: Erst späte, äußere Impulse hätten die Urbs zum vollen Bewusstsein ihrer selbst gelangen lassen und es ihr endlich ermöglicht, zu einer Stadt zu werden, die dieses Namens würdig sei.
Der Reiz von Vorurteilen liegt in ihrer Schlichtheit, und ebenso wenig wie andere hält dieses komplexen Fakten und Analysen sowie den neuen archäologischen Befunden stand.
Das zugegebenermaßen weit verbreitete Bild einer Stadt Rom, die ihre urbane Identität der etruskischen Kultur verdankt, beruht in Wahrheit auf einer Ansammlung falscher Vorstellungen.2 Zunächst einmal der Annahme, es habe ein einziges, unteilbares Gebilde namens Etrurien gegeben, vergleichbar mit den Nationen, aus denen sich im 19. Jahrhundert Europa zusammensetzte. Stattdessen gab es lediglich etruskische Städte, die einander in Rivalität, sehr oft sogar in erbitterter Feindschaft gegenüberstanden. Und nur durch das Ausnutzen dieser Rivalitäten gelang es der Stadt Rom, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, bis sie selbst stark genug war, anderen ihre Herrschaft aufzuzwingen. Der zweite Irrtum besteht in der Gleichsetzung der Tarquinier mit Etruskern.
Antiken Historikern zufolge stammte Tarquinius zwar aus der Stadt Tarquinia, der er seinen Namen verdankte, er selbst allerdings war der Sohn eines korinthischen Kaufmanns namens Demaratos, also ebenso sehr Grieche wie Etrusker. Wenn die Archäologie die Überlieferung auch in diesem speziellen Punkt nicht zu bestätigen vermag, so lässt sie diese doch als durchaus glaubhaft erscheinen: In den letzten 200 Jahren wurden in toskanischen Nekropolen Tausende von Vasen gefunden, die man zunächst für etruskisch hielt,3 bis sich herausstellte, dass sie tatsächlich griechischen Ursprungs waren und die Etrusker sie von griechischen Händlern wie Demaratos gekauft hatten. Und in einem allgemeineren Kontext belegt die Archäologie, dass das sechste Jahrhundert v. Chr. eine Phase großer Umbrüche war, nicht nur in Rom oder Etrurien, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Der persische Vormarsch in den griechischen Städten Kleinasiens – der heutigen Westküste der Türkei – und die politischen Turbulenzen in einigen griechischen Stadtstaaten führten zum Exodus zahlreicher Künstler und Handwerker, deren Ideen und Techniken sich rasch in den Städten des Westens ausbreiteten. Der sogenannte orientalisierende Stil wurde also keineswegs in den etruskischen Zentren entwickelt und gelangte auch nicht von dort aus in ein Rom, das ohne sie niemals damit in Berührung gekommen wäre. Und es zeugt zudem von einer gewissen Naivität, zu glauben, eine Gesellschaft könne allein durch den Einfluss ihrer Herrscher auf eine derart einschneidende Weise verändert werden. Tatsächlich war der Wandel, den wir in Rom im Laufe dieses sechsten Jahrhunderts beobachten können, das Ergebnis langer und komplexer Entwicklungen, die die gesamte Stadtbevölkerung betrafen.
Natürlich darf man den Einfluss der etruskischen Kultur dabei nicht außer Acht lassen.4 Zwischen Forum und Viehmarkt entstand ein ‚etruskisches Viertel‘ (Vicus Tuscus), dessen derart als Fremde gekennzeichneten Einwohner sich in Wort und Schrift einer Sprache bedienten, wie sie in den Städten jenseits des Tibers geläufig war. Im Laufe der Zeit nahm ihr Etruskisch durch den täglichen Umgang mit dem Lateinischen jedoch einen spezifisch römischen dialektalen Einschlag an, den Fachleute in von ihnen hinterlassenen Inschriften klar identifizieren können. Dies war die Zeit, in welcher der Tiber unter dem ursprünglich etruskischen, aber latinisierten Namen Volturnus verehrt wurde – wobei der Name auch genau umgekehrt entstanden sein könnte. Doch wie wir sehen werden, sprach man in diesem vermeintlich etruskischen Rom selbst in Herrscherkreisen nachweislich weiterhin Latein.5 Die Wahl eines Fremden zum König darf also nicht als Ankunft der Zivilisation in einem barbarischen Umfeld gewertet werden, das bis dahin keinerlei zivilisatorische Anzeichen gezeigt habe, sondern vielmehr – und viel simpler – als ein Weg rivalisierender Parteien, sich auf einen für alle akzeptablen Kandidaten zu einigen. Aus demselben Grund votierte etwa der polnische Sejm mehrfach dafür, das Königreich einem fremden Fürsten anzuvertrauen. In einer Stadt, in der die Macht nicht erblich war, hatten diese Könige ein Amt inne, das ihnen auch wieder streitig gemacht werden konnte. Aus den beschwichtigenden Worten der antiken Überlieferung rekonstruiert die moderne Forschung vor dem Hintergrund weitreichender sozialer und demografischer Veränderungen erbitterte, manchmal sogar gewaltsam ausgetragene Rivalitäten. Zuweilen war nicht nur die Einheit der Macht, sondern mit ihr gleich die Einheit der Stadt bedroht, kam es doch vor, dass ein Thronanwärter einen bestimmten Hügel von seinen Gefolgsleuten besetzen ließ, um seinen Willen durchzusetzen. Die letzten Könige der römischen Monarchie erinnern daher weniger an europäische Regenten der frühen Neuzeit als vielmehr an die condottieri der Renaissance, diesen Kriegsherren und Fürsten in Personalunion.
Das kollektive Gedächtnis der Stadt lässt zwei Dynasten mit dem Namen Tarquinius auftreten, zwischen die sich mit Servius Tullius ein Herrscher latinischen Ursprungs schiebt. Was man früher für eine artifizielle Verdopplung durch eine sehr viel später entstandene Überlieferung hielt, gilt heute als Vereinfachung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehr als zwei Tarquinier gab und die Regierungszeit von Servius Tullius auf fast ein halbes Jahrhundert ausgedehnt wurde, um diese Tatsache zu verschleiern. In diesem Fall könnte die Dynastie der Tarquinier auch deutlich vor dem Jahrzehnt 580–570 v. Chr. an die Macht gelangt sein, welches der frühestmögliche Ausgangspunkt wäre, sollten unter dem Namen Tarquinius tatsächlich nur ein Vater und sein Sohn regiert haben.6 Letzterer wurde im Jahr 509/506 v. Chr. vom Thron vertrieben, was gleichzeitig das Ende der römischen Monarchie bedeutete, und dieses Datum ist aus vielerlei Gründen gesichert. Die antike Überlieferung hingegen datierte den Beginn der Regierungszeit von Tarquinius dem Älteren auf das Jahr 616 v. Chr. Ist es ein Zufall, dass in dieses Ende des siebten Jahrhunderts v. Chr. ausgerechnet die Phase fällt, in der die ersten Anzeichen für größere Veränderungen in der Architektur und dem Stadtbild Roms zu erkennen sind, insbesondere was die Verwendung neuer Baumaterialien betrifft? Und gab es tatsächlich nur sieben Könige? In republikanischen Zeiten war gelegentlich, wenn auch stets sehr vage, von einem achten Herrscher die Rede. Wie dem auch sei, während des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung herrschten Könige, deren Namen überliefert sind, in einer sich gewaltig verändernden Stadt, wovon heute eine ununterbrochene Flut archäologischer Neuentdeckungen zeugt. In diesem Crescendo sind zwei Phasen recht deutlich voneinander zu unterscheiden: Die erste reicht vom letzten Drittel des siebten Jahrhunderts v. Chr. bis in die 580er-Jahre, ermöglichte die Konsolidierung des Erreichten und bereitete das Kommende vor. Die zweite Etappe, die sich bis ans Ende des Jahrhunderts erstreckte, war von einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Beschleunigung gekennzeichnet, deren Rhythmus sich ab den 550er–530er-Jahren unaufhaltsam steigerte. Am Ausgang dieses von ungewöhnlich intensivem Wachstum geprägten Jahrhunderts war Rom von Grund auf verändert, befestigt und vergrößert und beanspruchte nicht nur auf regionaler Ebene, sondern auch international eine bedeutende Rolle.
Mythos und Realität auf dem Forum
Wenn die Tarquinier auch nicht die Erschaffer des Forums waren, wie man lange glaubte, so bedeutet das nicht, dass sie das Interesse an jenem Gelände verloren hätten, das für die Stadt zum Schauplatz der Macht und Konvergenzpunkt des öffentlichen Dialogs geworden war. Um das Jahr 600 vor unserer Zeitrechnung wurde die Mauer, die an seinem Rand verlief und seit der Gründung den Palatin umschloss, zum dritten Mal erneuert:7 Statt der früheren Konstruktion erhob sich nun exakt über dem alten Verlauf eine Mauer aus regelmäßig behauenen Blöcken mit einem Lehmziegelaufbau. Den breiten Graben vor der Mauer hatte man zugeschüttet, als habe die Grenze jede Verteidigungsfunktion verloren und sei allein noch symbolischer, also sakraler und erinnerungskultureller Natur. Weiter unten verschwamm die Erinnerung an jene Zeit, als das Tal eine Begräbnisstätte gewesen war, und ging allmählich in das Reich des Mythos über. So verorteten die Römer am Fuß des Kapitols nun die Gräber von Gefährten des Romulus, gar des berühmten Orestes! Und unmittelbar daneben kommunizierte die Stadt über die rituelle, kosmische Grube des Mundus in bestimmten Abständen mit der Totenwelt.8 Solche Überlieferungen und Kulte wurden sicherlich durch die Auffindung sterblicher Überreste begünstigt, die schon bei den geringsten Bauarbeiten in diesem Bereich ans Tageslicht kamen.9 Es ist leicht nachzuvollziehen, dass dort chthonische Gottheiten wie Dis und Proserpina oder Saturn verehrt wurden,10 ganz zu schweigen von Vulcanus, der womöglich schon seit jener Zeit auf dem Areal präsent war, als dort noch die Scheiterhaufen brannten. Dieser Kontext rückt auch das berühmte Wunder des Auguren Attus Navius, das schon die Römer selbst vor ein Rätsel stellte, in ein neues Licht: Herausgefordert durch König Tarquinius in einer Auseinandersetzung um Reformen, sei es diesem angeblich gelungen, durch einen Hieb mit einem Rasiermesser einen Stein zu zerteilen, was ihm ein Standbild auf dem Comitium einbrachte. Nun entsprechen die Bestandteile dieses Wunders – Wetzstein und Rasiermesser – aber typischen Grabbeigaben der ersten latialen Phasen,11 und im nunmehr zum öffentlichen Raum gewordenen Totental wurden zahlreiche Erdarbeiten durchgeführt, bei denen solche Überreste zum Vorschein kamen.
In der Nähe des Vestatempels etwa wurde zu Beginn des sechsten Jahrhunderts an einer der ersten Straßen in diesem Areal ein Ende des vorangegangenen Jahrhunderts errichtetes Gebäude mit länglichem Innenhof grundlegend umgebaut. Der Hof erhielt einen quadratischen Grundriss, und hatten sich zuvor an der Westseite zwei Räume befunden, so war nun auf beiden Hausseiten je ein Raum zu finden. Bis zur Entdeckung des großen Wohnhauses unmittelbar neben dem Heiligtum der Vesta hielt man dieses kleine Gebäude für die Domus Regia, den Königlichen Palast von Rom, und unter diesem Namen ging es auch in die Forschungsliteratur ein.12 Allerdings handelte es sich nicht um die Residenz des Königs, dafür war es viel zu klein, sondern um das königliche Heiligtum, jene Kultstätte, die später auf die Republik übergehen sollte. Und die beiden Räume, die sich im Verlauf der zahlreichen Umgestaltungen des Gebäudes immer wieder finden lassen, waren Kapellen, eine für den Gott Mars und eine für die Göttin des Überflusses, Ops, in denen der König als oberster Priester den Kult zelebrierte: Als militärischer Oberbefehlshaber und Garant guter Ernten sicherte der Herrscher auf diese Weise im Zentrum des öffentlichen Raums die Wahrung fundamentaler Interessen der Gemeinschaft. Warum aber hatte man die beiden Kulte aus dem königlichen Palast auf der gegenüberliegenden Straßenseite herausgelöst, wo sie bis dahin begangen worden waren? Möglicherweise, um ihnen eine größere Öffentlichkeit zu verschaffen, was erklären würde, weshalb die Eingangstüren des Gebäudes in seiner zweiten baulichen Ausprägung an der Via Sacra lagen, der damals fraglos wichtigsten römischen Durchgangsstraße. Andererseits war dies die Zeit, in der die Könige, ohne im eigentlichen Sinne Etrusker zu sein, nicht mehr aus den Reihen des latinischen Adels gewählt wurden, folglich waren sie nicht mehr so vertraut mit der Religion der Ahnen und genossen zweifellos auch nicht mehr dieselben Vorrechte. Oder aber sie wollten, angesichts ihrer immer zahlreicheren Aufgaben, insbesondere aufgrund der unablässig geführten Kriege, zumindest von einem Teil ihrer religiösen Pflichten entbunden werden, was bedeuten würde, dass schon während der Königszeit ein ‚Opferkönig‘ (Rex Sacrorum) existiert hätte.13 Denn für die republikanische Zeit ist ein Priester mit diesem Titel belegt, der die einstigen religiösen Funktionen des Herrschers übernahm. Doch so verführerisch diese Lösung auch klingen mag: Kann man wirklich davon ausgehen, dass ein König in diesem Rom des sechsten Jahrhunderts nicht auch, ja sogar in erster Linie, ein ‚König der sakralen Zeremonien‘ sein musste?
Erste Paläste
Wie dem auch sei, der königliche Palast samt Heiligtum auf der einen und das Comitium auf der anderen Seite bildeten nun die beiden Pole eines Forums, das in zunehmendem Maße die wichtigsten religiösen und bürgerlichen Wahrzeichen des öffentlichen Raums auf sich vereinte. Dort zu wohnen, bedeutete, in der Nähe des Königs und somit der Macht zu leben. Seit dem Beginn des Jahrhunderts standen in diesem Viertel Häuser, bei deren Bau, wenn auch noch recht unbeholfen, die jüngsten technischen Innovationen eingesetzt wurden. Im Bereich der alten Nekropole beim Tempel des Antoninus Pius und der Faustina – besser gesagt, im Bereich der Hütten, welche die alte Begräbnisstätte abgelöst hatten –, auf dem Caesarforum, aber auch auf der Velia und dem Palatin sind bei jüngeren Ausgrabungen wie schon bei weiter zurückliegenden die untersten Mauerschichten massiver Häuser zum Vorschein gekommen, deren Zahl in jener Zeit im Zentrum Roms rapide zunahm. Ihre Fundamente bestanden aus grob behauenen Tuffsteinblöcken, während die Wände aus Lehmziegeln oder Stampflehm gefertigt waren.14 Als Zeichen größten Luxus verfügten diese Häuser inzwischen über einen individuellen Trinkwasserzugang, entweder durch einen der zahlreichen Brunnen oder dank einer gleichmäßig runden Zisterne mit Wänden aus Tuffgestein. Wenn Letztere irgendwann nicht mehr genutzt wurden, füllte man sie mit den Trümmern der umstehenden Gebäude, und heute hilft uns die Analyse dieser Überreste, das Erscheinungsbild des archaischen Roms zu rekonstruieren. So wurden in einem 1988 unter dem Victoriatempel auf dem Palatin entdeckten derartigen Schacht Zehntausende Tonscherben gefunden,15 von denen ein Gutteil aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr. stammt und die ein ganzes Viertel aus reichen Wohnhäusern wieder auferstehen lassen: ziegelgedeckte Dächer, mit geschmückten Platten verkleidete Kranzgesimse und mit einem schützenden Putz versehene Innenwände … Natürlich waren Häuser dieses neuen Typs noch nicht sehr zahlreich, aber ihr vereinzeltes Auftauchen inmitten jener traditionellen Hütten, in denen die große Mehrheit der Römer immer noch lebte, war ein Zeichen für die tiefgreifenden Veränderungen, die inzwischen eingesetzt hatten und eines nicht mehr fernen Tages in eine vollständige Verwandlung der Stadt der drei Tribus und dreißig Kurien münden sollten.
Das Oktoberpferd
Die Vitalität, die Rom bereits zu diesem Zeitpunkt ausmachte, zeigte sich in einem berühmten Ritual, dem sogenannten Oktoberpferd (Equus October).16 Durch den religiösen Konservatismus der Römer über Jahrhunderte hinweg bewahrt, sorgte es für Verwunderung bei Griechen wie Timaios von Tauromenion und Plutarch, die es mit dem Mythos des Trojanischen Pferdes zu erklären suchten, und erregte die Neugier von Gelehrten aus der Zeit des Kaiserreichs. Diese antiken Schilderungen führten in der modernen Forschung zu einer regen theologischen Debatte, bei der zuweilen die genuin räumliche und urbane Dimension dieser höchst seltsamen Zeremonie aus dem Blick geriet. Doch worum handelte es sich überhaupt? An jedem 15. Oktober wurde auf dem Marsfeld ein Wagenrennen veranstaltet. Dabei wurde der Wagen nicht von zwei Pferden gezogen, wie es in der klassischen Zeit die Regel sein würde, sondern von einem Dreigespann (triga), weshalb auch die Rennstrecke am Tiberufer Trigarium hieß. Das rechte Pferd des siegreichen Gespanns wurde anschließend durch einen Speerwurf getötet. Dann schnitt man ihm den Schweif ab und brachte diesen noch blutend auf den Altar der Regia, während die Anwohner der Via Sacra und die Bewohner der Subura sich einen Kampf um den Kopf des Tieres lieferten. Wenn Erstere gewannen, hängten sie ihn an die Mauer der Regia, Letztere hingegen an die eines Turms in ihrem Viertel, und in beiden Fällen wurde der Kopf „zum Dank für den reichen Ausgang der vergangenen Ernte“ mit Broten bekränzt. Ein eigentümliches, aus ferner indoeuropäischer Vergangenheit stammendes und mit dem vedischen Ashvamedha verwandtes Ritual, das zwar nicht einem agrarischen Mars, aber zumindest dem Mars als Beschützer der Ernten geweiht war, der sowohl zu Beginn wie auch am Ende präsent war. Und so ergibt alles einen Sinn: Zunächst das Datum, das den Abschluss der zweiten, im Juli beginnenden Zeit der Feldzüge markiert, und auch die Schauplätze, denn in jener Zeit war das Marsfeld, wenigstens zum Teil, ebenso im Besitz des Königs wie die Regia auf dem Forum. Das Ritual verband also die Peripherie der Stadt mit ihrem Zentrum und endete mit einem Kampf der jeweiligen Einwohner gegeneinander: eine gleichermaßen reale wie simulierte Konfrontation, bei der beide Lager die Erinnerung an jene Zeiten aufleben ließen, in denen sie unterschiedlichen Gemeinschaften angehört hatten, während in diesem Spiel, dessen Regeln sie sich alle unterwarfen, gleichzeitig ihr Bewusstsein dafür gestärkt wurde, nun Teil eines einheitlichen Ganzen, der Urbs, zu sein. Das Wagenrennen auf dem Marsfeld, der Lauf des Mannes, der mit dem blutigen Bündel zur Regia rannte und der erbitterte Kampf zwischen den beiden Gruppen aus verschiedenen Stadtvierteln – dies alles wurde von zahllosen Zuschauern mit lautstarken Anfeuerungsrufen und der gleichen leidenschaftlichen Spannung verfolgt, von der ab den 1650er-Jahren auch der Palio in Siena geprägt sein würde. Und sollte nicht, noch später, doch fast an derselben Stelle wie das Oktoberpferd, das Rennen der reiterlosen Pferde, die, gesäumt von einer erregten Menschenmenge, zum Karneval in der Via del Corso auf den Weg geschickt wurden, zu einem der beliebtesten Feste des päpstlichen Roms werden? In der archaischen Stadt wurde im Rahmen der Opferung jenes Tieres, das wie kein zweites für den Krieg stand, ein letztes Mal vor dem nahenden Winter der Rausch der Geschwindigkeit, des Kampfes und des Blutes entfesselt. Wenn die beiden Extremitäten des geopferten Pferdes letztlich in der Regia endeten, war dies ein Garant für die Siege des Königs und den Wohlstand der gesamten Stadt. Somit war der urbane Raum nicht nur Schauplatz des Rituals, sondern lieferte gleichermaßen die Symbolik wie den Gegenstand.
Symbolik der Macht
Zweifellos in jener Zeit – um 580–570 v. Chr. – wurde die Regia ein drittes Mal neu aufgebaut, und wieder lag ihr Eingang an der Via Sacra. Dieser Neubau folgte auf einen verheerenden Brand, der zugleich auch das gesamte Heiligtum der Vesta zerstört zu haben scheint.17 Handelte es sich bei dieser Katastrophe lediglich um einen Zufall? Oder sollte man darin eine Spur jener Unruhen sehen, die, einer genauen Lektüre der antiken Überlieferungen zufolge, die Machtergreifung von König Servius Tullius begleiteten und ermöglichten, welche das kollektive Gedächtnis der Römer in das Jahr 578 vor unserer Zeitrechnung datierte? Was auch immer der Grund gewesen sein mag, Fakt ist, dass das Gebäude sein Aussehen veränderte. Die äußeren Enden des Firstbalkens und das Kranzgesims wurden mit Terrakottaplatten verkleidet, die eigenartige Motive zeigten.18 So erblickte man dort insbesondere eine menschliche Gestalt mit Stierkopf, die zwischen Katzen tanzt, und einen Vogel, offenbar ein Kranich. Auf diese Weise also sah sich der Mann, der in diesem Palast opferte, und auf diese Weise wollte er gesehen werden: als neuer Bezwinger des Minotaurus, erfahren in sakralen Tänzen und listenreich, wie es Theseus, der Eroberer der königlichen Macht und der Einiger seines Landes, in Athen gewesen war.
Erste Tempel
Denn in einer sich schnell verändernden und von immer stärkeren sozialen Spannungen heimgesuchten Stadt stand die Macht nun jedem offen, der sie wollte und sie zu ergreifen in der Lage war. Aus dem Nahen Osten war über Zypern eine ganze Ideologie und Bildersprache rund um Götter, die den Menschen Macht und Reichtum verleihen, nach Rom gelangt, wo sie von den neuen Herren der Stadt weiterentwickelt wurde. Dieses Phänomen zeigte sich vor allem am Flussufer, im Bereich des ehemaligen Viehmarkts (Forum Boarium), der inzwischen zum Hafen geworden war. Schon lange legten dort Schiffe an, die vom Meer her den Fluss heraufgerudert oder getreidelt worden waren. Ihnen entstiegen Seeleute unterschiedlicher Herkunft – Phönizier, Griechen und Etrusker –, die zusammen mit ihren exotischen Waren auch alle möglichen Vorstellungen und Religionen aus Übersee in die junge Stadt brachten. Dieser Ort, wo Wasser und Land aufeinandertrafen, lag außerhalb des Stadtzentrums, gleichsam am Rand der bürgerlichen Gesellschaft. Das erleichterte den Austausch mit der äußeren Welt, der unter dem Schutz eines Kultplatzes stand, einer in der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts umfriedeten Fläche unter freiem Himmel. Nun war die Zeit gekommen, den Bereich mit einer aufwendigeren Konstruktion zu versehen, die für jeden sichtbar den göttlichen Schutz jenes Areals sicherte, an dem immer mehr fremde Seeleute, Händler und Handwerker eintrafen. Am Rand des Velabrums bildete der Fuß des Tarpejischen Berges eine Art natürlichen Vorsprung, auf dem ein Sakralbau errichtet wurde, nahe bei einem alten, der Göttin der Weissagung und der Geburten (Carmenta) geweihten Ort. Das kollektive Gedächtnis der Römer, dessen Überlieferungen ihren Niederschlag in den Schriften des Titus Livius fanden, sollte von Zwillingstempeln sprechen, der eine der Göttin der Morgenröte geweiht, der andere der Göttin des Schicksals oder – wie ihre lateinischen Namen lauteten – der Mater Matuta und der Fortuna.19 Allerdings konnte bei den im Laufe des 20. Jahrhunderts in diesem Bereich mehrmals durchgeführten und auch in jüngerer Zeit wieder aufgenommenen Grabungen bislang nur ein archaischer Tempel identifiziert werden.
Aurora
Handelt es sich nun bei diesem wiedergefundenen Tempel um jenen der Mater Matuta, der Göttin der Morgenröte? Jedenfalls war es ein Gebäude mit einem nahezu quadratischen Grundriss von etwa zehn Metern Seitenlänge, das auf einem etwa zwei Meter dicken aufgeschütteten Sockel stand. Seine nach Südosten gerichtete und mit zwei Säulen geschmückte Fassade wies einen mit Terrakottafiguren verzierten Giebel auf: zwei Panther, die eine Gorgone einrahmten. Auf dem Dach hielten zwei geflügelte Sphingen Wache, während der First mit zwei einander zugewandten Spornen geschmückt war. So wurde die Herrschaft der Gottheit über diese heilige Stätte vor aller Augen deutlich gemacht. Vorbei waren die Zeiten der kleinen Heiligtümer, die bislang kaum mehr gewesen waren als bessere Hütten, wenn nicht gar simple Kultplätze unter freiem Himmel! Das Podium, auf dem sich der neue Bau erhob, erinnerte an die Begrenzungszeremonie, mit der die Auguren diesen Bereich römischen Bodens der Göttin geweiht hatten, und verlieh ihr dauerhaften Bestand. Die Säulen, der aufsteigende Giebel, die Statuen auf dem Dach, all das lenkte den Blick zum Himmel, dem Wohnsitz der unsterblichen Götter. Was die Römer an diesem Beginn des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung dort zum ersten Mal erblickten, war ein Tempel, ein Gebäudetypus, der von nun an und bis zum Schluss die Geschichte ihrer Stadt begleiten und deren Antlitz entscheidend verändern sollte. Wie dieser Tempel dort dem Hafen gegenüberstand, war er das Ergebnis vielfältiger Einflüsse und veranschaulichte den veritablen kulturellen Kosmopolitismus der aufstrebenden Stadt. Während das Podium das latinische Ritual der Inauguration widerspiegelte, war die innere Aufteilung etruskischen Ursprungs, wohingegen die Portikus und der Giebel auf direktem Weg aus jenem Griechenland kamen, dem auch der Vater von König Tarquinius entstammte. Wie es während des gesamten Bestehens der Urbs der Fall sein sollte, nahm Rom von überallher Einflüsse auf und machte sich die Errungenschaften anderer zu eigen. Geschaffen aus der Verbindung von Elementen unterschiedlicher Herkunft, zeugte der römische Tempel unübersehbar von seiner religiösen Bestimmung und trug, im Rahmen der technischen Möglichkeiten seiner Zeit, äußerst wirkungsvoll zu einer Monumentalisierung des urbanen Raums bei.
Entweder die unmittelbar an den Tempel angrenzende Kultfläche unter freiem Himmel oder das Heiligtum selbst waren möglicherweise Schauplatz der seltsamen Riten, die jedes Jahr am 11. Juni von den Matronen der Stadt begangen wurden.20 An diesem Tag, dem sogenannten Matralia-Fest, holten die Frauen zunächst eine Sklavin in ihre Mitte, bevor sie diese gleich darauf mit Schlägen wieder fortjagten. Danach wiegten sie unter zahlreichen Zuneigungsbekundungen einen Säugling aus den Reihen ihrer Neffen und Nichten. Diese Rituale, die antike Autoren beschrieben, ohne sie zu verstehen, stellten aus ferner indoeuropäischen Vergangenheit überlieferte Mythen nach: Dabei nahmen die römischen Matronen die Rolle der Morgenröte (Aurora) ein, welche die Dunkelheit vertreibt und sich des Kindes ihrer Schwester annimmt. Diese Schwester ist die Nacht und ihr Kind die Sonne. Jedes Jahr kurz vor der Sommersonnenwende wiederholte sich diese eigentümliche Zeremonie, obwohl ihre Bedeutung schon bald in Vergessenheit geriet, da die Göttin Aurora in dieser Zeit bereits mit der griechischen Göttin Leukothea gleichgesetzt wurde.
Der Hafengott
Am Flussufer empfing inzwischen eine weitere Kultstätte Besucher, die von Bord der Schiffe kamen. Sie war Portunus geweiht, dem Gott des Hafens, jenes Tores der Stadt zur Außenwelt, ihrer Verbindung zum offenen Meer. In der klassischen Epoche, in der die globalisierte Urbs über ganz andere, weiter reichende Kontakte in die Ferne verfügte, sollte dieser Gott nur noch eine untergeordnete Rolle im religiösen Pantheon spielen. In der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung jedoch wurde er nicht nur durch ein offizielles Fest geehrt, die jedes Jahr am 17. August stattfindenden Portunalia, sondern verfügte auch über einen eigenen, angesehenen Priester (Flamen Portunalis), beides Zeichen dafür, welche Bedeutung die Römer damals ihrem Zugang zum Tiber und dem Hafen beimaßen.21
So schützten diese Heiligtümer den Austausch, den Handel und die Begegnungen in diesem regelrechten Freihafen am Ufer des Tibers, über den bereits seit einem Jahrhundert Einflüsse aus dem Orient, viele davon mit einem Umweg über Zypern, nach Rom gelangten. Daher erkennt die moderne Forschung in Fortuna, der Schicksalsgöttin, die kühnen Herrschern ebenso wohlgesinnt ist wie furchtlosen Seefahrern, auch die große Göttin Astarte oder Ištar wieder. König Servius Tullius, der allein aufgrund seiner Verdienste an die Herrschaft gelangt war, hegte eine besondere Vorliebe für diese Göttin, die jenem Sterblichen Macht bescherte, der ihr zu gefallen wusste: Abgesehen von dem Heiligtum am Fluss sollte er ihr über das gesamte Stadtgebiet verteilt noch ein knappes Dutzend weiterer Kultstätten errichten.
Diana auf dem Aventin
Eine andere Göttin, Diana, ehrte der König auf dem über dem Viehmarkt (Forum Boarium) aufragenden Aventin, und erbaute ihr dort, wahrscheinlich an der direkt über dem Hafen gelegenen Nordspitze des Hügels, einen Tempel.22 Von Anbeginn ihrer Geschichte in der Region hatten die Latiner diese Göttin, die Herrin des nächtlichen Lichtes und der Wälder, verehrt. Sie besaß ein uraltes Heiligtum am Ufer des heiligen Nemisees – aktuelle Ausgrabungen erlauben inzwischen eine Datierung seiner ersten Ursprünge in das zwölfte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung –, dessen Priester ein entflohener Sklave sein musste, der seinen Vorgänger getötet hatte.23 Indem die Stadt am Tiber nun ihrerseits einen dieser Göttin geweihten Tempel errichtete, beabsichtigte sie, das Prestige des alten föderalen Kultes auf sich zu übertragen. Strategisch geschickt platzierte sie die neue Kultstätte auf jenem Hügel gegenüber dem Palatin, wo bereits die Einwohner verschiedener eroberter Dörfer zwangsangesiedelt worden waren und an dessen Fuß die Straße aus den Albaner Bergen, aus dem Herzen des alten Latinerlandes, endete. Damit diese sich auf dem römischen Hügel zu Hause fühlten, redete man ihnen ein, dort sei ein früherer König von Alba Longa begraben.24 Um seinem neuen Heiligtum jedoch nicht nur regionale, sondern ‚internationale‘ Strahlkraft zu verleihen, erklärte es der römische Machthaber zum Asyl: Jeder Fremde, der sich mit seiner eigenen Gemeinschaft überworfen hatte, jeder entflohene Sklave sollte dort auf dem Aventin Zuflucht finden. Damit griff man erneut zu einer Methode, die bereits zwei Jahrhunderte zuvor so wunderbar funktioniert hatte, als die junge Stadt beschloss, auf dem Tarpejischen Berg all jene aufzunehmen, die sich ihr anschließen wollten – selbst Straßenräuber und Abenteurer. Auf diese Weise lockte das immer noch waldreiche Plateau des Aventins rasch Bewohner an, deren Präsenz die Kontrolle der Stadt über den Fluss sicherte. Dank dieses Zugangs zum Meer blickte Rom bereits weit über seine regionalen Grenzen hinaus und öffnete sich Einflüssen, die von weit, teils sogar von sehr weit herkamen. Denn aus dem Osten strömte unablässig Neues heran, seit die persischen Heere die griechischen Städte Ioniens erobert hatten. Im Zuge des darauf folgenden Exodus gen Westen gelangten viele Handwerker mit ihren Schiffen an die tyrrhenischen und latinischen Küsten, was erklärt, weshalb die Statue der Göttin im neuen römischen Dianatempel nach dem Vorbild des Standbilds im großen Heiligtum der Artemis in Ephesos gefertigt wurde, jener heiligen, 546 v. Chr. im Sturm eingenommenen Stadt.25 Indem die Urbs dieses Modell – möglicherweise nach dem Beispiel Marseilles, deren phokäische Gründer die Stadt etwa zur selben Zeit mit einem ähnlichen Heiligtum ausstatteten –, übernahm, unterstrich sie ihre Ambitionen, eine maßgebliche Rolle in den internationalen, also mediterranen, Beziehungen jener Zeit einzunehmen. Und wie damals üblich fand dieses politische Projekt seinen Ausdruck in der Sprache der Religion.
Wie der Eichenberg zum Caelius wurde
Etwa zur selben Zeit erhielt der alte Eichenberg (Querquetulanus Mons) jenseits der Via Latina und des Palatins den Namen Caelius. Diese neue Bezeichnung verdankte er einem gewissen Caeles Vibenna, der mit einer ganzen Armee dort Quartier bezogen hatte, woran man sich sowohl in Rom als auch in Etrurien noch lange erinnern sollte. Dieser Kriegsherr stammte ursprünglich aus Vulci und hatte sich mit seiner ‚großen Schar‘ in Begleitung seines Bruders Aulus auf den Weg nach Rom gemacht, um dort sein Glück zu suchen.26 Lange hat sich die moderne Forschung geweigert, den antiken Überlieferungen Glauben zu schenken, die den Namen des Hügels mit jenem Caeles in Verbindung brachten. Eine simple etymologische Spielerei, hieß es, die nicht das Geringste beweise! Doch dann wurde bei Ausgrabungen ganz in der Nähe von Veji eine Trinkschale gefunden, eine mit dem Namen Aulus Vibenna versehene Weihgabe, was auch dessen Bruder, laut Überlieferung niemand anders als Caeles, wieder in den Vordergrund rückte. Und sind die beiden nicht zudem gemeinsam auf den Wandfresken eines der berühmtesten etruskischen Gräber, der Tomba François in ebenjenem Vulci, abgebildet? Und dafür, dass ein Ort den Namen eines seiner Bewohner annehmen kann, gibt es genügend Beispiele, um diese Hypothese nicht von vornherein zu verwerfen. Schon der Oppius und der Cispius sollten ihren Namen Kriegsherren aus Latium verdanken, die ein Jahrhundert zuvor mit ihren Truppen dort das Lager aufgeschlagen hatten. Ein letztes Problem stellte die Tatsache dar, dass Servius Tullius in der antiken Überlieferung als Waffengefährte des Caeles und Befehlshaber der Armee dargestellt wurde und zwar mit dem Beinamen Mastarna, nach einem etruskischen Wort, in dem das Echo des lateinischen magister zu erkennen ist. Doch wenn Servius wirklich Oberbefehlshaber war, wie hätte er dann gleichzeitig Caeles unterstellt sein und einen der Hügel jener Stadt, deren König er wurde, nach ihm benennen können? In Wirklichkeit jedoch war Mastarna nicht der eigentliche General der Armee, sondern dessen wichtigster Stellvertreter – ein Abhängigkeitsverhältnis, welches das Suffix des etruskischen Beinamens ausdrückt. Und so wird verständlich, was geschehen sein könnte: Die Brüder Vibenna und ihr brillanter Stellvertreter kamen mit einer Streitmacht aus Vulpi und wählten als Stützpunkt den Eichenberg, von wo aus sie die große Kreuzung kontrollierten, die über die Velia Zugang zum Forum und zum Tarpejischen Berg bot. Vielleicht waren sie ursprünglich von dem Tarquinier gerufen worden, der zu dieser Zeit in Rom regierte. Doch nun beabsichtigten sie, die Herrschaft über die gesamte Stadt zu erringen und sie der herrschenden Dynastie zu entreißen, die sich womöglich gerade in einer Krise befand. Aus einem unbekannten Grund starb Caeles, und es kam zur Konfrontation zwischen Aulus und Mastarna. Offenbar besetzte Aulus daraufhin mit dem Kontingent, das ihm treu geblieben war, den Tarpejischen Berg, doch schon bald wurde er von dort wieder vertrieben, und Mastarna herrschte fortan unter dem Namen Servius Tullius allein über Rom. Servius wie der Servus, der er lange gewesen war, doch nicht etwa als Sklave, wie man später glaubte, sondern als Untergebener des Caeles. Damit dessen Name auf den Caelius übergehen konnte, muss er sich im Übrigen sehr lange dort aufgehalten haben, und wenn nicht sein Bruder Aulus, so war vielleicht er der geheimnisvolle achte König, von dessen Existenz die Römer zur Zeit der Republik noch wussten, ohne seinen Namen zu kennen.
Die Stadt reformieren
Wie man sieht, benötigte Servius Tullius sehr viel Glück, um an die Macht zu gelangen, was seine besondere Verehrung der Göttin Fortuna erklärt! Um diese Macht zu halten, konnte er, der fremde condottiere, nicht auf die Unterstützung der großen lokalen Familien und ihrer Klans vertrauen. Stattdessen musste er in dieser unaufhörlich wachsenden, zu Unruhen neigenden Stadt einen Weg finden, den Einfluss der traditionellen Aristokratie und ihrer jeweiligen Klientel zu beschränken. Und genau das war das Ziel der großen Reform, mit der er die institutionellen Strukturen der Stadt nachhaltig veränderte und sie mit Integrationsmöglichkeiten versah, die ihrem unaufhaltsamen Aufschwung entsprachen.27 Als Ersatz für die drei, inzwischen übervölkerten und unorganisierten, romuleischen Tribus schuf er vier neue ‚Tribus‘, deren alte Bezeichnung beibehalten wurde, weil der ursprüngliche Bezug zur Zahl Drei in Vergessenheit geraten war: Suburana, Esquilina, Collina und Palatina, mit anderen Worten die Bezirke der Subura, des Esquilins, des Quirinals und des Palatins. Die Namen der Verwaltungseinheiten entsprachen also den wichtigsten Zonen der Stadt. Dem alten, auf den Verbindungen der Abstammung gründenden Ordnungssystem folgte nun eine neue Aufteilung, deren wesentliches Kriterium die räumliche Zugehörigkeit war. Von nun an wurden die Römer nicht mehr über ihre ethnische Herkunft oder den adligen Klan definiert, zu deren Gefolgschaft sie gehörten, sondern schlicht über ihren Wohnort in der Stadt. Allerdings wurde diese Zuordnung durch Umzüge und die Mobilität der Menschen mit der Zeit genauso artifiziell wie das vorherige System,28 und irgendwann gehörte man nicht mehr wegen seines Wohnsitzes dieser oder jener Tribus an, sondern erneut aufgrund von Geburt und familiären Verbindungen. Doch zunächst einmal sprengte die Reform für mindestens ein bis zwei Generationen das Korsett von erblichen Privilegien und Klientelismus.
Dass in den erhaltenen Aufzählungen der Tribus die Subura den ersten und der Palatin den zweiten oder gar vierten Platz in der Liste einnehmen, ist bezeichnend: Dem alten latinischen Adel, der sich auf dem Palatin konzentrierte, wurde ein untergeordneter Rang zugewiesen, während die zunehmend bevölkerte Subura in den Vordergrund rückte. Damit deckte die neue Ordnung den gesamten besiedelten Raum ab: Die Suburana umfasste den Bereich der sogenannten Carinae und den Caelius, die Esquilina erstreckte sich über Oppius und Cispuis, während die Collina neben dem Quirinal auch den Viminal umfasste und die Palatina aus Palatin und Velia bestand. Um das neue Wohnviertel auf dem Esquilin zu fördern, ließ sich auch König Servius Tullius dort nieder und gab den Palast an der Via Sacra auf. Nach seinem Tod soll man ihm in der Nähe seines Wohnsitzes ein Grabdenkmal errichtet haben, dessen man sich noch sehr lange erinnerte.29 Die gemeinschaftlichen Bereiche der Stadt – das Forum, der Tarpeius Mons mit der Burg, wo die Auguren ihr Amt ausübten, das Velabrum und der Hafen sowie der Aventin mit dem der Diana geweihten Bundestempel – blieben außerhalb dieser Flächenaufteilung, die dazu bestimmt war, eine unaufhaltsam wachsende Bevölkerung bestmöglich aufzunehmen und zu verteilen. Der übrige städtische Siedlungsraum jedoch hatte inzwischen eine derartige Geschlossenheit erreicht, dass er in gleich große Bezirke aufgeteilt werden konnte. Die Hügel am Tiber waren nun nicht mehr nur räumliche Gegebenheiten, sondern wandelten sich zum institutionellen Rahmen einer künftigen Entwicklung der Bürgerschaft. Dies umso mehr, als die Reform von einem gewaltigen, mittlerweile durch archäologische Funde belegten demografischen Zusammenschluss begleitet wurde. In einem Umkreis von gut zehn Kilometern wurden die mit Rom konkurrierenden Orte entvölkert und ihre Einwohner aufgefordert, sich in der Stadt anzusiedeln. Zwar bestellten sie auch weiterhin ihr Land – dessen Fläche im Allgemeinen einen Hektar nicht überstieg –, aber ihr Hauptwohnsitz lag von nun an auf dem Gebiet einer der neu geschaffenen städtischen Tribus. In dieser Phase wurde auch das Umland endgültig römisch: Es war nicht verlassen, sondern mit einer Vielzahl kleiner Bauernhöfe und Fachwerkhütten übersät, in deren Verteilung heutige Archäologen die wirtschaftliche und politische Herrschaft der Urbs erkennen.30 Bislang war Letztere für ihre Einwohner oder vorübergehende Besucher eine konkret wahrnehmbare, bekannte Größe gewesen, nun jedoch hatte sie auch eine geistige Dimension, die in Zukunft alles zu ermöglichen schien.
Die Prozession der Argei
Ein in jener Zeit eingeführtes spektakuläres Ritual veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise, wie homogen und wie groß der städtische Raum inzwischen war. Zwei Mal pro Jahr, am 16. und 17. März und dann noch einmal am 15. Mai, zog eine besonders feierliche Prozession durch die ganze Stadt. An diesen Tagen ‚ging man zu den Argei‘ (itur ad argeos).31 Was war damit gemeint? Zunächst einmal bezeichnete dieser Name 27 Kultstätten (Sacraria), die über das gesamte Gebiet der vier servianischen Tribus verteilt waren. Eine kleine Fläche unter freiem Himmel mit einem Boden aus gestampfter Erde oder grobem Pflaster und in der Mitte ein großer, als Altar dienender Stein, so sahen diese kleinen, den örtlichen Gottheiten geweihten Heiligtümer aus. Zwei Mal zogen die Vestalinnen, die Priester und mit ihnen die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt in einer Prozession von Sacrarium zu Sacrarium. Der Umzug begann auf dem Caelius, passierte über Oppius und Cispius den Esquilin, setzte sich über die verschiedenen Anhöhen des Quirinals fort, bis er schließlich beim Palatin und der Velia anlangte. Was bezweckte man mit diesem Abschreiten der gesamten Stadt und sogar mehrerer ihrer Hügel? Erinnerte diese doppelte Feier, wie einige antike Autoren vermuteten, an die Opferung von 27 aus Argos stammenden Griechen? Selbst in Anbetracht der Grausamkeit jener archaischen Zeiten erscheint eine solch hohe Zahl von Menschenopfern bei einem einzigen Ritual wenig wahrscheinlich! Und es erklärt auch nicht die Wiederholung der Prozession. Sinnvoller ist es, den Blick auf das Ritual selbst zu richten, denn dann erkennt man, dass die Vestalinnen im März an allen 27 Kapellen große aus Binsenstroh gefertigte, menschenähnliche Puppen deponierten, die ebenfalls Argei genannt wurden. Im Mai wurden diese im Rahmen einer großen, dem gleichen Weg folgenden Prozession wieder eingesammelt, woraufhin sich der Zug dem Velabrum und dem Pons Sublicius zuwandte, von wo aus die heiligen Jungfrauen die Puppen in den Tiber warfen. Diese merkwürdige Geste, mit der die Zeremonie endete, erhellt auch gleichzeitig deren Bedeutung. Denn was hier in der Symbolsprache des Ritus inszeniert wurde, war die große Reinigung der gesamten Stadt. Die Niederlegung der Puppen im März, zu Beginn des erneuernden Frühlings, diente gewissermaßen dazu, die im Laufe des vergangenen Jahres durch die Bürgerschaft angesammelten Unreinheiten aufzunehmen. Im Mai brauchte man die Behältnisse dann nur noch abzuholen und sie mitsamt ihrem vermeintlichen Inhalt im reinigenden Wasser erst des Flusses und danach des Meeres zu entsorgen. Dies erklärt nicht nur die Verteilung der Kapellen über das gesamte Gebiet der von König Servius geschaffenen Bezirke, sondern auch ihre Anzahl, wenngleich das Missverhältnis zwischen 27 – Anzahl der Kapellen – und vier – Anzahl der Tribus – darauf schließen lässt, dass möglicherweise einige ältere Kultstätten in das Ritual einbezogen wurden. Doch auf ihrem Weg von der Suburana zur Palatina entsprach die Prozession exakt der servianischen Raumaufteilung, mit der sie untrennbar verbunden war.32 Weit über das romuleische Stadtgebiet hinausgehend, folgte sie oft genau den Grenzen jener Stadt im sechsten Jahrhundert, die sie auf magische Weise reinigen sollte. So gewährleistete das Ritual auf öffentlicher Ebene die Beseitigung aller Verunreinigungen und unheilvollen Einflüsse durch die Toten des vergangenen Jahres, was im privaten Familienrahmen bereits am Abend zuvor bei den Lemuria, dem Fest der Totengeister, durch die Hausväter erfolgt war. Doch zwei Jahrhunderte nach den Lupercalia betraf die große kollektive Reinigung weniger die menschliche Gemeinschaft an sich, als vielmehr die Orte, an denen diese lebte, jenen städtischen Raum, der mittlerweile in seiner gesamten Ausdehnung sakralen Charakter genoss. Die Heiligtümer der Argei waren zudem nicht die einzigen: An allen Kreuzpunkten (Compitum) gab es einen Altar, an dem die Anrainer täglich die örtlichen Schutzgottheiten (Lares) verehrten. Und so beschloss die königliche Zentralgewalt, dass dort einmal im Jahr eine große allgemeine Feier begangen werden sollte: In diesem ‚Fest der Kreuzungen‘ (Compitalia) manifestierte sich ungeachtet der Vielfalt ihrer einzelnen Viertel die Einheit der Stadt.
Versammlungen auf dem Marsfeld
Die Inbesitznahme des städtischen und des umliegenden ländlichen Raums durch die Einrichtung eines engmaschigen Netzes kleiner Kultstätten spiegelte eine vollständige Neuordnung der Bürgerschaft wider. Servius Tullius veränderte sowohl die Versammlungsorte und -modalitäten der römischen Bevölkerung als auch die Art und Weise ihrer Zählung und führte ein institutionelles System ein, das über Jahrhunderte hinweg Bestand haben sollte. Künftig sollten die Einwohner Roms nicht mehr auf dem alten, inzwischen für sie zu klein gewordenen Versammlungsplatz (Comitium) zusammenkommen, um ihrem König zuzuhören und die Entscheidungen gutzuheißen, die er gemeinsam mit dem Senat getroffen hatte, sondern in der großen Ebene jenseits der Hügel, die mit der Zeit zu ihrem Exerzierplatz geworden war, weshalb man ihr den Namen ‚Marsfeld‘ gegeben hatte. Außerhalb der Stadt und ihrer sakralen Grenze konnten sie dort Waffen tragen, ohne ein Sakrileg zu begehen.
Der Ort ihrer Zusammenkünfte war sorgfältig ausgewählt worden: in der Mitte der weitläufigen Fläche im Norden der Stadt, aber nicht zu weit von den Hügeln entfernt. Wie jedes gemeinschaftliche Ereignis erforderte auch eine Volksversammlung den Beistand der Götter. Sie konnte daher erst beginnen, nachdem derjenige, der ihr vorstand, also der König, ‚die Auspizien eingeholt‘ hatte, das heißt nachdem er die Vögel am Himmel über der Urbs beobachtet und die Zeichen Jupiters gedeutet hatte. Was wiederum nur von einem Podium aus geschehen konnte, auf dem der Herrscher stand und das den Status eines geweihten Bereichs genoss – so die ursprüngliche Bedeutung des Wortes templum.33 Die Auguren hingegen, die auf die Einholung der Auspizien spezialisierten Priester, stiegen eher auf die nächstgelegene Kuppe im südlichen Bereich des Quirinals, wo sich eine Plattform zur rituellen Vogelschau befand. Jenseits des Flusses legte man auf einer ähnlichen Vorrichtung auf dem Ianiculum einen Beobachtungsposten an, genau wie es zuvor auf der Burg des Tarpeius mons der Fall gewesen war, als die Comitia Curiata noch auf dem Comitium zusammentraten.34 Von der Kuppe des Ianiculums aus, der nunmehr den Übergang (ianus) zwischen der Stadt und dem Land der Etrusker bildete, überwachte man die von dort kommenden Straßen und mögliche nahende Feinde; zur anderen Seite hin reichte der Blick über die gesamte Stadt und die Ebene des Marsfelds im Vordergrund eines gewaltigen Panoramas, das am Horizont mit der bläulichen Barriere der Albaner Berge, dem Zentrum des alten Latinerbunds, endete. Um vor bösen Überraschungen sicher zu sein, versammelten sich die Römer erst dann in der Ebene, wie wir bereits gesehen haben, wenn der Wachtposten auf dem Ianiculum besetzt war und sie dort oben das rote Banner im Wind wehen sahen, Symbol einer Wachsamkeit, die dem Volk die Ausübung seiner höchsten Macht erlaubte.
Dieser neue Versammlungstypus erhielt den Namen Comitia Centuriata. Hatten die alten Kurien durch ihr Zusammentreten die Comitia Curiata gebildet, so war die Grundeinheit des neuen Systems die Zenturie, eine grundsätzlich aus hundert Männern bestehende Gruppe, wobei es tatsächlich häufig weniger waren. Insgesamt gab es 193 Zenturien, 18 davon waren den Rittern vorbehalten und fünf den Handwerkern, deren Zahl in einer Stadt, die sich zunehmend in eine riesige Baustelle verwandelte, beträchtlich war. Das oberste Ziel der Reform bestand somit darin, eine deutlich zahlreichere und heterogenere Bevölkerung in die Bürgerschaft einzugliedern, als es bei den ursprünglichen drei Tribus der frühen Stadt der Fall gewesen war. Zudem schufen in einer Welt, in der Kriege die Regel und Friedenszeiten die Ausnahme waren, die Realitäten des Kampfes Bindungen und Möglichkeiten, derer sich ein seinem Ursprung nach militärisches Regime wie die neue römische Monarchie zweifellos bewusst war. Doch konnte das, was durch Gewalt entstanden war, nicht durch Gewalt auch wieder zerstört werden? Auf den Schlachtfeldern standen sich die Kontrahenten mittlerweile in mächtigen, zahlenmäßig großen, kompakten und gut ausgestatteten Infanterieformationen gegenüber. Natürlich kannten und nutzten die etruskischen Fürsten und ihre Truppen die nach griechischem Vorbild bewaffnete Hoplitenphalanx bereits seit Jahrzehnten. Aber die Stadt, der es gelang, ihre gesamte Bevölkerung in diese Form der Kriegsführung einzubinden, würde dadurch einen entscheidenden Vorteil erlangen. Und genau das war das Ziel von Servius’ Reform: aus jedem männlichen Erwachsenen, der auf römischem Boden lebte, einerseits einen Bauern zu machen, der eine Familie ernähren und Söhne zeugen konnte, andererseits einen zum Kampf tauglichen Soldaten und nicht zuletzt einen Bürger, der sich an den kollektiven Entscheidungen beteiligte – kurzum einen Römer, der sein ganzes Leben und Handeln in den Dienst der Urbs stellte. Entsprechend bezeichnete das Wort exercitus sowohl die Armee als auch die Versammlung, denn die Armee, die sich anschickte, die Herrschaft der Urbs auf ganz Latium auszudehnen, war eine kämpfende Volksversammlung, und die auf dem Marsfeld vereinte Volksversammlung eine beratschlagende Armee. Im Kampf wie auf dem Versammlungsplatz hing das Schicksal des Einzelnen von allen anderen ab, und der Erfolg aller beruhte auf dem Handeln des Einzelnen. Brach die bronzene Wand, welche die Phalanx ihren Feinden entgegenstellte, oder traten in den Volksversammlungen zu viele divergierende Meinungen auf, so war die Stadt verloren. Daher bestand das angestrebte – und auch erreichte – Ziel der Reform im Wesentlichen darin, innerhalb der Bürgerschaft die Bande unverbrüchlicher Solidarität zu erneuern.
Die Bürger erfassen
Daher hing der Platz, der jedem Einzelnen in diesem System zugewiesen wurde, nicht länger von Verwandtschaft oder Klientelbeziehungen mit einem bestimmten Adelsgeschlecht ab, sondern von einem sehr viel neutraleren und allgemeingültigeren Kriterium: seinem materiellen Besitz, der in Pecunia bemessen wurde, also seinem Gegenwert in der entsprechenden Anzahl Vieh (pecus). Ebenfalls berücksichtigt wurden der Ruf und das persönliche Ansehen des Einzelnen, was im Lateinischen als dignitas (Würdigsein) bezeichnet wurde. Diese Reform war sicher nicht egalitär, aufgrund der Zahl und des Gewichts ihrer Zenturien bei den Abstimmungen verfügten die Reichen auch weiterhin über den größten Einfluss, solange sie sich ihres Standes nicht als unwürdig erwiesen. Aber sie war demokratisch: Die Begüterten konnten sich ihrer Beteiligung an den gemeinschaftlichen Anstrengungen nicht entziehen, während den Armen nun ebenfalls eine Rolle zuerkannt wurde. Die einen wie die anderen mussten folglich durch die Obrigkeit identifiziert werden, und das geschah auf dem Versammlungsplatz in der Ebene des Marsfelds. Das im Morgengrauen zusammengerufene Volk der Bauernsoldaten zog langsam an dem inmitten von Schreibern und Amtsdienern auf einem Podest thronenden König vorbei, bevor es von diesem in drei Kategorien eingeteilt wurde: Die Wohlhabendsten bildeten die Ritter-Zenturien, wer eine komplette Ausrüstung finanzieren konnte, kam in die Gruppe der ‚Herbeigerufenen‘ (classis), und die übrigen blieben ‚darunter‘ (infra classem) und nahmen mit reduzierter Bewaffnung am Kampf teil. Nachdem das Volk der Bürgersoldaten vom König in Augenschein genommen worden war, der damit sein oberstes Recht der Bewertung ausgeübt hatte (denn das bedeutet der lateinische Begriff census), stellte es sich zum Klang der Trompeten Zenturie für Zenturie – die der jungen Waffenfähigen getrennt von denen der Reservisten – in der großen Ebene auf. Ein allgemeines Reinigungs- und Sühneritual (lustrum) mit der feierlichen Opferung eines Schweins, eines Schafbocks und eines Stieres (suovetaurilia), die man zuvor drei Mal um die Armee geführt hatte, beschloss die eindrucksvolle Zeremonie. Da dieser Census alle fünf Jahre eine vollständige Neubestimmung der Bürgerschaft ermöglichte, entsprach er jedes Mal wieder einer regelrechten Neugründung der Stadt, weshalb sein Schöpfer Servius Tullius von den Römern auch als neuer Romulus betrachtet wurde.
Was dort um die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung auf dem Marsfeld entstand, war nichts anderes als die Politik: die Möglichkeit für jeden, der entschied, auf dem Gebiet einer der vier städtischen Tribus zu leben, an diesem großen, kollektiven Abenteuer namens Rom teilzuhaben. Kollektiv deshalb, weil das neue System dem Einzelnen ebenso wenig Gewicht beimaß wie das alte: Bei den Abstimmungen wurde nicht das individuelle Votum gewertet, sondern das der Zenturie. Polis ist bekanntlich der griechische Begriff für ‚Stadt‘, aber wenn wir uns hier auch zeitlich nach den Reformen des Solon befinden, der die Athener 594 v. Chr. in vier Zensusklassen einteilte, liegen wir doch vor der Schaffung der zehn Phylen durch Kleisthenes (508 v. Chr.). Die servianische Reform, die sowohl eine Neuordnung des städtischen Raums als auch eine militärische Neuorganisation und eine Neudefinierung der Bürgerschaft beinhaltete, stellte daher tatsächlich eine veritable Revolution dar, wenngleich sie, wie jene, die Jules Michelet beschrieb, „kein Denkmal“ hat. „Das Marsfeld ist das einzige Denkmal, das die Revolution hinterlassen hat. […] Die Revolution hat zum Denkmal – die Leere.“35 Doch es war eine Leere, welche die Stadtentwicklung Roms prägen sollte, denn die öffentlichen Gebäude, die im Laufe der Jahrhunderte ringsum auf dem Campus Martius errichtet wurden, zeichneten die von den Auguren bestimme Ausrichtung des Forums nach.
Die große Pferderennbahn
Im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung rückte eine weitere große Freifläche der Stadt allmählich ins Blickfeld: das Tal zwischen Palatin und Aventin.36 Am Rand der alten romuleischen Stadt erstreckte sich dort ein riesiges 600 Meter langes und 150 Meter breites Feld bis ans Flussufer. Es war von einem Wasserlauf durchzogen, der von zahlreichen an den umliegenden Hängen entspringenden Quellen gespeist wurde. Dank dieser Bewässerung war der Boden fruchtbar und wurde bereits in frühester Zeit bestellt. Weil ohne göttlichen Beistand keinem menschlichen Tun Erfolg beschieden war, hatte man das Areal der Obhut von Gottheiten unterstellt, die sowohl das Wachstum als auch die Ernte und die Lagerung des Getreides schützten. Seit den Zeiten des Septimontium stiegen die Bewohner des Palatins in der warmen Jahreszeit ins Tal hinab, um gemeinsam mit ihren Nachbarn von den umliegenden Hügeln Rituale zu begehen, welche die Fruchtbarkeit von Pflanzen, Herden und Menschen fördern sollten. Und darunter waren durchaus seltsame Riten, wie etwa jenes vom 19. April, wenn sie Füchse freiließen, an deren Schwanz zuvor brennende Strohfackeln befestigt worden waren!37
Diese weitläufige, noch periphere, aber gut zu erreichende freie Fläche verwandelten die tarquinischen Könige nach dem Vorbild der etruskischen Städte nun in eine öffentliche Wettkampfstätte,38 wo es leichte Wagenrennen, Faust- und Ringkämpfe oder Wettläufe zu bewundern gab. In erster Linie wurden diese sportlichen Spektakel zur Freude der Götter eingeführt, um der Stadt auch weiterhin deren Schutz zu sichern, und somit hatten sie natürlich eine religiöse Dimension: Es waren Ludi, Heilige Spiele. Doch gleichzeitig dienten sie auch dem Vergnügen der Römer, die begeistert den durch die Arena rasenden Gespannen zusahen und lautstark die Wagenlenker anfeuerten, die sich die Zügel um den Leib gebunden hatten, um ihre Pferde besser kontrollieren zu können, während sie diese mit der Peitsche antrieben! Diese Vorstellungen waren derart unterhaltsam, dass die wohlhabendsten Römer sie häufig auf den Terrakottaplatten abbilden ließen, mit denen das Kranzgesims ihres Wohnhauses verkleidet war.39
Damit sie die Wettkämpfe in aller Muße verfolgen konnten, ließ die Obrigkeit rings um die noch provisorische Bahn, auf der sich Pferde und Menschen Rennen lieferten, große Holztribünen errichten, von Gerüsten abgestützte Podeste, wo die begüterten Zuschauer auf Bänken saßen. Durch große, über ihren Köpfen aufgespannte Segel vor der Sonne geschützt, bewunderten und kommentierten sie gemeinsam mit ihren Ehefrauen hoch über dem einfachen Volk auf den Stehplätzen die Leistungen der Athleten. Anders als in den griechischen Städten der damaligen Zeit waren diese in Rom keine Berühmtheiten, sondern namenlose Spezialisten, die zum König oder zu einzelnen Aristokraten gehörten, welche sie finanzierten und denen der Glanz ihrer Siege zugutekam. Von den hölzernen Tribünen, die dem Tal anfangs seinen Namen gaben, ist nichts mehr erhalten. Kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sie während der Republik und der Kaiserzeit durch steinerne Konstruktionen ersetzt wurden, deren Überreste heute mehrere Meter unterhalb des aktuellen Bodenniveaus liegen. Trotzdem gab es sie, genau wie die heute ebenfalls verschwundenen Holztribünen, auf denen die bessere Gesellschaft des Mittelalters die Heldentaten der Ritter beim Turnier verfolgte. Wir haben sogar eine recht genaue Vorstellung von ihrem Aussehen, dank der Fresken in der sogenannten Tomba delle Bighe, einem Grab in der etruskischen Stadt Tarquinia, auf denen man Zuschauer erkennen kann, die sich an den zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Wettkämpfen erfreuen, während sich unter der Tribüne junge Leute ganz anderen Spielen hingeben …
Privathäuser
Doch wo lebten diese Zuschauer? In welcher Art von Bauten müssen wir sie uns vorstellen? Im sechsten Jahrhundert waren die ein- bis zweiräumigen Hütten der frühesten Zeiten größtenteils Wohnhäusern gewichen, deren Baumaterialien nun aus dem Boden stammten. Denn Holz war nach zwei Jahrhunderten intensiver Nutzung der umliegenden Wälder rar geworden und wurde nur noch für ganz bestimmte Zwecke verwendet – für Dachstühle und Schiffe. Die Mauern bestanden aus groben Steinen und jenem Lehm, den der römische Boden im Überfluss lieferte. Und so wuchsen immer mehr schnell und einfach erbaute Häuser in die Höhe: dicht an dicht verwandelten ihre Fassaden die einstigen Wege endgültig in schmale Straßen, die sich nach Lust und Laune der Bauherren in einem immer engmaschigeren Netz die Hügel hinaufzogen. Jede Familie bewohnte einige Räume, zwei, drei, nicht mehr, mit einem Vordach, unter dem gekocht wurde, und einem kleinen Hof hinter dem Haus.40
Erste Stadtresidenzen
Die reichsten Römer aber, die Angehörigen jener Aristokratie, die aus dem Umland in die Stadt gezogen war, begnügten sich doch sicher nicht mit derart schlichten Behausungen? Bislang war dies nur eine Vermutung, doch dank derselben Ausgrabungen, die auch die Palatinmauer ans Tageslicht brachten, verfügen wir nun über einen Beweis. Drei Mal wurde die Mitte des achten Jahrhunderts begründete Mauer vollständig neu errichtet, und Anfang des sechsten Jahrhunderts, beim Bau einer neuen Konstruktion aus behauenen Steinen, schüttete man auch den Bach zu, der bis dahin als Graben gedient hatte. Ein halbes Jahrhundert später wurde sie erneut niedergerissen und über ihren Trümmern die nunmehr vierte Mauer errichtet. Bis man schließlich um das Jahr 530 v. Chr. die wiederum zerstörte Anlage mit einer gewaltigen Aufschüttung zudeckte, wodurch das Bodenniveau am Fuß des Palatinhangs angehoben wurde und eine große Terrasse gegenüber der Velia entstand. Dort entwickelte sich innerhalb einiger Jahre ein neues Stadtviertel, welches den Vorzug genoss, in unmittelbarer Nähe zu den Zentren der Macht, dem Vestatempel und der königlichen Residenz, zu liegen. Folglich handelte es sich bei den vier Gebäuden, deren Überreste dort identifiziert werden konnten, nach damaligen Maßstäben auch um regelrechte Paläste.41 Im benachbarten Etrurien lebten die Angehörigen der aristokratischen Eliten in vergleichbaren Häusern, und sie ließen sich Gräber errichten, deren Grundriss dem ihrer Wohnhäuser exakt entsprach. Daher kann sowohl das äußere Erscheinungsbild der Gebäude in diesem römischen Häuserblock als auch die Aufteilung der Räume zumindest in groben Zügen rekonstruiert werden. Ihre nüchternen, etwa zehn Meter langen Fassaden beherrschten die Straße, im Erdgeschoss führten mehrere Zugänge in kleine Läden, in denen Passanten die Erzeugnisse des Landguts der Familie und Gegenstände erwerben konnten, die von den Handwerkern dieses Gutes hergestellt worden waren. Es gab nur wenige Fenster, dafür im ersten Stockwerk eine überdachte Terrasse, von der aus die Frauen und Kinder des Haushalts an Festtagen die Umzüge und Prozessionen beobachteten. Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Garten, in dem zuweilen ein Kind begraben lag, das schon in frühestem Alter gestorben war, was in jener Zeit häufig vorkam. Auf diese Weise unterstrich der Familienklan seinen Anspruch auf jenes Stück städtischen Bodens, das er dauerhaft zu bewohnen gedachte. Im Innenbereich dieser Häuser wurde jeweils eine Zisterne entdeckt, was bedeutet, dass es einen Bereich unter freiem Himmel gegeben haben muss, in den das Regenwasser gelangte, mit anderen Worten ein Atrium, um das sich die verschiedenen Räume des Hauses gruppierten. Damit jedoch ist ein Dogma der klassischen Archäologie hinfällig! Dieser jedem Besucher Pompejis vertraute Grundriss entstand also nicht im Kampanien des dritten Jahrhunderts v. Chr., nicht einmal irgendwo in der griechischen Welt, sondern war bereits ein charakteristisches Merkmal von Wohnhäusern, die mitten im Zentrum dieses archaischen Roms errichtet wurden. Selbst wenn das Haus ‚im pompejanischen Stil‘ vielleicht nicht in Rom entwickelt worden ist – tatsächlich sind weitere Bauten dieses Typs seit dem Beginn des sechsten Jahrhunderts in Etrurien nachweisbar –, so war es doch bereits sehr früh in der Urbs präsent, wo es den Komfort der herrschenden Eliten erheblich steigerte. Denn das Atrium löste zumindest teilweise das Problem der Wasserversorgung: Fortan wurde das Wasser in einer Zisterne gesammelt und über einen Brunnenschacht entnommen, dessen Überreste in einigen Fällen wiedergefunden wurden. Zudem gelangte dank dieser Bauform Tageslicht in Räume, die nicht mit Seitenfenstern versehen waren, da zu beiden Seiten der Häuser unmittelbar weitere Gebäude angrenzten. Zu guter Letzt bildete das Atrium einen gesellschaftlichen Repräsentationsraum, in dem der Herr des Hauses seine Freunde und Klienten empfangen, die Statuen seiner Vorfahren präsentieren und seinen Reichtum und seine Macht zur Schau stellen konnte. Von nun an sollte bis ans Ende der Geschichte der Urbs jedes Patrizierhaus in Rom darüber verfügen.
Und auch die Stadtpaläste zwischen Via Sacra und Via Nova sollten mehrere Jahrhunderte überdauern, die Archäologie rekonstruiert ihr Leben im Wechsel der Generationen und mit all den Umbauten und Erneuerungen, welche die verstreichende Zeit mit sich brachte. Diese Kontinuität macht sie zu Erinnerungsorten, zum Sammelbecken einer Familiengeschichte, die Teil der Stadtgeschichte war. Hieß es nicht in Rom, einer der tarquinischen Könige habe in diesem Bereich gewohnt?42 Nach dem Prinzip der proportionalen Gleichheit, das nun alle Schichten der römischen Gesellschaft beherrschte, ließen sich die Wohlhabenden in der ganzen Stadt ähnliche Häuser bauen: rings um das Forum, das sich durch die Läden in den Erdgeschossen in einen großen Markt verwandelte, auf der Velia, dem Caelius, aber auch auf den anderen Hügeln, vornehmlich dem Quirinal.43
Das Beispiel des Häuserblocks an der Via Sacra zeigt, dass die Stadt die Phase der Einzelinitiativen, wie es einst der Bau einer Hütte gewesen war, hinter sich gelassen hatte und in das Stadium kollektiver Projekte eingetreten war. Denn vor dem Baubeginn mussten zunächst frühere Konstruktionen, in diesem Fall die Palatinmauer, abgerissen und das Gelände angehoben, planiert und entwässert werden. Von Anfang an war ein Abwasserkanal vorgesehen, und sämtliche angrenzenden Straßen wurden erneuert. Erschließung des Geländes, Bau einer Kanalisation, Erneuerung des Straßennetzes, die Errichtung von Gebäuden mit vergleichsweise einheitlichem Grundriss – was wir hier vor uns sehen, ist ein regelrechtes Stadtplanungsprojekt! Und der Initiator dieser Maßnahmen, der Bauträger, um es mit modernen Begriffen auszudrücken, kann niemand anders gewesen sein als der König, der als Einziger über genügend Autorität verfügte, um einen derart exponierten Ort auf so massive Weise umzugestalten. Der Adel, der seinen Reichtum nicht länger für luxuriöse Grabstätten ohne Morgen verprassen durfte, richtete seinen Repräsentationsdrang und seinen sozialen Wettbewerb nunmehr auf die Gestaltung seiner Paläste, die den öffentlichen Raum der Stadt nachhaltig verändern sollten. Während die Gräber der großen Nekropole, die sich unablässig weiter in die Täler des Esquilins ausdehnte, inzwischen nur mehr einfache Gruben waren, in denen selbst die Reichsten lediglich in einem schlichten Steinsarkophag beigesetzt wurden und man den Ärmeren nichts als ein paar miniaturisierte Opfergefäße mitgab,44 entwickelten sich die Wohnstätten der Lebenden zu einer wahrhaft urbanen Landschaft: Die Straßen wurden gepflastert, Plätze angelegt und die Hügelhänge, vor allem die des Palatins, mit mächtigen Stützmauern befestigt und terrassiert.45
Cloaca Maxima
Fraglos gab es in dieser Phase auch entscheidende Fortschritte bei der öffentlichen Hygiene. Unter allen vier kürzlich identifizierten Häusern in der Nähe des Vestatempels wurden mit kleinen Tuffsteinplatten ausgekleidete Röhren entdeckt, durch die das Wasser zur benachbarten Durchgangsstraße abgeleitet wurde. Es besteht somit heute kein Zweifel mehr daran, dass dort ein öffentlicher Abwasserkanal verlief. Diese und vergleichbare Anlagen anderswo im Stadtgebiet folgten den Läufen früherer kleiner Bäche, die inzwischen, wie die alten Wege an ihren Ufern, Straßen gewichen waren und jetzt unterirdisch flossen. So wurden in diesem zunehmend von Menschenhand geformten Raum die natürlichen Gegebenheiten aufgenommen und verändert. Dieser Fund rückt die gesamte Überlieferung hinsichtlich des größten Abwasserkanals, der Cloaca Maxima, deren Bau in antiken Texten bald dem einen, bald dem anderen der beiden Könige mit Namen Tarquinius zugeschrieben wurde, wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nicht weit von dort entfernt verläuft etwa fünf bis sechs Meter unter dem Niveau der antiken Straße ein großer unterirdischer Kanal. Er kam von den Anhöhen der Subura herab, durchquerte das Forum, führte am Palatin entlang in Richtung Velabrum und mündete schließlich in den Tiber. Natürlich stammen die bei seinem Bau angewandten Techniken zum größten Teil aus weit späteren Phasen als der Königszeit. Aber jenseits des Palatins, im sogenannten Tal des Kolosseums, hat man unter einer Straße, die unzweifelhaft in archaischer Zeit angelegt worden ist, ein paar Meter Kanal mit Tuffsteinwänden und einem sorgfältig konstruierten Gewölbe gefunden.46 Aus jenen letzten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts v. Chr. stammend, die Rom eine wahre Metamorphose bescherten, sind diese Relikte ein Beleg für jene technischen Innovationen, die diese Verwandlung erst ermöglichten. Zudem liefern sie ein weiteres Indiz für eine archaische Cloaca Maxima, die an anderen Stellen der Stadt nur deshalb jünger zu sein scheint, weil sie mehrfach restauriert, ja teilweise erneuert wurde.47 Dass diese Kloake als die ‚größte‘ (maxima) bezeichnet wurde, lag weniger an ihren Dimensionen – sie war maximal drei Meter breit und ebenso hoch – als vielmehr daran, dass sie ein riesiges unterirdisches Netz unter dem gesamten römischen Zentrum bildete. Damals bezeichnete man die gesamte Kanalisation mit diesem Namen, und erst die moderne Forschung beschränkte den Begriff simplifizierend auf jenes unter dem Forum verlaufende Teilstück, das man sich in seinem ursprünglichen Zustand fälschlicherweise als einen offenen Graben vorstellte.48 Tatsächlich jedoch gehörten auch unterirdische Kanäle entlang des Häuserblocks beim Vestatempel, im Tal östlich des Palatins, in der Ebene des Circus Maximus, die damit vom Schwemmgebiet befreit wurde, im Forumtal und beim Velabrum zu diesem Netz. Und dieses ganze Ab- und Stauwasser wurde in den Tiber geleitet.
Da in einer Gesellschaft wie dem archaischen Rom auch die Technik untrennbar mit der Religion verbunden war, wurde diese Entwässerung des Stadtgebiets als eine gleichsam rituelle Reinigung betrachtet. Folglich stand beispielsweise an jenem Punkt, wo zwei unter dem Forum verlaufende Abwasserkanäle aufeinandertrafen, ein kleines, der Venus Cloacina (‚Reinigende Venus‘) geweihtes Heiligtum.49 Dort waren einst nicht nur zwei natürliche Wasserläufe zusammengeflossen, sondern es hatten sich auch die benachbarten Völkerschaften hier getroffen, im Grenzbereich ihrer Siedlungsgebiete, um Lebensmittel zu tauschen, Abkommen zu schließen und sogar gemischt-ethnische Massenhochzeiten zu feiern.50 In dem nunmehr städtischen Umfeld diente das Heiligtum den Frauen zur Feier von Initiationsriten.
Wo das Velabrum in das Forum mündete, lag ein Kultplatz, der dem Vertumnus geweiht war, jenem Gott, der für die Umlenkung von Wasser und den Wechsel der Jahreszeiten zuständig war. Und es verwundert nicht, diesen von jenseits des Tibers stammenden Gott hier im Herzen des Etruskerviertels (Vicus Tuscus) anzutreffen, jenem zwielichtigen Teil der Stadt in der Nähe des Hafens, wo sich die Kaufleute angesiedelt hatten, die mit den per Schiff aus dem fernen Orient eintreffenden Salben und Duftstoffen handelten, insbesondere dem Weihrauch, der bei religiösen Zeremonien zunehmend in Gebrauch kam. Genau an dieser Stelle beschrieb die Cloaca einen scharfen Bogen, jedoch nicht, wie man vermuten könnte, um einer Kultstätte auszuweichen, die schon vorher dort bestanden hatte. Stattdessen sollte dadurch an diesem strategischen Punkt, dem Eintritt ins Forum, bei Hochwasser das Ansteigen der Fluten gebremst werden.51 Und logischerweise beschirmte der Gott, den man darum bat, das Wasser umzulenken (vertere), auch diese Biegung des unterirdischen Kanals kurz vor der Ankunft im Tiber. So verlieh die Religion noch den prosaischsten Erfordernissen der Stadtplanung sakralen Rückhalt!
Alles in allem leitete die Stadt durch dieses Kanalsystem erfolgreich sämtlichen Unrat ab, den sie unablässig produzierte, kein Wunder also, dass eine weitere große, wenngleich symbolische Reinigung, das Ritual der Argei, auf dem Pons Sublicius endete, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo die Cloaca in den Fluss mündete.52 Die religiöse Zeremonie bot somit auf magisch-symbolischer Ebene das genaue Gegenstück zum konkreten Netz der in Richtung Tiber zusammenlaufenden wichtigsten Abwasserkanäle. Alle Unreinheiten, aller Müll, seien sie religiöser oder realer Natur, wurden auf diese Weise im und durch das läuternde Wasser des Flusses gereinigt und fortgespült. Doch wie viel Arbeit der Bau dieses unterirdischen Kanalnetzes erfordert haben muss! Eine solch undankbare Plackerei konnte nur von einer ungeteilten, autoritären Machtinstanz angewiesen worden sein. Mehrere Jahrhunderte nach der Zeit der Könige sollten sich die römischen Historiker, die sogenannten Annalisten, noch der zahlreichen Menschen erinnern, die sich erhängt hatten aus Verzweiflung über die harte Arbeit, die der zahlenmäßig kleinen Einwohnerschaft auferlegt wurde.53 Wie hätten die Römer auch frohen Herzens eine Aufgabe akzeptieren können, die sie als demütigend empfanden, weil diese sie davon abhielt, ihren Lebensunterhalt eigenständig als Bauern und Soldaten zu verdienen, und sie von anderen abhängig machte?54 Um ihren Widerstand zu brechen, habe Tarquinius die Leichen angeblich an Kreuze nageln lassen und ihnen auf diese Weise ein Grab verweigert – woraufhin sich die Römer wieder an die Arbeit machten …
Die große Mauer
Denn es wartete noch eine weitere, ebenso gewaltige Aufgabe auf sie: Die Monarchie, die zunehmend die Züge einer Tyrannis griechischen Stils annahm, beabsichtigte, die Stadt nun mit einer Mauer zu versehen, die sie vor allen bösen Überraschungen von außen schützen sollte. Jeder Bürger wurde verpflichtet, seinen Beitrag zur Errichtung dieses kollektiven Bauwerks zu leisten – der entsprechende Begriff für diese Verpflichtung lautete munus oder vielmehr moenus, wovon auch der Name der Anlage, die Pluralform moenia, abgeleitet zu sein schien.55 Die Stadtmauer sollte das gesamte Stadtgebiet, vom Quirinal bis zum Aventin und vom Viehmarkt (Forum Boarium) bis zum Caelius, mit einem befestigten Bollwerk umgeben, das zur Landseite hin zusätzlich mit einem tiefen Graben verstärkt war.56 Man kann sich leicht vorstellen, was die zur Fronarbeit an diesem gigantischen Projekt herangezogenen Römer anfangs davon gehalten haben, und doch bescherte ihnen die neue Mauer gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit vor ihren Feinden. Zudem begründete sie, genau wie die neuen Institutionen, eine starke Solidarität unter den Einwohnern, den Eindruck, Teil eines großen Ganzen zu sein, an einem gemeinsamen Schicksal mitzuwirken. Diese große Mauer zu erschaffen, bedeutete, Rom zu erschaffen, bedeutete für jeden einzelnen von ihnen, sich selbst als Römer zu erschaffen. Mehr noch als der reine Zwang erklärt dieses Gefühl, weshalb es den Einwohnern der Urbs letztlich gelang, sämtliche Schwierigkeiten und Strapazen eines Unternehmens zu bewältigen, dessen Verwirklichung mehrere Jahrzehnte intensiver gemeinschaftlicher Bemühungen erforderte. Die moderne Forschung nennt diesen Befestigungsring nach Servius Tullius die ‚Servianische Mauer‘, doch die antiken Autoren kamen der Wahrheit näher, als sie ihn wechselweise jedem der drei letzten Könige zuschrieben.57 Fast elf Kilometer verlief die neue Mauer bald dicht an den Hügelkuppen, bald auf halber Höhe der Hänge, durchquerte Hochebenen und Täler, folgte der Biegung des Flusses und verlieh dem Stadtgebiet mit ihrem durchgängigen Verlauf jene Geschlossenheit, an der es ihm bislang noch gemangelt hatte. Die frei stehenden Hügel Kapitol, Palatin und Aventin wurden in einen gemeinschaftlichen Raum integriert, während jene Anhöhen, die lediglich Ausläufer des Hinterlandplateaus waren, nun unübersehbar davon abgegrenzt wurden. Denn vom Quirinal bis zum Esquilin bot das Gelände keinerlei natürlichen Schutz, weshalb die Römer auf einer Länge von etwa anderthalb Kilometern einen mächtigen, nach außen hin ansteigenden Erdwall (agger) aufschütteten.58 Dieser wurde auf der niedrigeren Innenseite durch eine Stützmauer abgesichert, während auf der nach außen gewandten, höheren Seite die eigentliche, etwa vier Meter breite und zehn Meter hohe Wehrmauer lag. Davor befand sich ein ungefähr dreißig Meter breiter und in der Mitte gut zehn Meter tiefer Graben. An anderen Stellen war es häufig möglich, die natürlichen Geländeformen als Wall zu nutzen oder lediglich die Hügelkämme zu befestigen. So entstand die große römische Mauer, die mehrere Jahrhunderte überdauern sollte.
Von diesem gigantischen Verteidigungsring ist heute, nach über zweieinhalb Jahrtausenden, kaum noch etwas erhalten, nur rund dreißig einzelne Mauerstücke, die zusammen eine Gesamtlänge von etwa 200 Metern ergeben. Das ist der Grund, weshalb die moderne Forschung bis vor Kurzem noch die Existenz, ja selbst die reine Möglichkeit einer Servianischen Mauer strikt verneint hat. Wurden nicht die heute noch sichtbaren Überreste, insbesondere im Bereich des Bahnhofs Termini, nach langen Kontroversen in das vierte Jahrhundert v. Chr. datiert? Und wurde Rom nicht im vierten Jahrhundert v. Chr. von den Galliern erobert, was zu implizieren scheint, dass die Stadt zu der Zeit noch nicht durch eine Wehrmauer befestigt war? Vor allem aber, hieß es, sei das Rom der Tarquinier doch eine kleine, unbedeutende Stadt gewesen, ein noch junges Gemeinwesen und demzufolge unfähig zum Bau eines solchen Bollwerks. Vor allem dieses letzte Argument prägte lange die Überzeugung der Fachwelt. Doch wie wir gesehen haben, war die Situation in Wirklichkeit eine ganz andere: Die vermeintlich junge Gemeinschaft hat sich als eine mächtige, hoch entwickelte und bereits über eine lange Vergangenheit verfügende Stadt entpuppt. Und unter diesen Umständen halten auch die übrigen Einwände keiner näheren Überprüfung stand. Seit Langem weiß man, dass die aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. stammende Befestigung dort, wo die Mauer am besten erhalten ist, namentlich im Bereich des Aventins, auf einem Fundament aus Blöcken ruht, die zwangsläufig älter sein müssen.59 Die ältesten Gräber auf römischem Boden findet man zwar innerhalb des Mauerrings oder auch direkt unter der Aufschüttung, die einige von ihnen unter ihrer Masse begraben hat, doch sämtliche Grabstätten aus der Zeit nach der Mitte des sechsten Jahrhunderts liegen außerhalb der Stadtmauern, die ihnen folglich vorausgegangen sein müssen. Und was die Gallier betrifft, die 390 v. Chr. die Stadt eroberten, so geschah dies nicht etwa aufgrund fehlender Verteidigungsanlagen, sondern weil nach der vernichtenden Niederlage der Römer in der Schlacht an der Allia schlicht zu wenig Verteidiger da waren.60
Die ältesten noch identifizierbaren Überreste müssen also tatsächlich der Königszeit – genauer gesagt der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts v. Chr. – zugerechnet werden, umso mehr als diese Datierung durch Untersuchungen an neu entdeckten Teilstücken bestätigt wird.61 Insgesamt beweist die Verteilung dieser Spuren die Existenz einer durchgängigen und umfassenden, das heißt nicht auf die jeweils einzelnen Hügel beschränkten Ringmauer. Denn sie wurden sowohl auf dem Kapitol gefunden wie auch auf dem Quirinal, dem Esquilin und dem Aventin, mit anderen Worten rings um das Stadtgebiet, das somit einschließlich seiner verwundbarsten Stellen, den Hochebenen im Nordosten und dem Flussufer im Westen, vollständig umschlossen und geschützt war. Das Mauerwerk bestand aus quaderförmig behauenen Steinblöcken (Opus quadratum), eine in Rom damals noch neue Technik, die erst ein halbes Jahrhundert zuvor beim Bau der vierten Palatinmauer erstmals im Stadtgebiet aufgetaucht war. Aber hier wurde nun nicht mehr das rötliche Tuffgestein verwendet, das vor Ort unmittelbar an der Oberfläche abgebaut wurde, sondern jener grünliche oder dunkelgraue Tuff, der auf den tieferen Schichten des Untergrunds aufliegt und daher im Italienischen Cappellaccio (‚kleiner Hut‘) genannt wird. Zur Deckung des Bedarfs auf dieser riesigen Baustelle hatten die Erbauer der großen Mauer kurz vor der Stadt, auf den Hochplateaus von Quirinal und Esquilin, Steinbrüche eröffnet,62 deren intensive Nutzung eine von der Zentralmacht ausgehende Organisation und harte Arbeit voraussetzte, an die sich die Römer noch lange erinnern sollten. Natürlich wurden, wo immer möglich, entlang der Befestigungslinie auch kleine, lokale Steinbrüche eröffnet. Und so lieferte die alte Lava des Vulcano Laziale das Material, mit dem die Urbs nun ihre Wallmauern errichtete. Die alle gleich großen, jeweils etwa 200 Kilo schweren und maximal dreißig Zentimeter dicken Tuffplatten wurden ohne Zement in mehreren Lagen übereinandergeschichtet. Die über den gesamten Verlauf der Mauer identischen Steinmaße und die einheitliche Bautechnik belegen, dass es sich um ein gemeinschaftliches Projekt handelte, an dessen Ursprung nur die Zentralmacht, mithin der König stehen konnte. Die gewaltigen Dimensionen dieses Bauvorhabens setzen voraus, dass sämtliche Einwohner der Urbs, zweifellos mit Ausnahme der im Senat tagenden Aristokraten und ihrer Angehörigen, an den Arbeiten beteiligt waren. Auf irgendeine Weise musste das neue System zur Aufteilung der Bevölkerung in Tribus und Zenturien zur Organisation dieser kolossalen Baustelle gedient haben: Jeder arbeitete an der ihm zugewiesenen Stelle in dem für seine Einheit vorgesehenen Bereich, und wurde im Gegenzug mit den notwendigen Lebensmitteln versorgt.
Die neuen Stadttore
Natürlich verfügte die neue Mauer auch über Öffnungen, durch welche die Menschen sie mit ihren Tieren und Waren passieren konnten: rund 15 Stadttore, deren Name und Lage für alle Zeiten im kollektiven Gedächtnis der Stadt bewahrt bleiben sollten.63 Einige dieser Namen scheinen auf architektonische Besonderheiten zu verweisen, so etwa die Porta Raudusculana (mit Bronzeverzierungen), die Porta Trigemina (mit drei Bögen) oder die Porta Fenestella (mit einem kleinen Fenster). Andere bezogen sich auf die adligen Geschlechter, die in unmittelbarer Nachbarschaft lebten, wie im Fall der Porta Naevia und der Porta Ratumenna. In vielen anderen Bezeichnungen jedoch erkennt man den Namen der nahebei verehrten Gottheit wieder: So erinnert die Porta Quirinalis an Quirinus, die Porta Salutaris an Salus, die Göttin des Wohlergehens der Stadt, und die Porta Sanqualis an Semo Sancus. Zudem gab es noch die Porta Fontinalis, die Porta Carmentalis und die Porta Lavernalis, in denen die Namen der alten Gottheiten Fons, Carmenta und Laverna anklingen. Natürlich sind diese religiös inspirierten Namen nicht ohne Bedeutung: Es hat ganz den Anschein, als habe die Stadt ihren Göttern die Aufgabe übertragen, an ihren Grenzen zu wachen und sie gegen äußere Bedrohungen zu schützen.
Eine letzte Kategorie von Benennungen schließlich beruht auf der Topografie. In dieser Gruppe würde man eigentlich die Namen von außerhalb des römischen Stadtgebiets gelegenen Orten erwarten, in die von diesen Toren ausgehende Straßen führten. Schließlich liegt die Porte d’Orléans, wie jeder weiß, in Paris und die Avenue de Paris in Orléans. Erstaunlicherweise ist dies jedoch nur bei zwei Namen der Fall, bei der Porta Flumentana gegenüber dem Fluss (flumen) und bei der Porta Capena am Ausgangspunkt der Via Latina, die in Cabum endet, jenem Dorf, das den Zugang zum Schauplatz der Feriae Latinae in den Albaner Bergen kontrollierte.64 Der Name des Dorfes findet sich in seiner etruskischen Form in dem des Tores wieder. Ansonsten jedoch bezeichneten die Namen, wie es auch schon beim römischen Tor (Porta Romanula) in der palatinischen Mauer der Fall gewesen war, den Ort, meist eine Anhöhe, die das betreffende Tor mit mächtigen Bastionen schützte. Das gilt für die Porta Collina,65 die den oft schlicht collis (‚Hügel‘) genannten Quirinal schützte ebenso wie für die Porta Viminalis, die Porta Esquilina, das Tor zum Eichenberg (Porta Querquetulana) und das zum Caelius (Porta Caelimontana). Der ‚introspektive‘ Charakter dieser Namen ist durchaus bemerkenswert, bedeutet er doch, dass die Stadt den Blick gewissermaßen von außen auf sich selbst richtete, dass Rom ein Ort war, den man betrat, nicht einer, den man verließ.
Die Botschaft dieser Namen entsprach also genau jener, die bereits die neuen Institutionen vermittelten: Man kam nicht als Römer zur Welt, sondern man wurde es … indem man nach Rom kam. Doch stand diese Möglichkeit allen offen? Betrachtet man die Lage der Tore mit topografischem Namen, sind Zweifel daran erlaubt. Während sich die meisten dieser Ortsbezeichnungen im östlichen Bereich des Mauerrings zum Hinterland hin fanden, lagen sämtliche nach einer Gottheit benannten Tore im Westen. Es scheint ganz so, als habe die Stadt entlang des Flusses, im Angesicht der Etrusker, ihre Götter zu wachsamen Hütern ernannt, während sie sich auf der entgegengesetzten Seite ihren Nachbarvölkern, jenen halb als Feind, halb als Freund betrachteten Verwandten, den Sabinern, Aequern und Latinern, als potenzieller – oder unausweichlicher? – Ankunftsort präsentierte.
Die große königliche Mauer definierte somit den urbanen Raum, in den nun auch Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius und Aventin einbezogen waren, vollständig neu. Zwischen Innen (der Urbs) und Außen (dem Ager), zwischen der Stadt und dem Umland bildete sie eine neue, gleichermaßen konkrete wie abstrakte Demarkationslinie.
Die erste Stadtplanung
Aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen beschränkten die Planer der großen Mauer die Zahl der Stadttore auf ein Mindestmaß, und logischerweise befanden sich diese an den Endpunkten der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Die längsten Straßen jedoch verbanden das politische Zentrum des Forums auf eine so direkte, geradlinige Weise mit den Toren, dass sie zwangsläufig zeitgleich mit dem mächtigen Bollwerk entstanden sein müssen und ihr Verlauf bewusst darauf abgestimmt wurde.66 So führte über jeden Hügelkamm ein Weg (vicus) geradewegs auf die Mauer zu, in den, kurz bevor er das Stadttor erreichte, eine Steigung (clivus) mündete, die den Verkehr aus dem angrenzenden Viertel bündelte. Insgesamt bildeten die großen Achsen ein Wegenetz, das sich in drei divergierenden Strängen nach außen hin fortsetzte: Nordöstlich und östlich des Zentrums verband die Alta Semita (‚Hoher Weg‘) die Porta Salutaris mit der Porta Collina, der Vicus Patricius führte zur Porta Viminalis und der Clivus Suburanus zur Porta Esquilina. In östlicher und südöstlicher Richtung liefen weitere Straßen in Richtung der Via Latina zusammen, und im Westen, jenseits des Tibers, führte die Via Triumphalis nordwärts in Richtung Veji, während die Via Campana zur Küste mit ihren Salzgärten und dem Hafen hinabführte. Diese enge Verbindung zwischen dem städtischen Wegenetz und der Servianischen Mauer war natürlich ebenso wenig dem Zufall geschuldet wie der schnurgerade Verlauf der großen Durchgangsstraßen, der zum Teil bis heute erhalten geblieben ist.
Tatsächlich handelte es sich um eine regelrechte Stadtplanung, die nur auf Anordnung einer Zentralgewalt umgesetzt werden konnte. Wer mag dafür infrage kommen? In dieser Zeit ist der zweifellos wahrscheinlichste Kandidat für diese Rolle der im kollektiven Gedächtnis der Stadt so präsente König Servius Tullius. Die sowohl archäologisch als auch auf dem Stadtplan konkret nachvollziehbaren umfangreichen, konzentrierten und konzertierten Infrastrukturmaßnahmen erweisen sich als die beste Bestätigung der römischen Überlieferungen, in denen der gute König als Schöpfer weitreichender institutioneller Neuerungen (Tribus und Zensus) erscheint, die über Jahrhunderte hinweg Bestand hatten. Wie auch seine Beinahe-Zeitgenossen Solon und Kleisthenes reformierte Servius Tullius gleichzeitig sowohl die Bürgerschaft als auch den städtischen Raum.
Das neue Pomerium
Daher ist es auch vollkommen logisch, dass er sein Werk mit einer Ausweitung des Pomerium verband, jener sakralen Grenze, die bislang allein den Palatin umschlossen hatte. Um einer veränderten Situation gerecht zu werden, die dem über zwei Jahrhunderte ununterbrochenen Wachstum der Stadt geschuldet war, wurden nun auf einer sehr viel größeren Fläche die Auspizien eingeholt und die Vögel, die Boten Jupiters, beobachtet. Und fortan wurde auch das Verbot, die Stadt mit Waffen zu betreten oder dort einen Toten zu bestatten, sehr viel strenger ausgelegt als bisher. Denn die Stadt musste ein dem Leben und der Waffenruhe vorbehaltener Bereich sein, sollte der schwelende Konflikt zwischen rivalisierenden aristokratischen Sippen, der schon der Grund für seine ursprüngliche Einrichtung gewesen war, auch weiterhin nicht eskalierten. Da das Pomerium untrennbar mit den Gründungsriten und dem Palatin verbunden war, kann es nicht von Servius Tullius geschaffen worden sein, aber mit seiner deutlich weiter gefassten räumlichen Ausdehnung hat der sechste König ihm zugleich eine neue theologische Vitalität verliehen. Die Verbindung zwischen der magischen Grenze des Pomerium und der konkreten Einfassung durch die Mauer blieb bestehen, doch zum ersten Mal waren sie nicht mehr vollkommen deckungsgleich: Der Aventin wurde zwar in den schützenden Mauerring einbezogen, blieb jedoch außerhalb des sakralen Bannkreises. Wie hätte auch jener Hügel, der als Ort des unglückseligen Remus galt, den Segen Jupiters genießen können? In seinem neuen Verlauf bildete das Pomerium eine religiöse und institutionelle Grenze, die für die Stadt von allerhöchster Bedeutung war und mehr als vier Jahrhunderte unverändert Bestand haben sollte.
Parallel zu dieser räumlichen Erweiterung wurde auch der zeitliche Rahmen, der die öffentlichen Aktivitäten der Stadt strukturierte, umgestaltet und ausgeweitet. Denn höchstwahrscheinlich wechselte Rom im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vom alten, zehn Monate umfassenden Kalender, der mit dem März begann und dem so passend benannten Dezember endete, zu einem zwölfmonatigen Kalender, der das frühere System ablöste, ohne dass nun unlogisch gewordene Bezeichnungen geändert wurden.67 Wie die räumliche Umwandlung vollzog sich auch die Umwandlung des Kalenders nicht von selbst: Sie konnte nur auf Veranlassung einer Zentralgewalt erfolgen, die im Zusammenleben dieser neu umrissenen Stadt eine Möglichkeit sah, Raum und Zeit neu zu definieren.
Der Tempel des Iuppiter Optimus Maximus
Als Ausdruck ihres wachsenden Zusammenhalts und ihrer kollektiven Identität begann die Stadt zur selben Zeit mit dem Bau eines großen Heiligtums,68 das, wie es sich gebührte, dem Staatsgott Jupiter geweiht war. Und wo war der beste Platz dafür? Auf dem steilsten Hügel – in der Höhe unterschieden sie sich ja kaum –, in unmittelbarer Nähe zum politischen Zentrum, dem Forum, auf jener Anhöhe, auf der alles begonnen hatte, dem einstigen Saturnischen Berg, der inzwischen zum Tarpejischen Berg geworden war. Dieser wies damals, wir erinnern uns, zwei Kuppen auf, von denen die südliche, näher beim Fluss gelegene, den meisten Platz bot. Und so wählte man sie als Standort für den künftigen Tempel. In unmittelbarer Nähe zu einem der Metallverarbeitung gewidmeten Bereich (man wagt nicht, es als ‚Industriegebiet‘ zu bezeichnen) hatte sich dort seit mehreren Jahrhunderten ein Dorf entwickelt. Außerdem gab es eine kleine, offenbar Kindern, deren Sterblichkeit damals sehr hoch war, und Jugendlichen vorbehaltene Nekropole.
Nachdem die bestehenden Gebäude abgerissen und eingeebnet worden waren, legten die Erdarbeiter als Erstes eine viereckige, von Nordwest nach Südost ausgerichtete Fläche an. Entlang der vier Seiten des auf diese Weise begrenzten großen Rechtecks hoben sie anschließend bis zu acht Meter tief in den Fels hinabreichende und fast sieben Meter breite Gräben aus. Diese wurden mit etwa zehn Reihen abwechselnd längs und quer verlegter Tuffsteinplatten zu mächtigen Stützmauern aufgefüllt. Oberirdisch ragte die Konstruktion noch weitere viereinhalb Meter in die Höhe, wobei die umlaufenden Mauern durch weniger dicke, aber immer noch eindrucksvolle Quermauern mit der Mitte verbunden waren. Nachdem die Struktur das Niveau der Grundfläche erreicht hatte, die zunächst als Arbeitsbereich für die Verlegung der Blöcke gedient hatte, wurden die Hohlräume zwischen den heranwachsenden Mauern nach und nach mit einem Gemisch aus Lehmerde und Tuffschlacke verfüllt. Was auf diese Weise entstand und wovon – nach ersten Funden im 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts – bei Ausgrabungen zwischen 1998 und 2002 spektakuläre Überreste zum Vorschein gekommen sind, war nicht der Tempel selbst, von dem heute nichts mehr erhalten ist. Stattdessen handelte es sich lediglich um das Fundament seines Podiums, dessen gewaltige Ausmaße auf die Dimensionen des Bauwerks schließen lassen.69 Denn es ist kaum vorstellbar, dass eine unter derartigen Mühen errichtete Konstruktion lediglich als Plattform für einen Tempel angelegt wurde, der selbst viel kleiner war.70 Demnach markieren die kürzlich entdeckten Mauern auch tatsächlich den Grundriss des eigentlichen Tempels, mithin eines Gebäudes, das mit seinen 68 Metern Länge und 50 Metern Breite eine Gesamtgrundfläche von knapp 3400 Quadratmetern aufwies.71 Ringsum, aber vor allem vor dem Bauwerk hatte man den Boden eingeebnet, um eine große Freifläche zu schaffen, auf der Exaugurationsriten bis auf wenige Ausnahmen zur Aufhebung der Kulte geführt hatten, die zuvor dort begangen worden waren.
An der Entstehungszeit des Heiligtums besteht inzwischen kein Zweifel mehr. Denn die in mehreren Einheiten an verschiedenen Stellen parallel eingesetzten Männer arbeiteten hart! Sie hatten Durst, und manchmal ließen sie das Gefäß fallen, aus dem sie gerade tranken. Und so ermöglichen es uns einige Scherben zweieinhalb Jahrtausende später, den zeitlichen Ablauf der Baustelle zu rekonstruieren: Die Arbeiten scheinen um die Mitte des sechsten Jahrhunderts v. Chr. begonnen zu haben und während der gesamten darauf folgenden fünfzig Jahre fortgesetzt worden zu sein. Was bedeutet, dass der Plan zum Bau des Tempels schon in der ersten Jahrhunderthälfte entwickelt worden sein muss. Tatsächlich datierten die antiken Historiker – namentlich Titus Livius und Dionysios von Halikarnassos – den Bau in die Königszeit, doch aus Prinzip lehnten es viele ihrer modernen Nachfolger ab, ihnen zu glauben. Mittlerweile jedoch bringen Bedeutung und Evidenz der neuen Funde selbst die größten Skeptiker zum Umdenken.72 Wir haben es hier mit einem höchst eindrucksvollen Heiligtum zu tun, das für sich allein genommen bereits als Beweis für die Macht der Stadt genügen würde, die es erbaute. Diese war jedoch darüber hinaus noch in der Lage, sich gleichzeitig mit einer mächtigen Wehrmauer zu umgeben!
Die zum ersten Mal bei dem kleinen Tempel am Viehmarkt erprobten Lösungen wurden hier wieder aufgenommen, wenn auch in sehr viel größerem Maßstab. Auf dem hohen Podium, zu dem eine breite Freitreppe hinaufführte, erhob sich nun ein weithin sichtbares Gebäude, das dem Tiber den Rücken zuzuwenden und den Blick auf die Hügel zu richten schien. Auf drei Seiten war es von massiven Säulen umgeben, die zur Front hin in drei Sechserreihen hintereinander angeordnet waren und so eine tiefe Vorhalle ergaben, in der die sakralen Zeremonien abgehalten werden konnten. Lange Holzbalken bildeten den Architrav, über dem der Giebel aufragte. Reliefartig gestaltete und bemalte Terrakottaverkleidungen an den Säulen und Balken ließ den aus Tuffstein und Holz errichteten Bau freundlich und lebendig wirken. Auf dem Kranzgesims waren feierliche Prozessionen von Göttern und Heroen dargestellt, deren Wagen von geflügelten Pferden gezogen wurden und die jene realen Umzüge widerspiegelten und verewigten, deren Ziel der Tempel nun war. Darüber spannte sich der Kranz der Antefixa, jener verzierten Stirnziegel am Ende der Dachziegelreihen. Dort lächelten die Gestalten von Mänaden und Silenen, deren stummer Tanz das Heiligtum mit wachsamer Aufmerksamkeit schützte. Auf dem Dach schließlich erhoben sich Götterstatuen. Nach dem Willen des Auftraggebers krönte eine Darstellung des von Jupiter gelenkten vierspännigen Wagens die Giebelspitze des Baus. Deren Ausführung war einem gewissen Vulca übertragen worden, einem virtuosen Handwerker aus Roms rivalisierender Nachbarstadt Veji. Da von diesem Meisterwerk nichts erhalten geblieben ist,73 hat die moderne Forschung lange an seiner Existenz gezweifelt, bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Veji überlebensgroße Statuen entdeckt wurden, die das Dach eines der Heiligtümer der Stadt geschmückt hatten. Darunter auch der sogenannte ‚Apollon von Veji‘, der großen Einfluss auf die moderne Plastik ausübte und aus der Werkstatt eben jenes Vulca stammen musste, den auch die Machthaber der Urbs beauftragt hatten.
Der römische Tempel verfügte nicht über einen, sondern über drei Kulträume (cellae), deren Grundriss durch die Fundamente des Podiums vorgezeichnet war. Warum drei Gottheiten und nicht eine einzige? Zunächst einmal, weil es in einer polytheistischen Religion wie der römischen die Vorstellung von Omnipotenz nicht gab – wie mächtig ein antiker Gott auch sein mochte, er schaffte nicht alles allein. Außerdem brauchte man einen Ersatz für die alte Göttertrias, welche die Ursprünge der Stadt begleitet hatte. Mars verschwand nicht vollständig, musste sich aber in Zukunft mit einem Nebenaltar begnügen, der, wie es hieß, schon vor Baubeginn des Heiligtums dort gestanden habe, genau wie der Altar des Terminus, des Gottes der Grenzsteine. Quirinus jedoch, als Gott einer inzwischen veralteten städtischen Kurie, trat in den Hintergrund. Von nun an standen Jupiter seine Gemahlin Juno und seine Tochter Minerva zur Seite, und diese Ablösung zweier Götter durch zwei Göttinnen war zweifellos Ausdruck einer stabilisierten, weiblicheren Gesellschaft, in der die sogenannte Kernfamilie an Bedeutung gewann. Die Verehrung der Minerva, in deren Namen das lateinische Wort für Intelligenz (mens) zu erkennen ist, erscheint gleichzeitig wie eine Hommage an den Erfindungsgeist der Handwerker, deren Geschick mittlerweile eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Stadt spielte.
Wo konnte das Vorbild für ein solches Heiligtum liegen? Forscher haben auf Etrurien, auf die Magna Grecia, auf Griechenland, ja selbst auf Kleinasien verwiesen. Doch weder in architektonischer noch in theologischer Hinsicht gibt es eine einfache Antwort auf diese Frage. Wir haben es vielmehr mit einer bunt zusammengewürfelten Innovation zu tun, dem neuartigen Ergebnis einer Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse. Als die Römer nach Abschluss der Arbeiten den vollendeten Tempel, endlich von Gerüsten befreit, auf seinem gewaltigen, hohen Podium erblickten, gab es nichts Vergleichbares im gesamten Zentrum der Halbinsel, weder in Etrurien noch in Latium.74 Erst jenseits des Meeres, auf der griechischen Insel Samos, findet man ein der Hera geweihtes Heiligtum, dessen Fassade die gleichen Dimensionen aufweist. Es waren dies die Jahre, in denen die griechischen Tyrannen, jene den traditionellen Eliten feindlich gesinnten Volksführer, riesige Tempel dieses Typs errichten ließen. Auf Samos, aber auch in Athen, Korinth, Syrakus, Selinunt und Cumae war dies für sie eine Möglichkeit, der einfachen Bevölkerung Arbeit zu geben und gleichzeitig die Macht ihrer Stadt und ihrer Dynastie zu demonstrieren, die sie dauerhaft zu etablieren hofften.
Kaum zwanzig Jahre später entfaltete sich dieses Modell am Ufer des Tibers zu voller Blüte: Der Jupitertempel wurde zum Staatsheiligtum, in dem die Werte der Stadt hochgehalten wurden. Jupiter wurde dort als Optimus und Maximus verehrt. Der erste dieser beiden Begriffe verwies nicht etwa auf seine Qualität als ‚bester Gott‘, wie die allgemein verbreitete Übersetzung vermuten lässt, sondern auf seine Fähigkeit, der Stadt Reichtümer (opes) zu bescheren. Der zweite Begriff hingegen bezog sich auf den Zuwachs an Macht und Territorien, die sich Rom von diesem göttlichen Schutz erhoffte. Und zweifellos hatten diese Superlative auch einen komparativen Aspekt: In einem polytheistischen Denksystem, welches die Existenz von Göttern anderer Völker akzeptierte, implizierten und proklamierten sie die Vormachtstellung des römischen Jupiter gegenüber jenen der umliegenden Gemeinschaften. Vor allem gegenüber dem Jupiter des Latinerbunds, der seit unvordenklichen Zeiten in den Albaner Bergen verehrt wurde. Das war auch der Grund, weshalb die Fassade des römischen Tempels nicht dem Forum zugewandt war, sondern seitlich davon nach Süden wies, wo in der Ferne, aber deutlich sichtbar, am Horizont der magische Berg der Latiner aufragte. Eine topografische Konfrontation mit politischer Aussage:75 In dieser Phase übernahm Rom die Kontrolle über das latinische Heiligtum und organisierte die dort abgehaltenen alten Bundesfeste von Grund auf neu. Bezeichnend ist in diesem Kontext auch die Tatsache, dass das kollektive Gedächtnis der Stadt die Errichtung des Tempels mit dem gleichzeitig erfolgten Namenswechsel des Tarpejischen Berges in Verbindung brachte. Von nun an hieß er Kapitol (Capitolium), angeblich weil man dort im Zuge der Erdarbeiten einen menschlichen Schädel gefunden habe. Wahrscheinlich steckt in dieser Etymologie die Erinnerung an ein tatsächliches Ereignis, schließlich konnten Archäologen am Standort des künftigen Heiligtums eine alte Nekropole nachweisen. Der gefundene Schädel, so hieß es weiter, sei der des Aulus gewesen – ein Wortspiel (Capitolium = caput Auli), das die zweifellos große Bedeutung eines der Vibenna-Brüder in dieser Gegend widerspiegelte. Aber natürlich hegte die römische Obrigkeit ganz andere Absichten, als sie dem Hügel, auf dem sie ihren Staats- und Dynastietempel errichtete, jenen neuen Namen gab, in dem tatsächlich das Wort caput wiederzuerkennen ist. Sie wollte damit ausdrücken, dass der Hügel und sein Heiligtum in Zukunft ‚das Haupt‘ nicht allein der städtischen Hügel, sondern darüber hinaus auch sämtlicher Anhöhen und Gemeinschaften war, die sich der Stärke Roms widersetzen mochten. Die Größe des Bauwerks und der unverkennbare Drang nach Monumentalität, der sich darin manifestierte, waren architektonischer Ausdruck eines Hegemoniestrebens, welches sich auch im neuen Namen des Hügels äußerte, die Artikulation eines Programms, bei dem Stadtplanung und Außenpolitik Hand in Hand gingen. Auf diese Weise stellte die Urbs in ihrer Theologie, in ihrer Toponymie und in ihrer Topografie dem Latinerbund einen selbstsicheren, dominanten Imperialismus entgegen. Was dort erbaut wurde, war nichts anderes als die Kathedrale Roms oder, um einen weniger anachronistischen Vergleich zu wählen, ihr Parthenon. Mit seiner Fertigstellung am Ende des Jahrhunderts, und wahrscheinlich auch schon davor, wurde das Heiligtum zu einem der wichtigsten topografischen Pole der Stadt. Die um 525–500 v. Chr. errichtete vierte Baustufe der Regia – nun mit einem unterirdischen Speicherraum für die feierlichen Riten zu Ehren der Göttin Ops versehen – wandte ihm ihre Fassade zu. Und mehrere besonders feierliche Rituale verknüpften die räumliche Dimension des kapitolinischen Heiligtums mit der städtischen Zeit. So schlug an jedem 13. September, dem Jahrestag der Tempelweihe, der König im Rahmen einer Liturgie, welche die kosmische Erneuerung der Geschicke symbolisierte, einen Nagel in die Wand der Cella der Minerva, wodurch der Tempel selbst zu einem Gedächtnisort wurde und es ermöglichte, die Jahre zu zählen, die seit seiner Errichtung verstrichen waren. Anschließend zog eine Prozession zum Circus Maximus, wo zu Ehren Jupiters Große Spiele (Ludi Magni) abgehalten wurden.
Erste Triumphe
Dem Gott und dem Tempel brachte der römische Herrscher nach erfolgreichen Feldzügen auch seinen Sieg dar. Dies geschah im Rahmen einer glanzvollen Zeremonie, des sogenannten Triumphs, dessen Bezeichnung die Römer aus dem Griechischen übernommen hatten, wo das Wort als ritueller Ausruf zu Ehren des Dionysus verwendet wurde. Dieser linguistische Transfer, der aus phonetischen Gründen nur über den Umweg des Etruskischen erfolgt sein kann, hatte sich auf römischem Boden vollzogen, inmitten des überwältigenden urbanen, festlichen Raums, den die Tarquinier geschaffen hatten. Zog die siegreiche Armee an jenem Tag nicht, unmittelbar nachdem sie die Stadtgrenze der Urbs überschritten hatte, am Tempel des Forum Boarium vorbei, und war dessen Dreiecksgiebel nicht, wie man seit Kurzem weiß, mit einer Terrakotta-Figurengruppe geschmückt, die eben jenen Dionysus und Ariadne zeigte?76 Als könne der grenzenlose Jubel dieses gigantischen Festes dem Gott des Rausches und der Maßlosigkeit nicht fremd sein! Das bedeutet, dass der städtische Raum als solcher zum Entstehen kollektiver Rituale und neuer identitätsstiftender Inhalte beitrug. Der Weg, den sich die siegreiche Armee durch die begeisterte Menge am Straßenrand bahnte, fasste die gesamte Geschichte der Stadt zusammen: Nachdem der Triumphzug durch ein damals mit dem etruskischen Namen Porta Ratumenna bezeichnetes Tor am Fuß des Kapitols das Pomerium überschritten hatte, umrundete er zunächst den Palatin, bevor er sich über die Via Sacra dem Forum näherte, den gewundenen, steil ansteigenden Weg auf das Kapitol (Clivus Capitolinus) nahm und schließlich den Vorplatz des Tempels erreichte. Anders ausgedrückt, der Zug nahm seinen Ausgang dort, wo lange vor den Zeiten der Stadt mit Vieh und Salz gehandelt worden war, umrundete den Hügel, auf dem sich die romuleischen Überlieferungen konzentrierten, verband diese mit dem in der zentralen Talsenke angelegten öffentlichen Raum und endete mit dem Anstieg zum Staatsheiligtum. Alte und neue Stadt verschmolzen durch diese reinigende Prozession, und Vergangenheit und Gegenwart verschmolzen in einem Ritual, das vom Vertrauen der Gemeinschaft in ihr Schicksal kündete.
Das kapitolinische Heiligtum, das sich dort am Ende des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung erhob, war das Ergebnis außerordentlicher gemeinschaftlicher Anstrengungen: Die zweifellos sehr hohen Kosten für den Bau – Titus Livius spricht von vierzig Talenten, was für die damalige Zeit eine gewaltige Summe darstellte – wurden zum großen Teil aus dem Erlös der Eroberung der umliegenden Städte bestritten. Es handelte sich somit um den ersten in einer langen Reihe ‚mit Beute errichteter Tempel‘ (templum e manubiis), der durch seine bloße Existenz ein strahlendes Zeugnis von der Vormachtstellung der Stadt ablegte. Hunderte, wenn nicht gar Tausende ihrer Einwohner haben daran mitgearbeitet, und während der riesige Bau nach und nach in die Höhe wuchs, produzierten die in unmittelbarer Nähe auf dem Hügel eingerichteten Schmelzöfen die Werkzeuge, welche die Arbeiter benötigten. Von weiteren über die Stadt verteilten Öfen, in denen der systematisch im Argiletum, im Velabrum und im Tal des Circus Maximus abgebaute Lehm gebrannt wurde, stiegen dichte Rauchwolken in den Himmel.77 Ganz Rom war eine einzige große Baustelle, wo schwere Ochsenkarren langsam den von Gefangenen auf den Hochebenen nordöstlich der Stadt abgebauten und zu Blöcken behauenen Tuff an die verschiedenen Orte transportierten.
Die Zeiten, in denen die Besiegten sofort in der Urbs angesiedelt und zügig in die Bevölkerung integriert wurden, waren vorbei. Rom brauchte immer mehr Arbeitskräfte, weshalb die Einwohner, selbst wenn sie zur Fronarbeit verpflichtet wurden, nicht länger genügten. Denn durch diese beispiellosen Bauten, in denen sich die Größe der Urbs manifestierte, beabsichtigte die Obrigkeit, ihre Macht im Inneren wie auch nach außen hin zu festigen. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die häufige Verwendung des Begriffs maximus für die wichtigsten öffentlichen Bauwerke.78 Jupiter war natürlich maximus, aber auch der Circus, und die Cloaca, die anzulegen die Römer so viele Mühen gekostet hatte, war ebenso maxima wie die Ara, der dem Hercules geweihte Große Altar auf dem Forum Boarium. Dessen Bezeichnung war zweifellos Ausdruck jener monumentalen Veränderung, die ebenfalls in dieser Zeit an der alten Kultstätte durch Herrscher vorgenommen wurde, die sich gern mit dem Sohn des Zeus-Jupiter verglichen.79 In jenen Jahren sahen die Römer auf dem Dreiecksgiebel des Tempels am Viehmarkt eine Figurengruppe, die Hercules und Athene darstellte, jene Göttin, die den Helden in den Olymp einführt.80 Eine offensichtliche und allen in der Stadt verständliche Anspielung auf den übermenschlichen Status, der dem König aufgrund seiner Macht und seiner Heldentaten gebührte wie einst dem Gott gewordenen Sterblichen.
Eine bevölkerungsreiche Stadt
Ist es möglich, die Größe der Stadt vom heutigen Standpunkt aus in demografischen Begriffen zu fassen? Den Historikern der Kaiserzeit zufolge soll Rom während der Herrschaft des Servius Tullius etwas mehr als 80.000 Einwohner gezählt haben,81 am äußersten Ende des sechsten Jahrhunderts schließlich 120.000 bis 130.000. Bis auf sehr wenige Ausnahmen haben es moderne Forscher abgelehnt, diesen Angaben Glauben zu schenken. Wie unterschiedlich die von ihnen dagegen vorgebrachten Argumente auch sein mochten, letztlich entsprang ihre Ablehnung ein und derselben Ursache: der Überzeugung, dass Rom in der letzten Phase der Königszeit unmöglich schon eine große und mächtige Stadt gewesen sein könne, sondern vielmehr ein kleiner Marktflecken gewesen sei, der in jener Zeit überhaupt erst allmählich den Status einer Stadt erlangte. Doch während die Forschung früher noch darauf angewiesen war, unterschiedliche Hypothesen zur Größe des von Rom kontrollierten Territoriums einerseits mit solchen zur demografischen Gestalt des Siedlungsgebiets andererseits zu kombinieren, stellt die bereits für das sechste Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung belegte Existenz einer durchgängigen Stadtmauer die Diskussion nun auf eine belastbarere Grundlage. Die elf Kilometer lange Mauer der Urbs umschloss ein Gebiet von 427 Hektar. Einer möglicherweise noch einmal zu überdenkenden Argumentation folgend, geht man davon aus, dass sich die tatsächlich besiedelte Fläche auf 285 Hektar beschränkte, denn der Aventin, das Kapitol und das Hafenviertel waren, dieser These zufolge, nicht bewohnt. Schon auf der Grundlage dieser Schätzung kann eine recht einfache Berechnung vorgeschlagen werden – fast zu einfach vielleicht, denn offenbar wurde sie bisher noch nie formuliert!
Der große Etruskologe Jacques Heurgon hat den Versuch unternommen, die Bevölkerungszahl von Roms Nachbarstadt Caere, dem heutigen Cerveteri, zu schätzen.82 Dazu stützte er sich auf die Untersuchung der bekanntermaßen außergewöhnlich gut erhaltenen Nekropolen der etruskischen Stadt. Ausgehend von den Datierungen und der Bevölkerungsdichte, die Archäologen daraus ableiteten, gelangte er zu einer Zahl von 25.000 Einwohnern in der Stadt, deren Fläche im sechsten Jahrhundert v. Chr. 150 Hektar betrug. Auf Rom übertragen, würden diese Zahlen im entsprechenden Verhältnis eine städtische Bevölkerung von 50.000 Einwohnern ergeben (47 500, um genau zu sein). Nimmt man dazu noch die Bewohner des von der Urbs kontrollierten Umlands, erscheint die von antiken Autoren genannte Zahl 80.000 schon weniger unwahrscheinlich. Und man kann sogar versuchen, diese Berechnung noch zu verfeinern! Denn der kategorische Ausschluss von Aventin, Kapitol und Hafenbereich erscheint übertrieben, wenngleich außer Frage steht, dass nicht die gesamte von der großen Mauer umschlossene Fläche besiedelt war. Schon im 18. Jahrhundert hatte der große englische Historiker Gibbon den Grund dafür erkannt: „Diese gewaltige Umwallung mag angesichts der Stärke und Bevölkerungszahl des jungen Staates unverhältnismäßig erscheinen. Es war aber nötig, ein großes Gebiet mit Weide- und Ackerland gegen die häufigen und plötzlichen Einfälle der Volksstämme Latiums, dieser beständigen Feinde der Republik, zu sichern.“83 Selbst unter Berücksichtigung dieser Einschränkung kann man über die allgemein angenommenen 285 Hektar hinausgehen und die tatsächlich bewohnte Fläche der Stadt im sechsten Jahrhundert auf etwa 350 Hektar ansetzen. Anhand der durch das Beispiel Caeres gelieferten Berechnungsgrundlage käme man somit auf eine Bevölkerung von nahezu 60.000 Einwohnern. Mit anderen Worten, die in der antiken Überlieferung genannte Zahl könnte tatsächlich eine verlässliche Größenordnung liefern. Vorausgesetzt natürlich, man bezieht sie auf die Gesamtbevölkerung und nicht allein auf den wehrfähigen Teil der Einwohnerschaft.
Einige Jahrzehnte später, ganz am Ende des sechsten Jahrhunderts, soll die Bevölkerungszahl denselben antiken Autoren zufolge noch einmal um 40.000 bis 50.000 Personen höher gelegen haben. Will man ein solches demografisches Wachstum nicht der Entwicklung zuschreiben, die sich in den geschilderten intensiven städtebaulichen Aktivitäten des zurückliegenden halben Jahrhunderts widerspiegelt, kann man vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt eine Bevölkerungsgruppe in die Zählung einbezogen wurde, die bislang noch nicht berücksichtigt worden war. Anders ausgedrückt, entweder ist die römische Bevölkerung intra muros innerhalb weniger Jahrzehnte um die Hälfte angewachsen, was recht unwahrscheinlich ist, oder man hat deren Definition ausgeweitet. Und wurden nicht tatsächlich am Ende der Königszeit die vier städtischen Tribus um die ersten ländlichen Tribus ergänzt? Jedenfalls können die von antiken Autoren genannten Zahlen nicht mehr von vornherein verworfen werden. Sie bestätigen vielmehr den Rahmen, den die Archäologie, unbeeinflusst von jeglicher Manipulation durch literarische Überlieferungen, rekonstruiert. Rom war, nach den Maßstäben jener Zeit wohlgemerkt, eine große Stadt, mächtig dank ihrer zahlreichen Einwohner, bevölkerungsreich dank ihrer großen Macht. Ihre Bevölkerung muss auf mindestens 40.000 bis 50.000 Personen geschätzt werden, die wahren Zahlen liegen zweifellos deutlich höher. Zum Vergleich sei daran erinnert, dass Caesar 52 v. Chr. bei der Eroberung von Avaricum, dem heutigen Bourges, dessen Einwohnerzahl auf 30.000 bezifferte.84 Und das königszeitliche Rom war deutlich größer und folglich auch deutlich bevölkerungsreicher als die wohlhabende gallische Stadt, deren Fläche nicht über einige Dutzend Hektar hinausging.
Wie aber war es möglich, dass Historiker, die über 400 Jahre nach der Zeit der Könige schrieben, sich daran noch erinnern konnten? Die Antwort auf diese Frage liegt in der von König Servius eingeführten Volksschätzung (Census).85 Die Ergebnisse der auf dem Marsfeld durchgeführten Zählung, bei der jeder Römer seinen Besitz und auch die Zusammensetzung seiner Familie angeben musste, wurden später in Dokumenten, in den berühmten Zensuslisten, festgehalten und blieben so bis zu den kaiserzeitlichen Geschichtsschreibern bewahrt, welche die Angaben bei ihren Vorgängern kopierten. Auch im religiösen Gedächtnis der Stadt hatten sich Riten und besondere Opfer erhalten, welche die Familien bei jeder Geburt und jedem Todesfall zelebrieren mussten. Dank der im ersten Fall beim Altar der Iuno Lucina (‚Lichtspendende Juno‘) auf dem Esquilin und im zweiten vor dem Altar der Laverna auf dem Aventin vollzogenen Rituale war die römische Obrigkeit zumindest annähernd in der Lage, die Entwicklung der Bevölkerung nachzuvollziehen.86
Erste öffentliche Dokumente
Und die Obrigkeit vollzog diese Entwicklung nicht nur nach, sie hielt sie auch fest, denn im sechsten Jahrhundert v. Chr. hatte in Rom die Schrift Einzug gehalten. Dafür lieferte Ende des 19. Jahrhunderts die Entdeckung einer Inschrift unter dem sogenannten Schwarzen Stein (Niger Lapis) den unumstößlichen Beweis.87 Auf dem Volcanal, der Kultfläche am Rand des Versammlungsplatzes (Comitium), wo unter freiem Himmel der Gott Vulcanus verehrt wurde, stand inzwischen neben einem Altar mit Votivgrube auch ein Cippus aus Veji-Tuff. In diesen Stein wurde in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts eine Inschrift eingraviert, die heute nur noch lückenhaft erhalten ist, da der obere Teil der Stele fehlt. Die senkrechten, in alternierender Richtung eingemeißelten Zeilen hatten offensichtlich eher magische als praktische Funktion. Wie es später in antiken Heiligtümern üblich werden sollte, verkündeten sie rituelle Verpflichtungen, die mit diesem heiligen Ort verknüpft waren. Zwei Wörter lassen sich noch relativ leicht entziffern: rex und kalator, also die Bezeichnungen für den König und seinen Herold, dessen Aufgabe es war, den Römern die Einberufung der Kurienversammlung zu verkünden. Die wiederum auf dem angrenzenden Comitium stattfand … Jahrhunderte später erwähnte der Geschichtsschreiber Dionysios von Halikarnassos mehrmals ‚Inschriften in griechischen Buchstaben‘ an diesem Ort, die sich ihm zufolge einmal auf Romulus, einmal auf dessen Ziehvater und schließlich auf einen seiner Gefährten bezogen – drei Texte, bei denen es sich in Wahrheit um einen einzigen handelte,88 was er jedoch nicht wissen konnte, da die Inschrift zu seiner Zeit bereits verschwunden war. Im Zuge der von Sulla angeordneten Bauarbeiten wurde das archaische Heiligtum dem Erdboden gleichgemacht, seine Überreste begraben und durch eine schwarze Pflasterung gekennzeichnet, jenen Niger Lapis, mit dem die Stelle heute in der modernen Forschung bezeichnet wird.
Doch bei dem vermeintlichen Griechisch, das die römischen Historiker später nicht mehr zu deuten wussten, handelte es sich in Wirklichkeit um Latein! Allerdings in einer viel zu alten Sprachstufe, als dass man es in der klassischen Epoche noch als solches hätte erkennen können. Eine umso bemerkenswertere Tatsache, als wir uns hier im Herzen des öffentlichen Zentrums jenes königszeitlichen Roms befinden, das viel zu oft noch unbeirrt als etruskisch bezeichnet wird. Sowohl im Alltag als auch bei den feierlichsten Anlässen sprach die Urbs weiterhin Latein. Das bestätigen auch weitere Inschriften, diesmal aus dem privaten Bereich, wie etwa die berühmte sogenannte Duenos-Inschrift auf einem Gefäß, das in einem Votivdepot auf dem Quirinal entdeckt wurde.89 Zwar findet man gelegentlich auch etruskische oder sogar griechische Inschriften auf Geschirr, doch in solchen Fällen handelt es sich lediglich um den Namen des Besitzers oder des Handwerkers, der das Gefäß hergestellt hat, und diese kommen zudem sehr viel seltener vor. Auch im öffentlichen Raum hatten die Römer an mehreren Stellen Inschriften vor Augen, insbesondere in den Heiligtümern – als gehört die Schrift, dieses noch junge Kommunikationsmittel, in die Sphäre des Sakralen. Im Dianatempel auf dem Aventin schilderte eine Bronzestele die Einzelheiten der mit dem Altar verbundenen Rituale. Und in dem Tempel, den der letzte Tarquinier dem Gott des Eidschwurs, Semo Sancus, auf dem Quirinal errichtet hatte, gab eine Inschrift auf einem Schild den Text eines Vertrags zwischen dem König und der nahe gelegenen Stadt Gabii wieder. Beide Inschriften sollte auch der Geschichtsschreiber Dionysios noch sehen (4, 26 und 58) und Erstere für Griechisch halten. Anderthalb Jahrhunderte vor ihm hatte einer seiner illustren Vorgänger, der große Polybios, noch einen Text abschreiben können, der in der Nähe des Kapitolinischen Tempels aufbewahrt wurde und aus der Zeit der frühen Republik stammte, wie man ihm sagte. Heute jedoch weiß man, dass er tatsächlich schon während der Tarquinier-Dynastie entstand. Es handelte sich dabei um einen Nichtangriffspakt, in dem sich Rom und Karthago gegenseitig verpflichteten, den jeweiligen Einflussbereich, nämlich Latium und die nordafrikanische Küste, zu respektieren. So waren die künftigen Erzfeinde, die sich in den Punischen Kriegen unversöhnlich gegenüberstehen sollten, in jener Zeit noch durch ein Bündnis geeint, das sie sogar zwei Mal erneuerten! Dieses Abkommen, das uns römische Schiffe zeigt, die in der Lage waren, nach Sizilien, ja sogar Afrika zu fahren, wäre für sich genommen schon Beweis genug für die inzwischen erlangte Macht der Stadt am Tiberufer.90
Ein erwachsener Organismus
Rom war in jenen Tagen also mitnichten jene mittelgroße Stadt, als die sie noch allzu oft beschrieben wird, sondern ein Gemeinwesen mit bereits ausgeprägter internationaler Strahlkraft, das offenbar kurz davorstand, sämtliche umliegenden Rivalen zu unterwerfen, deren mächtigster, Veji, flächenmäßig beinahe doppelt so groß war.91 Sie war kein Neugeborenes mehr, wie man glaubte, als man ihr Entstehen noch allein den Etruskern zuschrieb, nicht einmal eine Jugendliche, sondern eine junge, vollständig ausgebildete Erwachsene. Ein reformiertes System zur Integration und Organisation einer wachsenden Bevölkerung, öffentliche Bereiche für gemeinschaftliche Debatten, ein weitläufiges Siedlungsgebiet, eine Wehrmauer allererster Ordnung, ein bedeutendes Staatsheiligtum, die Fähigkeit, sämtliche Energien zu mobilisieren – ja, Rom verfügte tatsächlich über alle Charakteristika eines voll entwickelten Staates (bei denen es sich in jener Zeit immer um einzelne Städte handelte)! Und wie jede Erwachsene erinnerte sie sich mit wachsender Begeisterung ihrer Kindheit: Aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr., vielleicht sogar vom Ende des siebten, stammen die ersten Anzeichen für eine Monumentalisierung von Orten, die mit den Ursprüngen der Stadt in Verbindung standen. Auf dem Palatin wurden einige Hütten des Germal-Dorfes durch Hinzufügung von Altären in Kultplätze umgewandelt, die der Erinnerung geweiht waren. Das Gebäude der sogenannten ‚alten Kurien‘ (Curiae Veteres) am entgegengesetzten (nordöstlichen) Ende des Hügels wurde ebenso zu einer mit dem Namen Romulus verbundenen Gedenkstätte wie das Comitium und das Heiligtum des nunmehr mit dem griechischen Hephaistos gleichgesetzten Gottes Vulcanus auf dem Forum.92 Der Baum der Gründungssage, die Ficus Ruminalis beim Lupercal, wurde auf dem Comitium unter dem Namen Ficus Navia dupliziert, weil das Volcanal, wo sich inzwischen die Opfergaben häuften (darunter die Bronzestatuette eines Auguren mit seinem rituellen Stab), als der Ort galt, an dem der erste König während einer Sitzung des Senats entrückt worden sei. Verorteten andere Legenden sein Verschwinden stattdessen beim Ziegensumpf auf dem Marsfeld? Es hat ganz den Anschein, als hätten die Römer den Namen des Gründers ihrer Stadt mit den beiden Orten verbinden wollen, an denen sie ihre Versammlungen (comitiae) abhielten, denen jedes Mal das Einholen der Auspizien vorausging:93 dem Comitium, wo die Kurien zusammentraten, und dem Marsfeld, dem Versammlungsplatz der Zenturien. So wurde der fundamentale Charakter jenes Aktes betont, der darin bestand, zusammenzukommen und gemeinsam über die Belange der Allgemeinheit zu beraten. Die Vergangenheit wurde nicht um ihrer selbst willen gefeiert, sie stand, wie es in der Urbs stets der Fall sein sollte, im Dienst der Gegenwart: Die Duplikation der wichtigsten Stätten des kollektiven Gedächtnisses begleitete und ermöglichte auf symbolische Weise die Expansion der Stadt.94
Am Ende der großen Verwandlung, die das sechste Jahrhundert in Rom mit sich brachte, wies die Stadt also bereits mehrere grundlegende Merkmale auf, die sie auch in der Folge kennzeichnen sollten: ein durch umfangreiche Baumaßnahmen verändertes natürliches Terrain, eine stetig wachsende pluriethnische Bevölkerung sowie einen klar abgegrenzten, privilegierten und durch ein engmaschiges Netz aus gemeinschaftlichen Orten, Feiertagen und identitätsstiftenden Symbolen gewissermaßen sakralisierten städtischen Raum. Zunehmend griffen alle Entwicklungen ineinander: Die wachsende Konzentration von Menschen und ihr Rivalisieren um Macht und Prestige lockten von überallher Handwerker und Kaufleute in die Stadt, die technische Entwicklungen und neue Ideen vorantrieben, welche ihrerseits wiederum die Anziehungskraft der Urbs steigerten. Auf allen Gebieten war die Stadt Keimzelle von Innovationen, die sowohl technischer Natur sein konnten, wie etwa beim Bau mit Werk- und Backstein, als auch im sakralen Bereich angesiedelt waren, wo die archaische Religion der anonymen, in Gruppen auftretenden Gottheiten wie der Laren, der Manen und der Penaten von anthropomorphen Göttern mit Statuen und Tempeln abgelöst wurde. Und der Einfluss der Urbs war nun auch immer weiter über ihre Grenzen hinaus spürbar. In ganz Latium entstanden Heiligtümer, die in verkleinertem Maßstab den dreiteiligen Grundriss des Kapitolinischen Tempels nachahmten, und genau wie die Wohnhäuser der lokalen Adligen schmückten sich diese Bauten mit Terrakottafiguren aus den römischen Werkstätten, die ebenfalls einen Teil des bei den Banketten genutzten Geschirrs lieferten.95
Als Zentrum dieses beschleunigten Wandels war Rom starken Spannungen ausgesetzt, die den sozialen und politischen Zusammenhalt bedrohten. Die Beziehungen zwischen König, Aristokratie und Volk waren komplex und instabil, umso mehr als der Zugang zum Thron nicht durch eine klare Nachfolgeregelung definiert war. Bislang hatte der König als alleiniger Herrscher regiert, und das Volk sah ihn oft auf der Via Sacra mit den von jenseits des Tibers stammenden Insignien der höchsten Macht, der purpurnen Toga, der goldenen Krone und dem elfenbeinernen Zepter, begleitet von Priestern und Würdenträgern und eskortiert von seinen Liktoren, jenen Leibwächtern, die ihr Beil in einem Rutenbündel trugen. Doch bald schon sollte er nicht mehr da sein, denn die Zeit der Freiheit nahte und mit ihr die Zeit der Krisen.