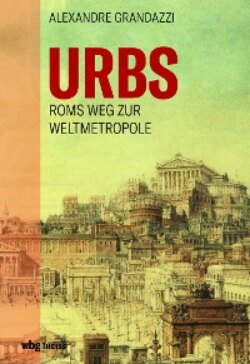Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 15
6 Die erste Brücke
ОглавлениеÜber den Fluss
Entstanden aus den Vorzügen, aber auch aus den Zwängen außergewöhnlicher natürlicher Gegebenheiten, zeigte sich die junge Stadt immer entschlossener, Erstere zu nutzen und Letztere so weit wie möglich zu reduzieren. Und der Tiber, der ihre Hügel säumte und zweifellos in jener Zeit den alten latinischen Namen Albula verlor, war Vor- und Nachteil zugleich: Sein Wasser und sein Tal machten ihn zu einer hervorragenden Kommunikationsachse von Nordost nach Südwest, unterbrachen aber gleichzeitig die Landwege von Nordwest nach Südost, zwischen den reichen Territorien Etruriens und Kampaniens. Bislang hatte sich die neue Urbs damit abgefunden, war ihr dieses Hindernis doch gleichzeitig ein Schutzwall gegen mögliche Feinde aus dem Norden. Wer den Fluss überqueren wollte, nahm eine Fähre, die ein Stück unterhalb der Tiberinsel in der Flusskehre eingerichtet worden war, wo die Strömung durch den Richtungswechsel gebremst wurde. Und zuweilen war auch die Furt passierbar, was jedoch stets mit Schwierigkeiten und Gefahren verbunden war.1 Inzwischen war die Stadt nicht länger bereit, ihren Aktionsradius durch die Natur begrenzen zu lassen, und so genügten ihr diese altmodischen, unzuverlässigen und unsicheren Überquerungsmöglichkeiten nicht mehr. Daher baute man eine Brücke, die erste auf römischem Boden, um eine unkomplizierte, dauerhafte und witterungsunabhängige Verbindung zwischen den Flussufern zu schaffen.
Für die Römer jener Zeit und alle, die ihnen folgen würden, war der Tiber allerdings nicht nur ein Fluss, sondern eine Gottheit: Ihn durch eine Brücke dem Willen der Stadt zu unterwerfen, ihm gewissermaßen ein Joch anzulegen, könnte diesen Gott ernsthaft beleidigen und seinen Zorn in Gestalt zerstörerischer Überflutungen heraufbeschwören. Deshalb musste der Bau der Brücke von eigens zu diesem Zweck berufenen Priestern beaufsichtigt werden, von den Pontifices, den ‚Brückenbauern‘. Und sicherten diese Priester nicht auch die Kommunikation zwischen den Sterblichen und den Unsterblichen – bildeten gewissermaßen ‚eine Brücke‘?2 So wurde die neue Konstruktion über den Tiber mit einer ganzen Reihe von Tabus belegt.3 Als Material durfte ausschließlich Holz verwendet werden, nicht ein einziges Stück Metall. Eine religiöse Vorschrift, die der Grieche Dionysios von Halikarnassos nicht mehr verstand und als simple technische Vorsichtsmaßnahme interpretierte, die im Fall einer feindlichen Invasion die Zerstörung des Bauwerks erleichtern solle. An beiden Enden der Brücke mussten sowohl die Pontifices als auch die Salier regelmäßig religiöse Rituale abhalten. Wenn der Bau aus irgendeinem Grund – Unwetter, Hochwasser, Abnutzung – ausgebessert oder erneuert werden musste, oblag es den Pontifices, darauf zu achten, dass das Ergebnis mit der ursprünglichen Brücke identisch blieb und es keinerlei Veränderungen oder Erweiterungen gab. Von diesem Tag an war dieser ‚hölzerne‘ Pons Sublicius, genauer gesagt die Brücke ‚mit den hölzernen Dübeln‘, zur Heiligen Brücke Roms. Auf hohen Pfählen ruhend, um den Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen, war sie für die Römer von Beginn an ein konstituierendes Element jener neuen Stadtlandschaft, die nach und nach vor ihren Augen Gestalt annahm. Da sie aus vergänglichem Material gefertigt war, hat die Brücke keinerlei archäologische Spuren hinterlassen, doch die Überlieferung, die ihren Bau in das siebte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiert, kann nicht ernsthaft angezweifelt werden.
Dem Meer entgegen
Dies umso weniger, als Eroberungen ihres Erbauers, König Ancus Marcius, die Errichtung der Brücke indirekt bestätigen:4 Denn diese betreffen allesamt kleine Siedlungen entlang des Flusses stromabwärts von Rom. Der Bau der ‚Heiligen Brücke‘5 erwies sich für die Urbs als Voraussetzung für die Ausdehnung ihres Machtbereichs in Richtung Meer und für die Kontrolle über die Küstenregion. In diesem Zusammenhang ist es kein Zufall, dass der vierte König von Rom auch als der Gründer von Ostia gilt, ermöglichte dies der Stadt doch nicht nur, sich gegen Überraschungen von der Seeseite her zu wappnen, sondern gleichzeitig auch die Produktionsstätten des kostbaren Salzes zu beherrschen. Archäologische Zeugnisse dieses königszeitlichen Ostia wurden allerdings bisher noch nicht gefunden. Doch ein neuer Hinweis liefert uns nun vielleicht zum ersten Mal eine Spur: Um darauf zu stoßen, musste man die Perspektive wechseln, den Blick nach Gallien und auf jene Legenden richten, welche die Gründung Marseilles Auswanderern aus Kleinasien zuschreiben. Einem späteren Text zufolge sollen diese Seefahrer während ihrer Reise an der Tibermündung Halt gemacht haben, wo sie Vertretern der römischen Obrigkeit begegnet seien.6 Lange ging man davon aus, dass diese Berichte jeder historischen Glaubwürdigkeit entbehren, doch seit vor rund zwanzig Jahren im Untergrund der großen gallischen Siedlung Strukturen zum Vorschein gekommen sind, die unzweifelhaft archaischen Ursprungs und griechischer Machart sind, beginnt man, sie mit anderen Augen zu lesen. Denn die archäologische Bestätigung sowohl der Datierung als auch der Ursprünge Marseilles erfordern, wie jüngst betont wurde,7 eine Neubewertung sämtlicher diesbezüglicher Überlieferungen. Und auch die Existenz eines königszeitlichen Ostia wird umso wahrscheinlicher, als sie wie die logische Folge des Baus der hölzernen Brücke in Rom anmutet. Was die kleinen, von der Urbs eroberten Ortschaften zwischen der Brücke und dem Meer betrifft, etwa Ficana oder Politorium, so erinnerte man sich in Rom daran, dass deren Einwohner – nachdrücklich! – aufgefordert worden seien, sich auf dem Aventin niederzulassen:8 Bot dieser weitläufige Hügel nicht reichlich Möglichkeiten zur Ansiedlung und lag zudem nahe der neuen Brücke, also unmittelbar an jenem Wasserweg, über den die Eroberungen erfolgt waren? Wieder einmal sorgte diese erzwungene Einwanderung für ein endgültiges Ausbluten der unterworfenen Orte und steigerte in gleichem Maße die demografische Bedeutung Roms, mithin seine gegenwärtige und künftige Macht. Zudem erlaubte es die hölzerne Brücke, jene Handelsströme auf römisches Gebiet umzulenken, die sonst vielleicht die stromabwärts gelegene Furt von Ficana oder die stromaufwärts gelegenen Furten von Fidenae beziehungsweise dem noch weiter entfernten Crustumerium genutzt hätten. Indem die Urbs auf diese Weise nicht allein durch die Vorzüge ihrer Lage, sondern auch durch bauliche Einrichtungen zur ‚Stadt der ersten Brücke‘ wurde, demonstrierte sie ihren Anspruch auf eine Vormachtstellung in ganz Latium, dessen Eliten und Reichtümer sie zunehmend anzog. In dieser Phase müssen auch einige befestigte Siedlungen im näheren Umland ihre Unabhängigkeit verloren haben und von Rom einverleibt worden sein, die bis heute nicht näher bestimmt sind.9
Eine neue Grenze
Auf römischem Boden führte der Bau der Heiligen Brücke nicht nur indirekt zur Integration des Aventins in das Stadtgebiet, die Stadt übernahm nun auch endgültig die Kontrolle über die Anhöhen am gegenüberliegenden Ufer. Zwar war sie dort auch vorher schon präsent gewesen, doch die Sieben Landbezirke (septem pagi) waren bislang ein dem Einfluss Vejis entrissener isolierter Landstrich.10 Nun jedoch musste der gesamte Höhenzug längs des rechten Ufers unter römische Herrschaft gebracht werden, sollte die Brücke nicht zur tödlichen Gefahr werden – und dazu war sie nicht gedacht! Die Errichtung einer Befestigung auf den Hügeln am rechten Flussufer, welche die antiken Texte ebenfalls Ancus Marcius zuschreiben, war somit die logische und notwendige Folge des Brückenbaus, und die nunmehr befestigten Anhöhen wurden somit zur neuen Westgrenze der Stadt. Nachdem sie zuvor als Abschnitt der Vatikanischen Berge (Montes Vaticani) betrachtet worden waren, konnte nun der Name Ianiculum auf sie übergehen, den bis dahin eine der Hügelkuppen des Saturnischen Berges getragen hatte.11 Vom Ort, der die Urbs von ihren etruskischen Feinden und vom Fremden schlechthin trennte, wurden sie gewissermaßen zur Tür (ianua), die der Stadt den Weg in die Ferne öffnete: Ianiculum. Mehrere Kultstätten – der Bona Dea, dem Gott der Grenzen Terminus, der Juno und dem Hercules geweiht – zeugten von der römischen Inbesitznahme dieses neuen Territoriums, dessen zahlreiche Quellen insbesondere in Gestalt der Gottheiten Furrina und Fontus verehrt wurden. Und so wurde dieser Landbezirk, der Pagus Ianiculensis, ein Teil von Rom.12 Durch den Bau der Heiligen Brücke hatte die Stadt eine dauerhafte Verbindung zur Außenwelt geschaffen und eine neue Phase ihrer Geschichte eingeleitet. Als verspürte sie am Ausgang ihrer Kindheit einen unbezähmbaren inneren Drang nach Entdeckungen, nach Eroberung, in die Fremde.
Letzte Menschenopfer?
Ein im Zuge archäologischer Forschungen entdecktes Phänomen kann als Beleg für diese neue gemeinschaftliche Dynamik gewertet werden. Bislang waren Bau oder Abriss wichtiger infrastruktureller Elemente wie etwa der Palatinmauer und des Königspalasts oder auch die Pflasterung des Forums von Menschenopfern begleitet gewesen. Und in eben diesem Bereich lässt sich auch eine der letzten Manifestationen dieses fürchterlichen Rituals beobachten. Denn an einer als Doliola (‚kleine Gefäße‘) bezeichneten Stelle hielt sich noch bis ans Ende der republikanischen Zeit die Erinnerung an eine geheiligte Begräbnisstätte, wo es Varro zufolge und wie in solchen Fällen üblich verboten war, auszuspucken.13 Tatsächlich wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Einmündung des Velabrums ins Forum ausgehöhlte Steinblöcke gefunden, von denen einer noch kleine Gefäße enthielt, die in die Jahre 675 bis 650 v. Chr. datierbar waren und dort offenbar im Zusammenhang mit der zweiten Pflasterung des Platzes deponiert wurden. Möglicherweise handelte es sich um sterbliche Überreste, die bei den Erdarbeiten gefunden wurden und für die man, um jedes Sakrileg zu vermeiden, einen heiligen, mit Opfergaben versehenen Ort anlegte. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Niederlegung dieser Gefäße Teil eines Opferrituals war, analog zu jenem, das fast genau an derselben Stelle das erste Pflastern begleitet hatte und dessen archäologische Spuren in den bereits erwähnten Skeletten erhalten blieben.14 Aber diese Opferung eines oder mehrerer Menschen scheint die ein Jahrhundert zuvor beim Bau der palatinischen Mauer begonnene Serie zumindest vorläufig beendet zu haben. Das Pflaster des Forums, der palatinische Mauerring oder der Königspalast mochten noch später erneuert worden sein, aber wie bedeutsam diese Entwicklungen auch waren, sie vollzogen sich fortan ohne menschliches Blutvergießen. Als gehörte die erste Phase, in der sich die neue Welt dieses öffentlichen Raums herausgebildet hatte, nunmehr der Vergangenheit an, und als sei die Stadtlandschaft drei Generationen nach ihrer ersten Anlage inzwischen zur Normalität geworden. Natürlich waren die Menschenopfer, die auch das Entstehen des Ortes namens Doliola begleitet haben müssen, nicht die letzten auf römischem Boden, doch fortan war die zwangsläufige Verbindung von größeren Baumaßnahmen mit diesem blutigen Ritus offenbar unterbrochen: Auf die Zeit des Neubeginns und der tiefgreifenden Umbrüche folgte nun die Ära urbaner Kontinuität.
Materialien, Techniken, Baumaßnahmen: die Zeit der Innovationen
Auch die umfangreichen Arbeiten, die um die Mitte des siebten Jahrhunderts die königliche Residenz auf dem Forum in einen veritablen Palast mit einer nahezu dreißig Meter langen Fassade verwandelten, forderten keine Menschenopfer mehr. Die Portikus und der Hof des Gebäudes wurden erheblich vergrößert, und jenes kleine Heiligtum, in dem man möglicherweise den bis zum zweiten vorchristlichen Jahrhundert unveränderten Altar der Laren (Aedes Larum) vermuten muss, wurde an einer Seite verändert.15 Zum ersten Mal in der römischen Geschichte wurden hier zur Errichtung eines Gebäudes Materialien verwendet, die durch Menschenhand geformt waren: Die Mauern bestanden aus behauenem Stein und die Dächer aus Ziegeln. Damit hielt jene schützende Dachbedeckung nur eine Generation nach ihrer Erfindung in Korinth auch im zentralen königlichen Viertel der Urbs Einzug. Und die Erbauer des Palastes fanden alles, was sie benötigten, in ihrer unmittelbaren Umgebung. Der Tuff stammte unverkennbar von den Höhen des Palatins oder des Kapitols, wo um diese Zeit der Abbau des Gesteins einsetzte, und Lehm lieferten die Tongrube (Argiletum) beim Forum sowie das Velabrum in großen Mengen und in hervorragender Qualität.16
Etwa zur selben Zeit wurde auch jenes Gebäude neu errichtet, das aufgrund seiner Nähe zum Vesta-Tempel als eine Art Sakristei identifiziert werden kann, in der sich – auch wenn sie wahrscheinlich nicht dort lebten – die Frauen aus der königlichen Familie versammelten, die den Kult der Göttin versahen. Nicht weit von dort entfernt wurde im Bereich des Comitium und des etwas höher gelegenen kleinen Heiligtums des Vulcanus eine neue Pflasterung verlegt, und offenbar errichtete man gleichzeitig auch, wenn schon kein Podium, so doch zumindest einen speziellen Ort, von dem aus sich jemand an die versammelte Menge richten konnte: Jemand, bei dem es sich in jener Zeit nur um den König oder einen seiner Unterstützer im Senat gehandelt haben kann.17 Doch all diesen Bauten war keine lange Existenz beschieden: Um 640 v. Chr. trat der Tiber erneut über die Ufer, und ein ungewöhnlich starkes, lang anhaltendes Hochwasser verwüstete das Forumtal, vor allem den Bereich, in dem später das dreieckige Gebäude stehen sollte, das man bislang für die ursprüngliche Regia hielt, das jedoch in Wirklichkeit nur eine Erweiterung davon war. Nachdem sich das Wasser wieder zurückgezogen hatte, wurde das Gelände freigeräumt, und man entsorgte die Trümmer der zerstörten Hütten in zwei ovalen, sorgsam mit Lehm verschlossenen Gruben. Darüber befestigte man den nackten Boden mit Kies, und an dem Wasserlauf, der die Fläche säumte, wurde, zum Zeichen dafür, dass die Allgemeinheit diesen Raum für eine öffentliche und zweifellos religiöse Nutzung bestimmte, ein Steinblock aufgestellt.18
Der über dem Tal aufragende Palatin war vor solchen Unbilden geschützt und blieb daher auch weiterhin dicht besiedelt, wovon unzählige Scherben zeugen. Viele davon wurden in jüngster Zeit sowohl im nordwestlichen Bereich gegenüber der Velia als auch im südwestlichen Teil des Hügels hoch über dem Fluss gefunden.19 Dort war das sogenannte Germal-Dorf nach wie vor bewohnt, auch wenn die empfindlichen Hütten in regelmäßigen Abständen durch neue, bald größere, bald kleinere Nachfolger ersetzt wurden.20 Im Laufe der ersten Jahrhunderthälfte war genau an der Ecke des Hügels eine große rechteckige Hütte errichtet worden. Gehörte sie dem Anführer des Dorfes? Oder handelte es sich um eine gemeinschaftliche Einrichtung, um eine Kurie etwa?
Selbst wenn wir die Antwort auf diese Frage ebenso wenig kennen wie die auf viele andere, bleibt festzuhalten, dass sich die Entwicklung der Stadt unvermindert fortsetzte. Die Zahl der Bauten wuchs, obwohl vor allem auf den Hügelkuppen und in der Peripherie immer noch zahlreiche Grünflächen die zunehmend geschlossene Siedlungsdecke unterbrachen. Dabei handelte es sich um heilige Haine, deren Namen häufig an ihre ursprüngliche Vegetation erinnerten und die aufgrund der dort zelebrierten Kulte noch lange erhalten bleiben sollten.21 So gab es in jener Zeit auf römischem Boden noch zahlreiche kleine Wälder: einen Lorbeerwald auf dem Aventin, Eichen auf dem künftigen Caelius, Buchen auf dem Fagual, Myrten in der Talsenke zwischen Palatin und Aventin und zwei weitere Haine unbekannter Arten auf den beiden Kuppen des Saturnischen Berges. Noch jahrhundertelang behielten verschiedene Gottheiten zumindest einen Teil des heiligen Hains, dem sie ihren Namen gegeben hatten, so etwa Vesta auf dem Forum, Furrina auf dem Ianiculum, die Camenae am Fuß des Caelius und Strenia im Bereich der Carinae am Ende der Via Sacra. Anderswo jedoch schüttete man die Straßen der jungen Stadt, oftmals alte Wege, die an den Wasserläufen entlangführten und jedes Jahr von mehr Menschen genutzt wurden, mit Schotter aus Tuffstein auf.22
Obwohl Bürger der Urbs, waren fast alle Römer zugleich auch Bauern, die außerhalb der Stadt Land bestellten: Jeder von ihnen verfügte über eine Parzelle von zwei sogenannten Iugera (bina iugera), was in etwa einem halben Hektar entsprach. Genug, um davon eine vierköpfige Familie zu ernähren – die einhelligen Aussagen zu diesem Punkt in den alten Quellen wurden zu Unrecht angezweifelt.23 Im Stadtgebiet lag bei den einzelnen Hüttengruppen immer noch ein Stück Land für das Vieh. Zumeist handelte es sich dabei um Schweine, die, weil sie leicht zu halten waren, Abfälle fraßen und sich stark vermehrten, immer größeren Anteil am Speiseplan der Römer hatten.24 Ohne sie hätte sich die städtische Bevölkerung sicher nicht so effizient ernähren und damit die Stadt nicht derart wachsen können. Dessen waren sich die Römer fraglos bewusst, und so ließen sie ihren großen Vorfahren Aeneas im ‚Nationalepos‘ bei seiner Ankunft in Latium auf „eine mächtige Sau“ treffen, „auf dem Boden liegend zwischen dreißig Frischlingen, die sie warf“ (Vergil, Aeneis 8, 43–45).
Im Umland entstanden neue Kulturen, insbesondere Weinberge. Die Landschaft veränderte sich und nahm allmählich jene Gestalt an, die sie über Jahrtausende hinweg bewahren sollte. Und der Wein gelangte erst auf die Tafel der Götter, ehe er auch die der Menschen erreichte. Das Geschirr und die Trinkgefäße aus Ton zeigten inzwischen eine größere Vielfalt an Formen und Dekors: Sie wurden nun nicht mehr ausschließlich von den Frauen der Familie per Hand hergestellt, sondern zu einem immer größeren Teil auch von Spezialisten, von denen sich einige in der Stadt niederließen und die mit einem neuen Verfahren, der Töpferscheibe, arbeiteten. Denn mit dem zunehmenden Tauschhandel, den die Heilige Brücke ermöglichte, trat das alte Ideal der Autarkie, demzufolge jeder Haushalt alles, was er zum Leben benötigte, selbst herstellen sollte, mehr und mehr in den Hintergrund. Und diese Töpfer waren sicher nicht die einzigen Handwerker in der Stadt: Schließlich hatte bereits der Bau der Heiligen Brücke die Mitwirkung erfahrener Zimmerleute erfordert, die in der Lage waren, das beste Holz auszuwählen, den passenden Moment für das Fällen zu bestimmen und die Stämme anschließend so zu sägen und zusammenzusetzen, dass sie einen mehr als hundert Meter langen künstlichen Weg über den Fluss bildeten.
In der Stadt begannen die im Senat versammelten Aristokraten sich Wohnhäuser nach dem Vorbild der Residenz ihres Königs bauen zu lassen. Auf dem Palatin, der Velia und dem Forum kamen Lehm und Stein zum Einsatz, und manche Bauten auf dem Heiligen Hügel waren mit Zisternen ausgestattet – den ersten dieser Art in Rom –, die teils als Regenwasserspeicher, teils als Vorratskammern genutzt wurden. Weil die Verwendung dieser Materialien und die entsprechenden Techniken ein Mindestmaß an Kompetenz und kollektiver Organisation erforderten, setzten sie die Existenz regelrechter Zünfte voraus: jener Collegia Opificum, deren Gründung später auf anachronistische Weise dem guten König Numa zugeschrieben werden sollte. Bei ihren letzten Wohnstätten, den Gräbern, hingegen zeigten sich die Angehörigen der Aristokratie mittlerweile weniger freigebig, im Gegensatz zu ihren Vorfahren, die stets mit zahlreichen Gegenständen und kostbarem Schmuck beigesetzt worden waren. In der Totenstadt auf dem Esquilin findet man keine Fürstengräber mehr, die mit Gräbern aus derselben Zeit vergleichbar wären, die in den Nekropolen der Küstenstädte oder in Praeneste entdeckt worden sind. Natürlich lässt sich dieses Schweigen der Archäologie zum Teil mit den Aktivitäten von Plünderern und Baumeistern aller Art begründen, die sich im Laufe der Jahrhunderte am römischen Boden zu schaffen gemacht haben.25 Aber das genügt nicht als Erklärung, denn solche Aktivitäten gab es, wenn auch in geringerem Maße, an anderen Orten ebenfalls. Es hat ganz den Anschein, als habe die römische Elite jener Zeit beschlossen, den prunkvollen, ostentativen Reichtum, den sie bislang ihrem Übergang ins Jenseits vorbehalten hatte, nun auf ihre Lebensweise und soziale Repräsentation zu verwenden.26 Diese kollektive Entwicklung, der bei sämtlichen adligen Geschlechtern an der Spitze der Gesellschaft zu beobachtende Drang, ihre Präsenz im städtischen Raum auf nachhaltige Weise zu demonstrieren, wuchs im Verlauf des siebten Jahrhunderts v. Chr. unaufhörlich an. Auf ihr Betreiben hin wurden an unterschiedlichen Orten Kultplätze unter freiem Himmel eingerichtet, auf deren Altären Tiere geopfert wurden,27 so etwa in der Nähe des Königspalastes und auf dem Palatin, aber auch am Fuß der Velia und auf dem Forum Boarium.28 Den oft weiblichen Gottheiten wurden dort Miniaturgefäße dargebracht und anschließend in Votivgruben beigesetzt, wie sie frühere Generationen ihren Toten mitgegeben hatten. Die Urbs selbst scheint zu einer Art irdischer Transzendenz gelangt zu sein: Am Ende des siebten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung war Rom bereit für eine weitere Metamorphose.